The first volume of a world-renowned scholar's long-awaited Qur'an commentary, now available in English
Angelika Neuwirth Livres
Angelika Neuwirth est une érudite distinguée dont le travail explore les couches complexes du Coran. Ses recherches explorent les dimensions sémantiques et philologiques profondes de ce texte fondateur, offrant aux lecteurs une compréhension plus approfondie de son contexte historique et littéraire. L'approche de Neuwirth se caractérise par une analyse méticuleuse et un engagement à éclairer les complexités des études islamiques.
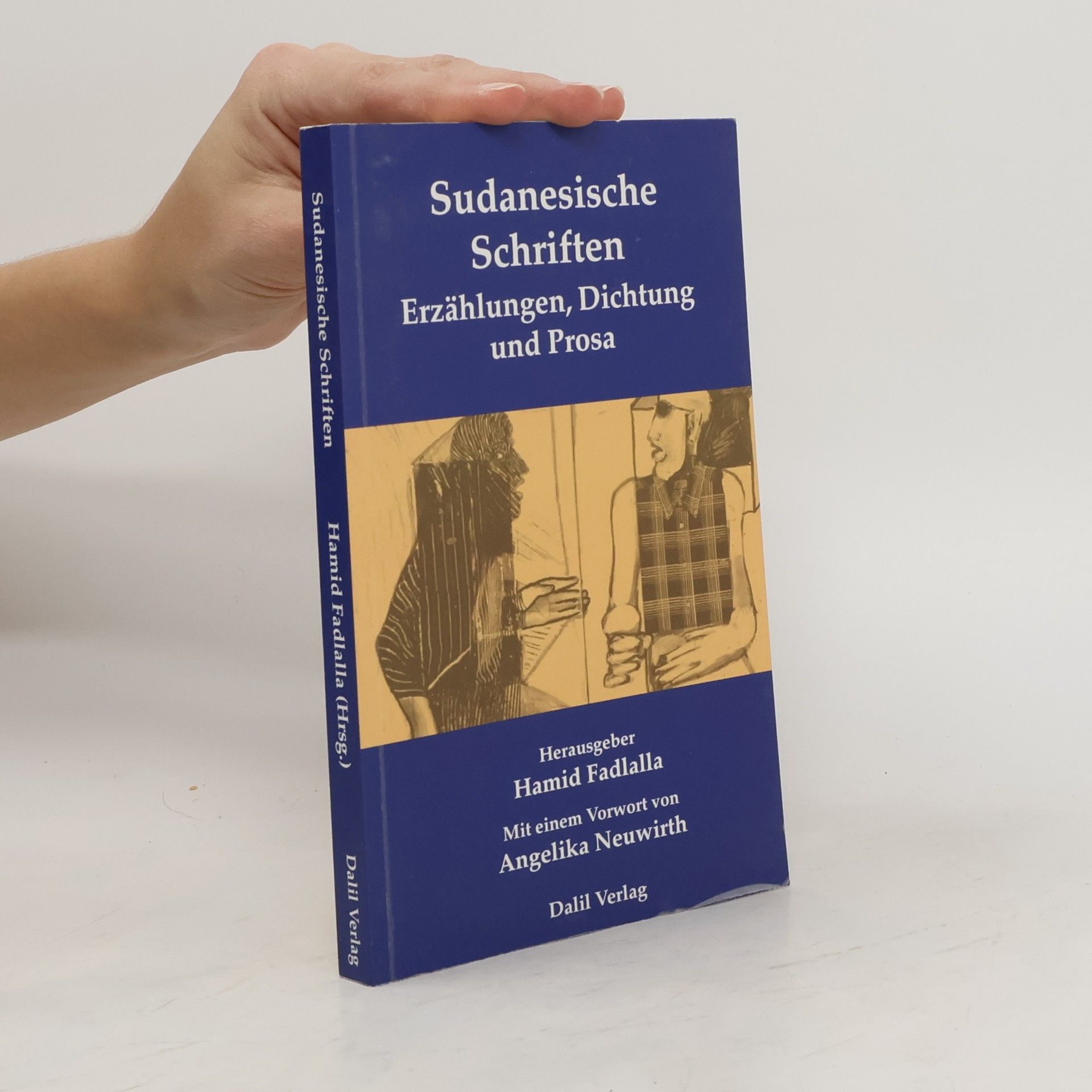

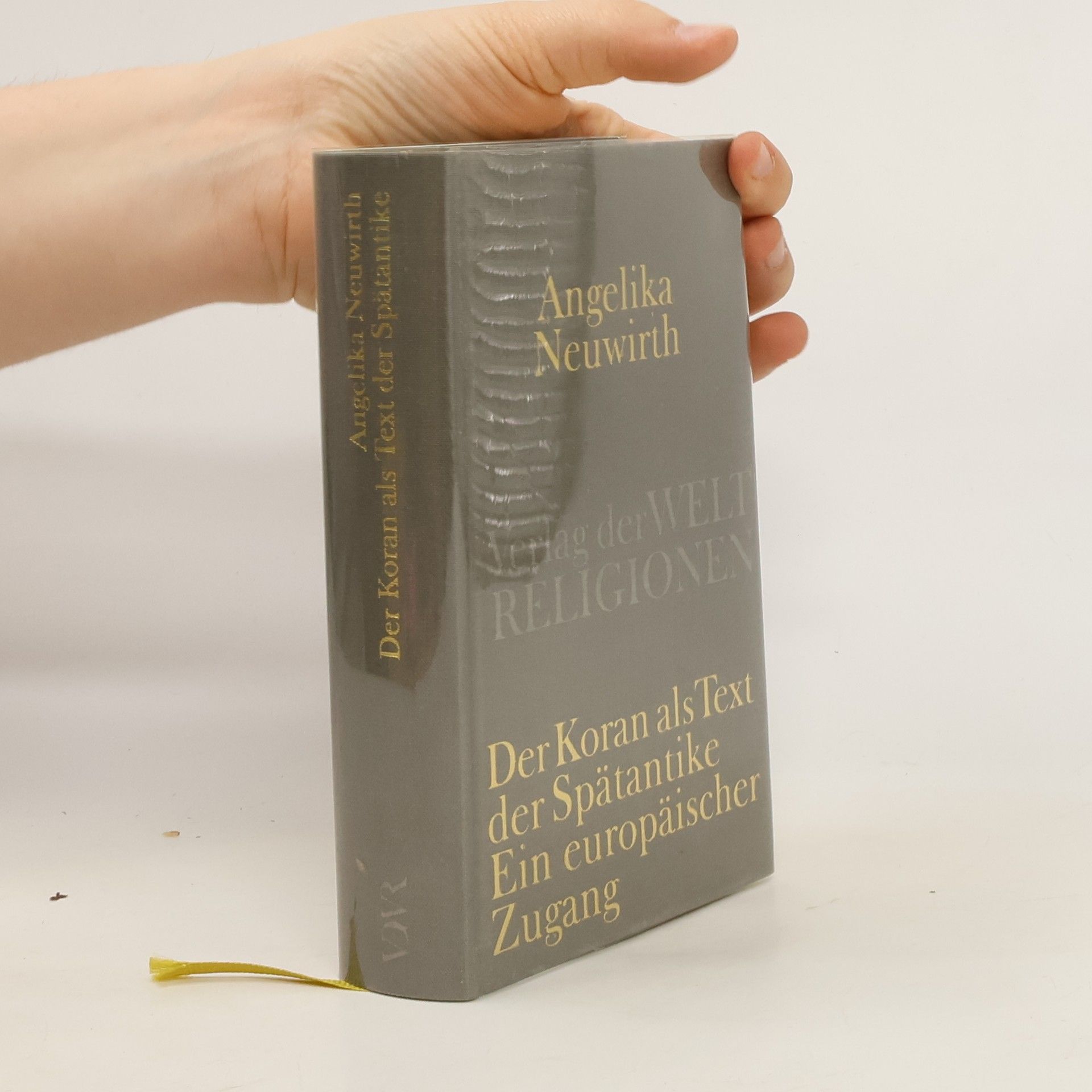



The Qur'an: Text and Commentary, Volume 2.1
Early Middle Meccan Suras: The New Elect
- 480pages
- 17 heures de lecture
This volume presents a comprehensive commentary on the Qur'an by a distinguished scholar, now accessible to English-speaking audiences. It delves into intricate interpretations and contextual analyses, offering insights into the text's theological, historical, and linguistic dimensions. The commentary aims to enhance understanding of the Qur'an's teachings and relevance, making it an essential resource for both scholars and general readers interested in Islamic studies.
Der Koran als Text der Spätantike
- 859pages
- 31 heures de lecture
Ist der Koran eine Botschaft an die Heiden der arabischen Halbinsel, die innerhalb von 22 Jahren zur Gründung einer neuen Religion führte? Ist er die kanonisierte heilige Schrift, die uns authentisch erhalten ist? Angesichts seines beispiellosen Erfolgs wird diese Darstellung immer wieder hinterfragt, und es werden Hypothesen formuliert, die die frühislamische Geschichte umschreiben und den Koran an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit und sogar ohne Muhammads Mitwirkung entstehen lassen. Diese Rekonstruktionen sind jedoch oft unvereinbar und werfen neue Probleme auf. Die entscheidende Frage lautet: Ist der Koran wirklich ein rein islamischer Text, der dem westlichen Leser fremd ist? Oder ist er eher eine neue Stimme in den spätantiken Debatten, die auch die Grundlagen der jüdischen und christlichen Religion prägten? Anstatt den Koran aufgrund neuer Handschriftenfunde oder linguistischer Experimente umzuformen, sollten wir unsere Perspektive auf ihn ändern, um seine revolutionäre Neuheit zu erkennen. Angelika Neuwirth, Leiterin des Projekts Corpus Coranicum, betrachtet den Koran als einen Text der Spätantike, einer Epoche, die auch für die europäische Kulturgeschichte prägend war. So wird der Koran als vertrauter Text sichtbar, den wir unvoreingenommen als Teil des 'europäischen Erbes' betrachten könnten.
Der Koran - Handkommentar. Bd.1
- 751pages
- 27 heures de lecture
In ihrem 2010 im Verlag der Weltreligionen erschienenen Buch Der Koran als Text der Spätantike hat Angelika Neuwirth die Grundlage für ihre fünfbändige Übersetzung und Kommentierung des Koran gelegt. Der nun folgende erste Band enthält die Anfänge der Verkündigung Muhammads. In chronologischer Ordnung, beginnend mit der vermutlich ältesten Sure 93, analysiert und deutet Neuwirth die Entwicklung seiner prophetischen Botschaft. Jede Sure wird in Umschrift und neuer Übersetzung vorgestellt und dann eingehend kommentiert. Herzstück eines jeden Surenkommentars ist eine Vers-für-Vers-Auslegung, in der neben sprachlichen und inhaltlichen Erläuterungen die denkerische Auseinandersetzung mit der religiösen Umwelt sowie die innerkoranische Weiterentwicklung zentraler Themen nachgezeichnet werden.--provided by publisher.
Sudanesische Schriften
Erzählung, Dichtung und Prosa
Im Materialreichtum und in der Vielfalt der zusammengetragenen philologischen Erkenntnisse übertrifft dieser Handkommentar alle vergleichbaren in europäischen Sprachen vorliegenden Werke. Tilman Nagel, Neue Zürcher Zeitung
Der Koran
Bd. 2/2: Spätmittelmekkanische Suren. Von Mekka nach Jerusalem – Der spirituelle Weg der Gemeinde heraus aus säkularer Indifferenz und apokalyptischem Pessimismus. Handkommentar
- 800pages
- 28 heures de lecture
Zwischen Tempel und Zitadelle
Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels und seine Erneuerung im Islam
Die Vorlesungsreihe will zum einen an den Forscher Julius Wellhausen (1844-1918) erinnern, zum anderen zur Fortsetzung und öffentlichen Verbreitung der Forschungen in den von ihm repräsentierten und benachbarten philologisch-historischen Disziplinen beitragen. Julius Wellhausen forschte im Laufe seines Lebens über drei Gebiete: das Alte Testament, das Neue Testament und das alte Arabien, anders ausgedrückt: das Judentum, das Christentum und den frühen Islam. Die nach ihm benannte, jährlich stattfindende Vorlesung wird vom Centrum Orbis Orientalis et Occidentalis (CORO) veranstaltet, das gemeinsam von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und der Georg-August-Universität Göttingen getragen wird.

