Martin Schwab Livres



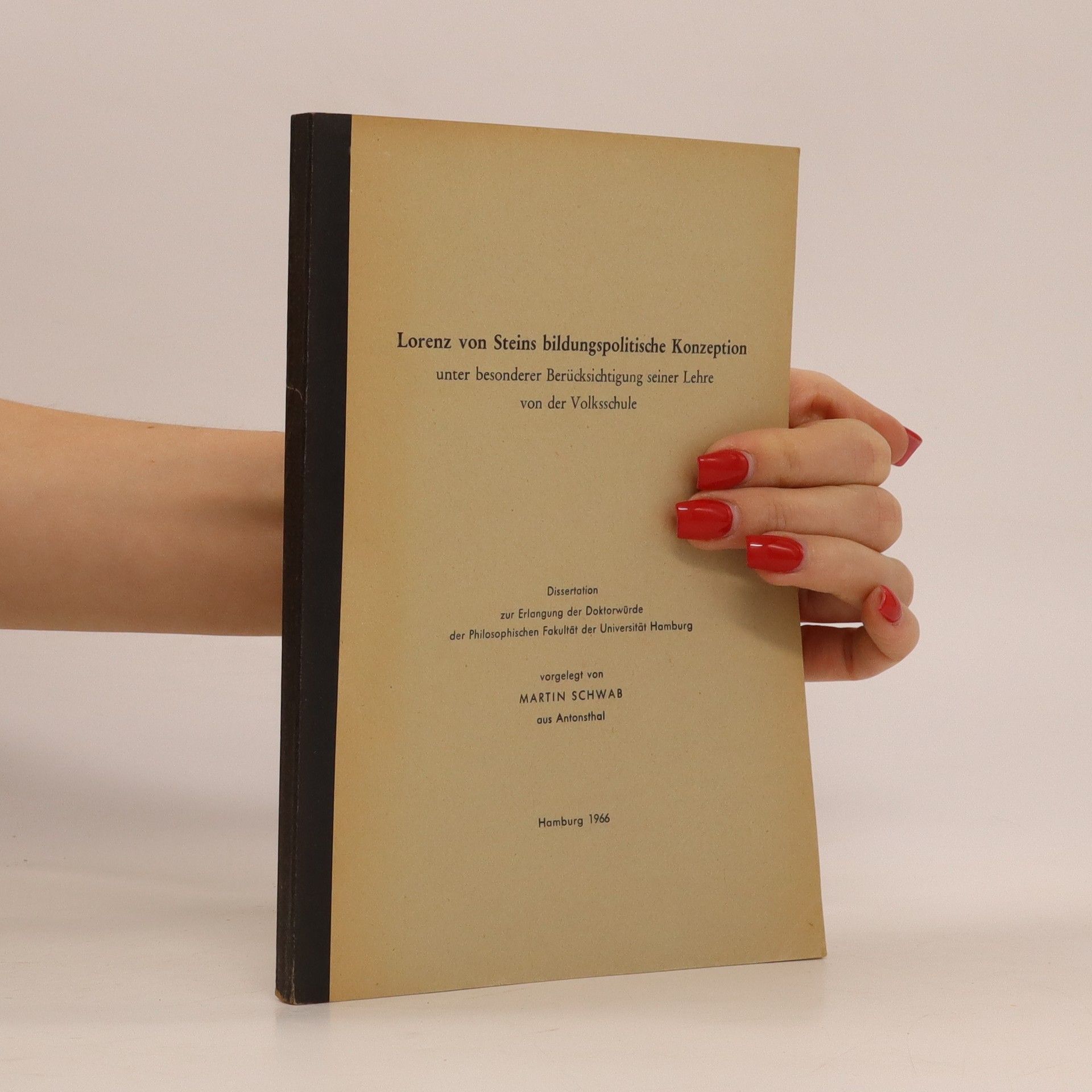
Die Neuauflage: Der Band stellt das Zivilprozessrecht in seinen Grundstrukturen und systematischen Zusammenhängen dar. Der Autor beschränkt sich auf das für die Prüfungen Wesentliche und bietet so einen mühelosen Einstieg in die Materie. Zahlreiche kurze Beispielsfälle und schematische Übersichten illustrieren die Darstellung. Das vorlesungsbegleitende Lehrbuch wendet sich an Studierende bis zur ersten juristischen Prüfung.
Schwerpunkte Pflichtfach - 4: Zivilprozessrecht
- 384pages
- 14 heures de lecture
Die Neuauflage: Der Band stellt das Zivilprozessrecht in seinen Grundstrukturen und systematischen Zusammenhängen dar. Der Autor beschränkt sich auf das für die Prüfungen Wesentliche und bietet so einen mühelosen Einstieg in die Materie. Zahlreiche kurze Beispielsfälle und schematische Übersichten illustrieren die Darstellung. Das vorlesungsbegleitende Lehrbuch wendet sich an Studierende bis zur ersten juristischen Prüfung.