Hans Patze Livres
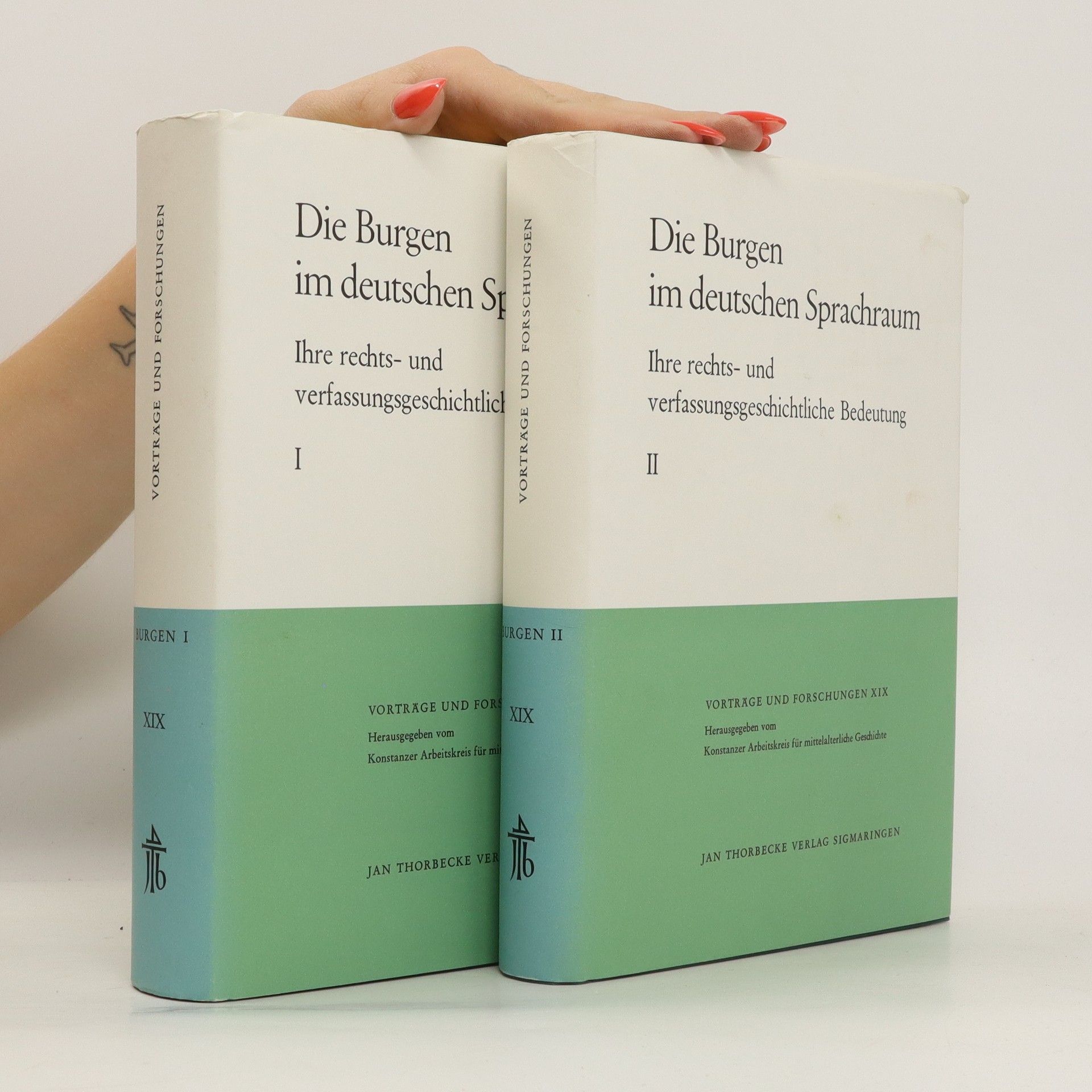
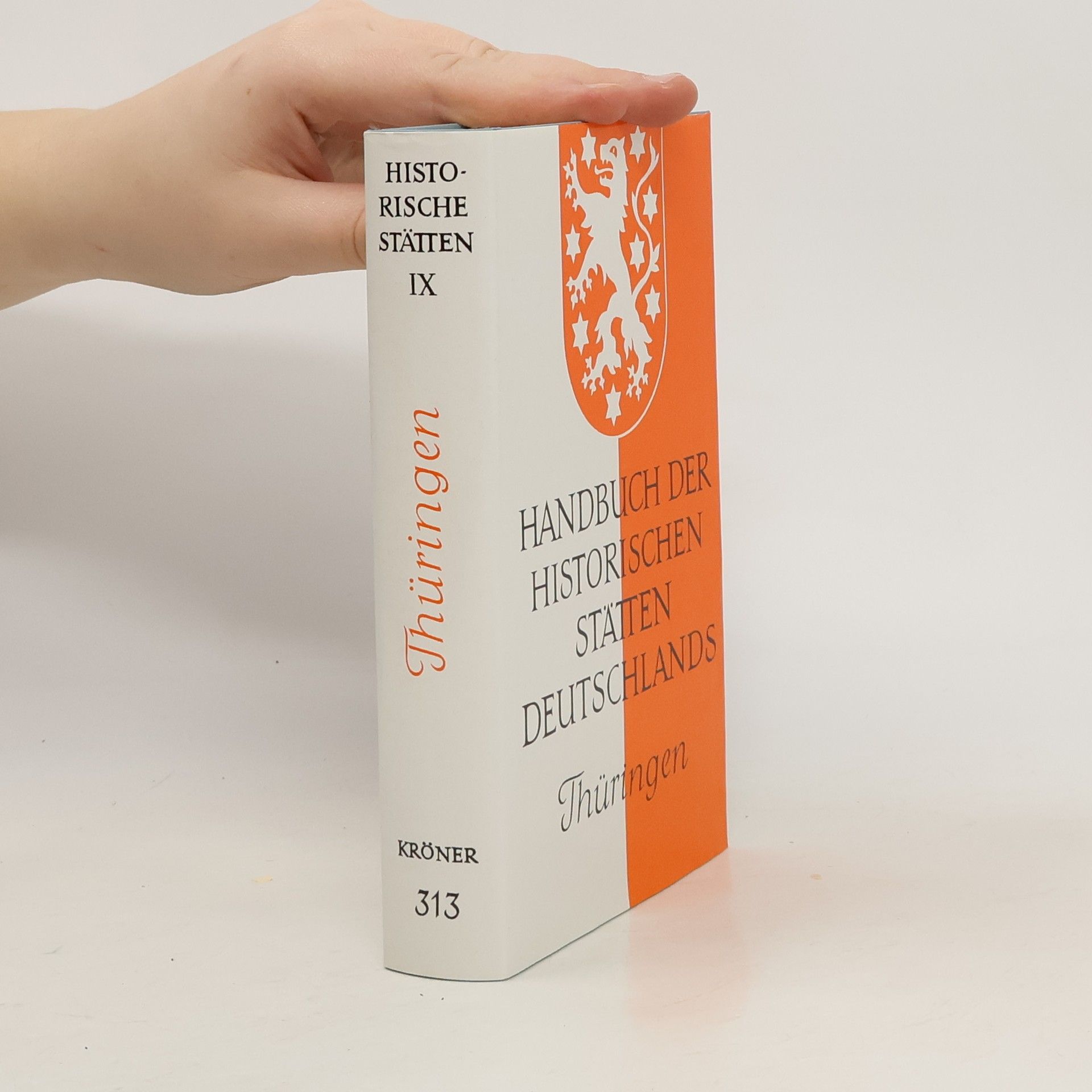
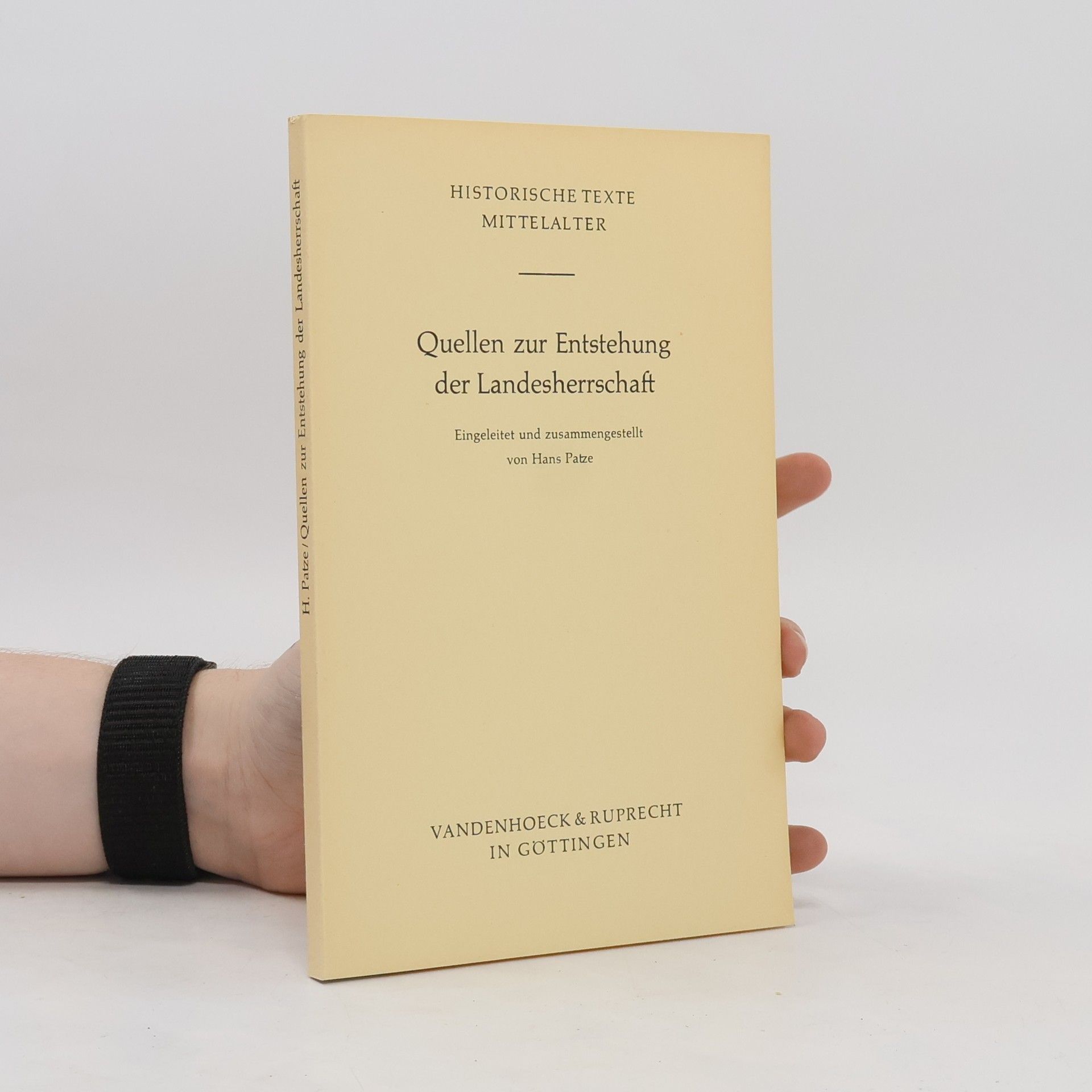
Thüringen
- 592pages
- 21 heures de lecture
Das umfassende, alphabetisch nach Orten geordnete Nachschlagewerk zur Geschichte Thüringens ist für den Regionalhistoriker unentbehrlich, für den historisch interessierten Reisenden ein zuverlässiger Begleiter und für den Thüringer ein einzigartiges Erinnerungsbuch.