Ein unaufgeregter Beitrag zur Integrationsdebatte: Anhand von biographischen Interviews erkundet dieses Buch persönliche Beziehungen zwischen türkischstämmigen Zuwanderern und Deutschen. Haben Angehörige der zweiten Migrantengeneration eigentlich viele deutsche Freunde und Freundinnen? Welche Erfahrungen machen sie mit deutschen Kollegen und Nachbarn? Wo streitet, wo hilft man sich, was lernt man voneinander? Auf solche Fragen antworten zahlreiche Porträts und mehrere Themenbeiträge.
Bernd Jürgen Warneken Livres
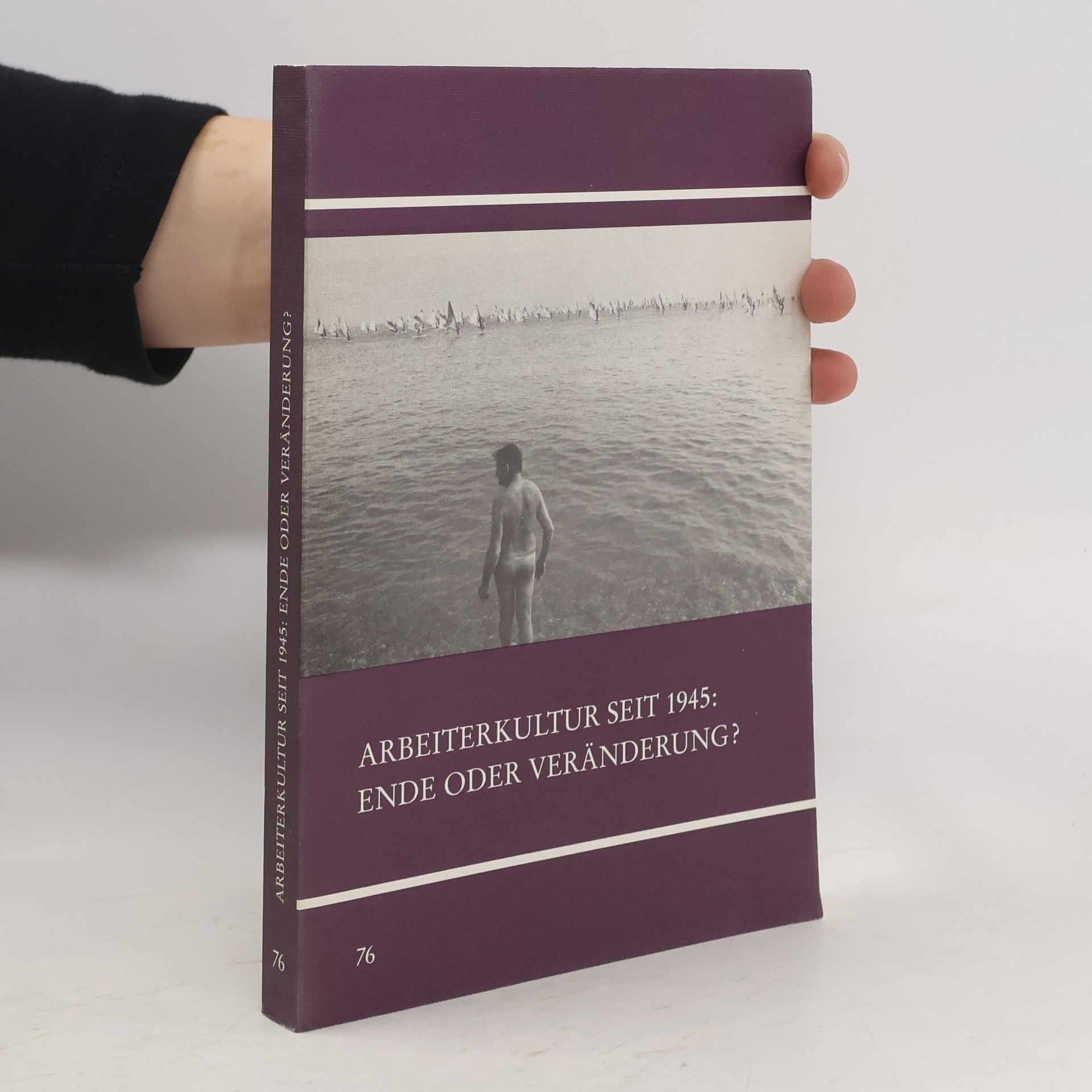


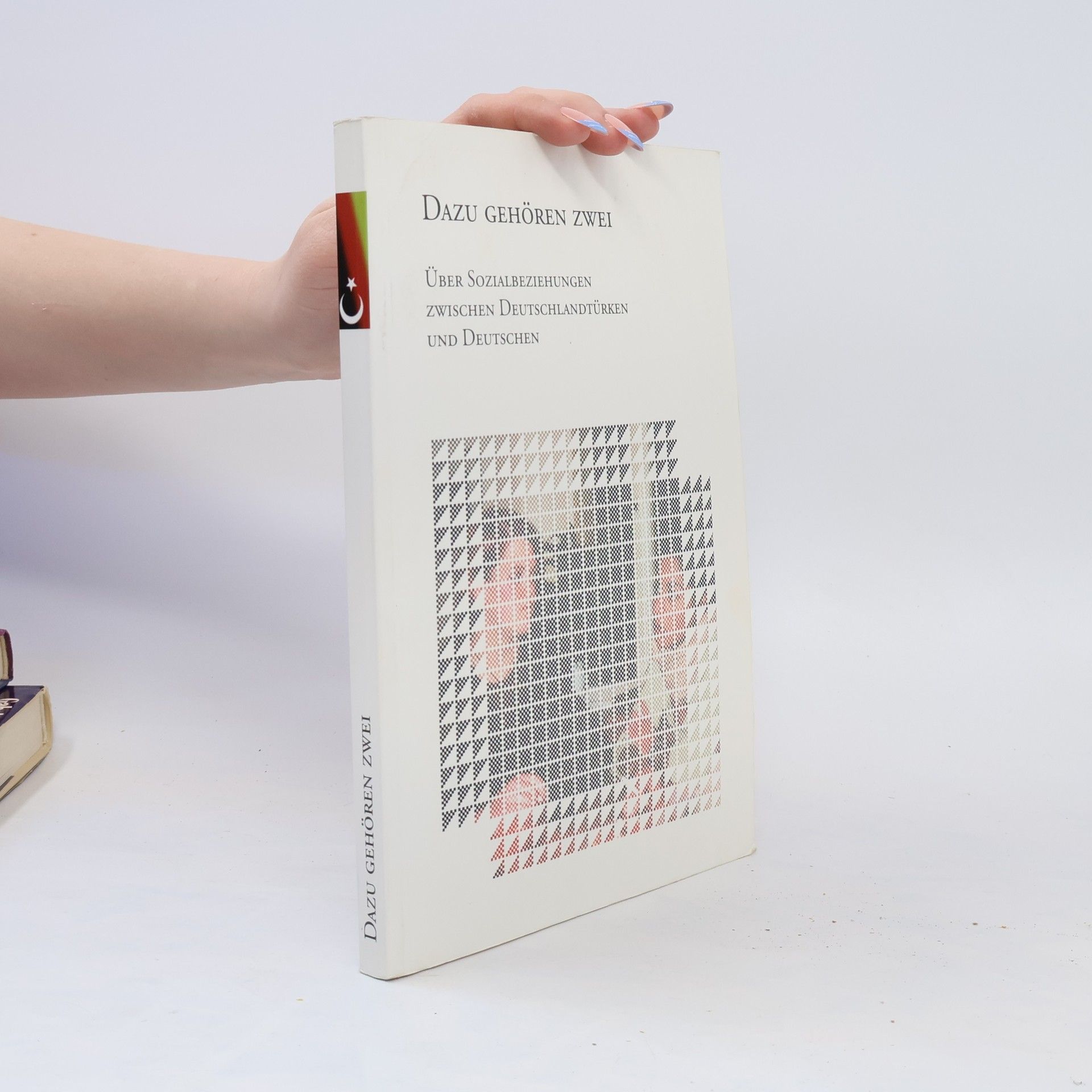
Literarische Produktion
- 156pages
- 6 heures de lecture
Bewegliche Habe
zur Ethnografie der Migration : Begleitband zur Ausstellung im Haspelturm des Schlosses Hohentübingen vom 14.2. bis 16.3.2003
- 119pages
- 5 heures de lecture
Wird Arbeiterkulturforschung mehr und mehr zur Reliktforschung? Die Literatur hierüber vermittelt ein differenziertes Bild. Bei der Alltagskultur ansetzende Untersuchungen zeigen, daß arbeiterspezifische Habitus- und Mentalitätsformen das „Ende der Proletarität“ überlebt haben. Und nicht wenige Traditionsstränge der historischen Arbeiterbewegungskultur finden sich – gewiß nicht unverändert – in Konzeptionen und Praxisformen der neuen sozialen Bewegungen wieder. Der vorliegende Sammelband, zu dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehrerer Fächer und Länder beigetragen haben, gibt einen Überblick über den Diskussionsstand der späten 80er Jahre.