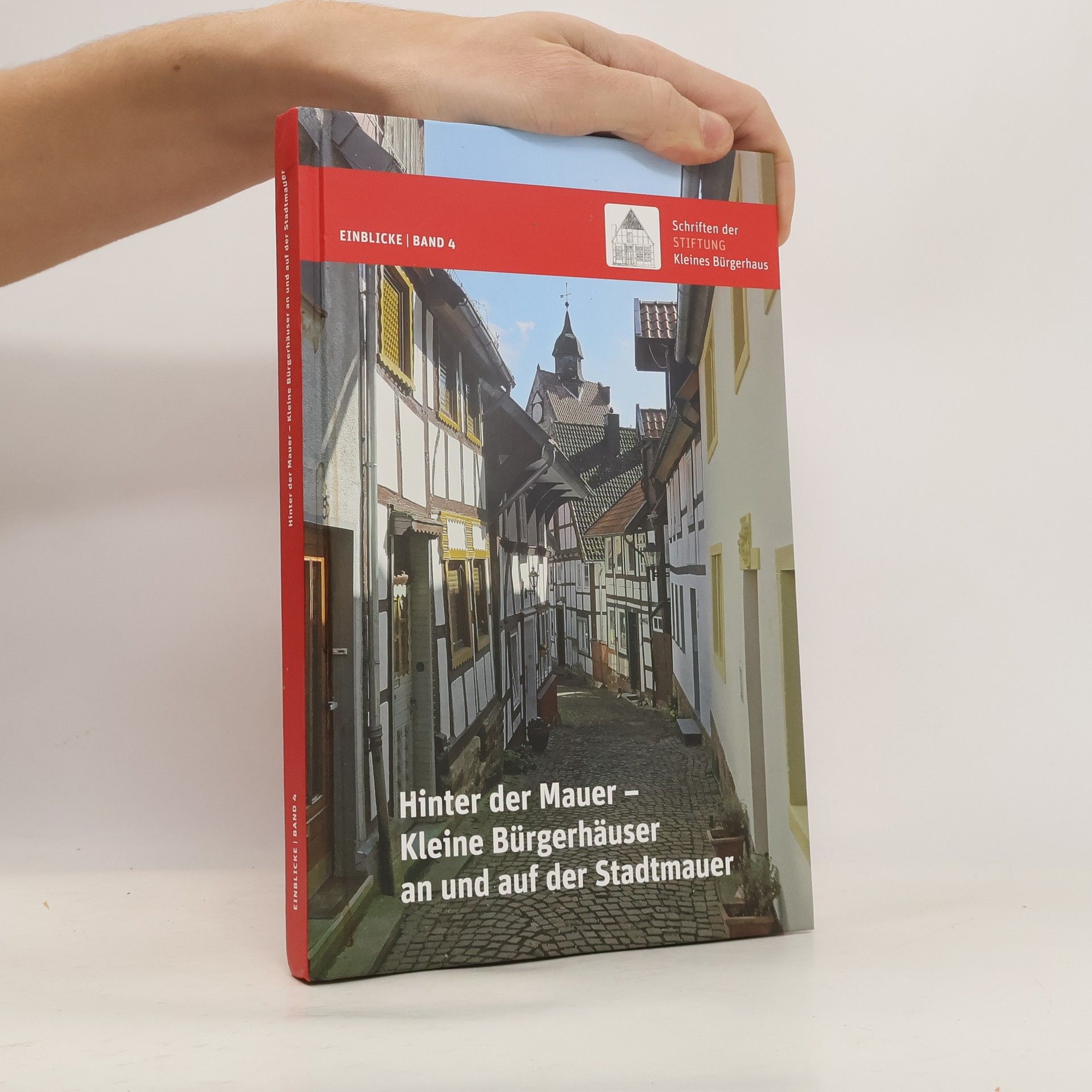Krambude, Boutique und Laden
- 207pages
- 8 heures de lecture
Jeder Band der EINBLICKE-Reihe widmet sich einem Schwerpunktthema und bietet eine umfassende Übersicht zum Thema "Kleines Bürgerhaus". In diesem Band stehen Kleine Häuser im Fokus, die in städtischen Marktbereichen und Handelszentren angesiedelt waren. Diese kleinen Gebäude dienten Händlern zur Präsentation ihrer Waren, Handwerkern zur Herstellung von Produkten und boten Platz zur sicheren Aufbewahrung wertvoller Güter. Oft beinhalteten sie Arbeits- und Verkaufsräume sowie Schlaf- und Lagermöglichkeiten. Verkaufsboutiquen prägten Stadtzentren, Wallfahrtskirchen und Kurorte. Die Bezeichnungen für diese Bauten variieren, von Bude und Gadem bis hin zu Boutique, Comptoir, Kiosk und Bazar seit dem 17. Jahrhundert. Im Laufe der Zeit wurden sie für unterschiedliche Zwecke genutzt und sind oft nur für Kenner erkennbar. Der Band beleuchtet erstmals die Geschichte, Funktionen und Erscheinungsformen dieses wenig beachteten Bautyps und zeigt seine Bedeutung für die Entwicklung städtischer Zentren in Nordwestdeutschland, ergänzt durch Beispiele aus ganz Europa. Weitere Aufsätze thematisieren Kleine Häuser als Lebensräume der Flussschiffer an der Weser sowie den Wiederaufbau eines Behelfsheims im Freilichtmuseum Detmold, was das wachsende Interesse an der Dokumentation der Lebensverhältnisse "kleiner Leute" verdeutlicht. Die Vergabe des Preises "scheinbar unscheinbar" ist ein zentrales Element der STIFTUNG Kleines Bürgerhaus, mit ausführlic