Bruno Thoß Livres


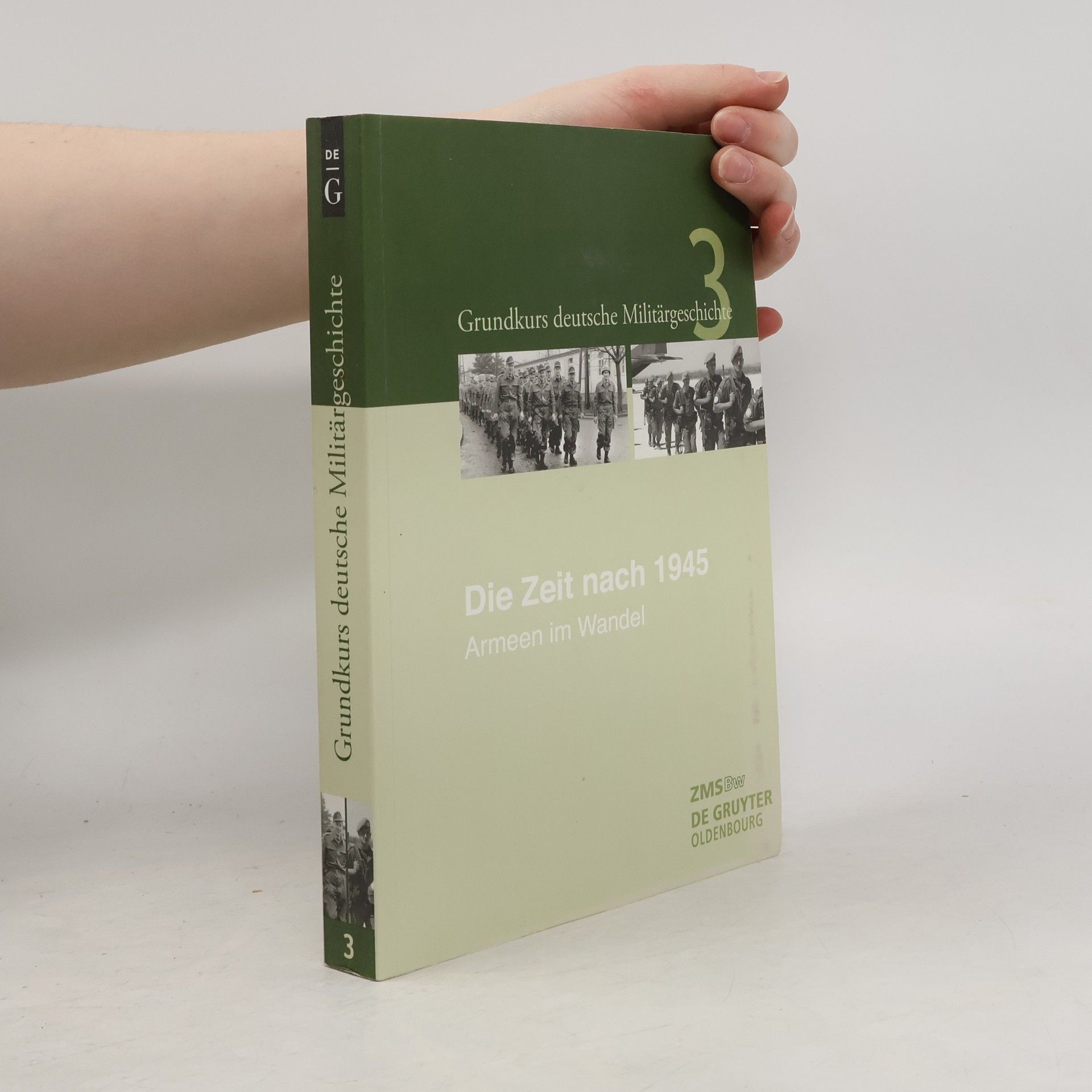
Vom Kalten Krieg zur deutschen Einheit
Analysen und Zeitzeugenberichte zur deutschen Militärgeschichte 1945 bis 1995
Hochrangige Zeitzeugen - unter ihnen die ehemaligen Verteidigungsminister Leber, Apel und Stoltenberg sowie die Generale Altenburg, Graf Kielmansegg, de Maizière, Naumann und Schmückle - berichten über die Schlüsselereignisse aus fünfzig Jahren deutscher Militärgeschichte nach 1945. Ausgewiesene Sachkenner - Wissenschaftler aus Universitäts- und Forschungsinstituten - analysieren sie unter Einbeziehung auch neuer sowjetischer Quellen.
Die Zeit der Weltkriege, oft als „zweiter Dreißigjähriger Krieg“ bezeichnet, gilt als „Katastrophenzeit“ der deutschen Geschichte. Zwei entscheidende militärische Niederlagen des Deutschen Reiches ebneten den Weg für eine stabile parlamentarische Demokratie und deren Verankerung im gesellschaftlichen Pluralismus der Bundesrepublik. Diese Entwicklung ging auch mit einem Wandel in der Einstellung zu Krieg und Militär im deutschen Bewusstsein einher. Die politischen Konsequenzen der beiden Weltkriege sind unbestreitbar: der Zusammenbruch des Reiches als europäische Großmacht, der demokratische Umbau der politischen Strukturen und die Zerschlagung des militärischen Machtinstruments. Unklar bleibt jedoch, wie stark die Weltkriege die gesellschaftlichen Umbrüche in Deutschland beeinflussten und ob sie den Weg in die Moderne beschleunigten oder verlangsamten. In einer Sammlung vergleichender Studien zu Phänomenen beider Weltkriege werden drei zentrale Fragen aufgeworfen: (1) Wie veränderte der Krieg sein Gesicht unter erweiterten Bedingungen? (2) Wie wurden diese Veränderungen von Zeitzeugen wahrgenommen? (3) Welche Umdeutungen erfuhr die unterschiedliche Kriegswirklichkeit in den Prozessen der Verarbeitung? Die Analyse von Ähnlichkeiten und Unterschieden in der Führung, Wahrnehmung und Verarbeitung beider Kriege bietet erste vergleichende Ergebnisse und Anregungen für zukünftige Forschungen, die das „Zeitalter der Weltkriege“ umfass