Hören als Handeln
Eine neurophysiologische Theorie der musikalischen Wahrnehmung
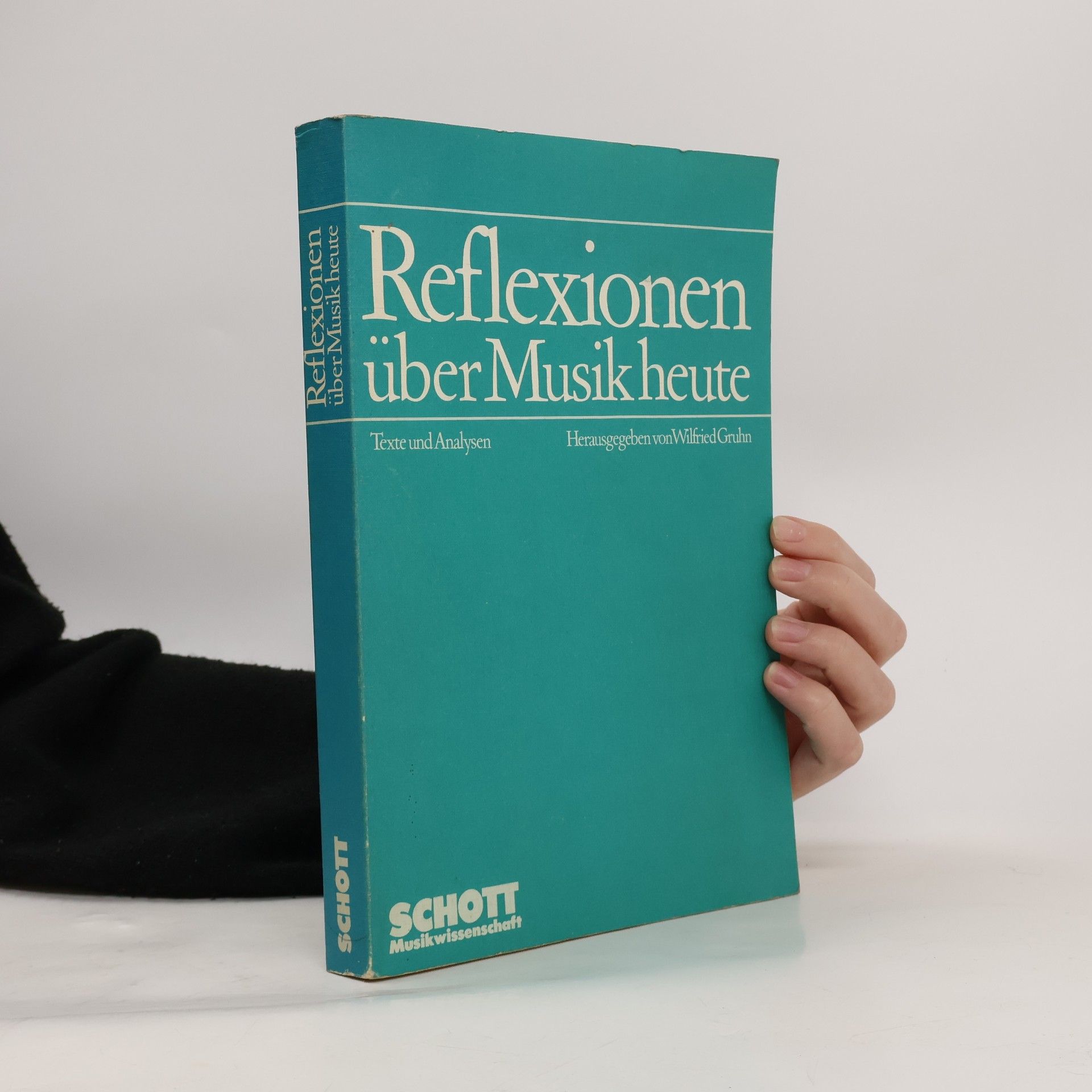
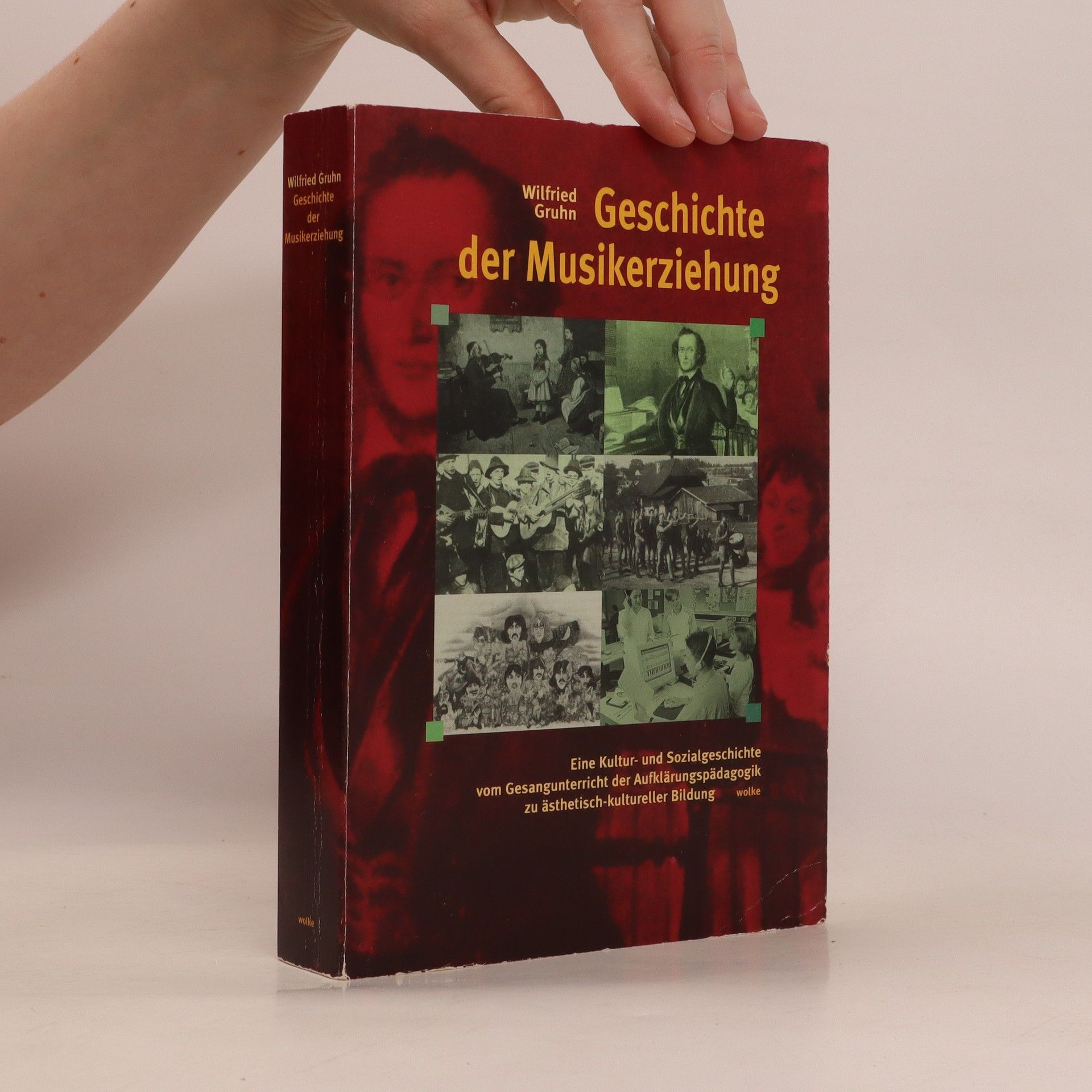
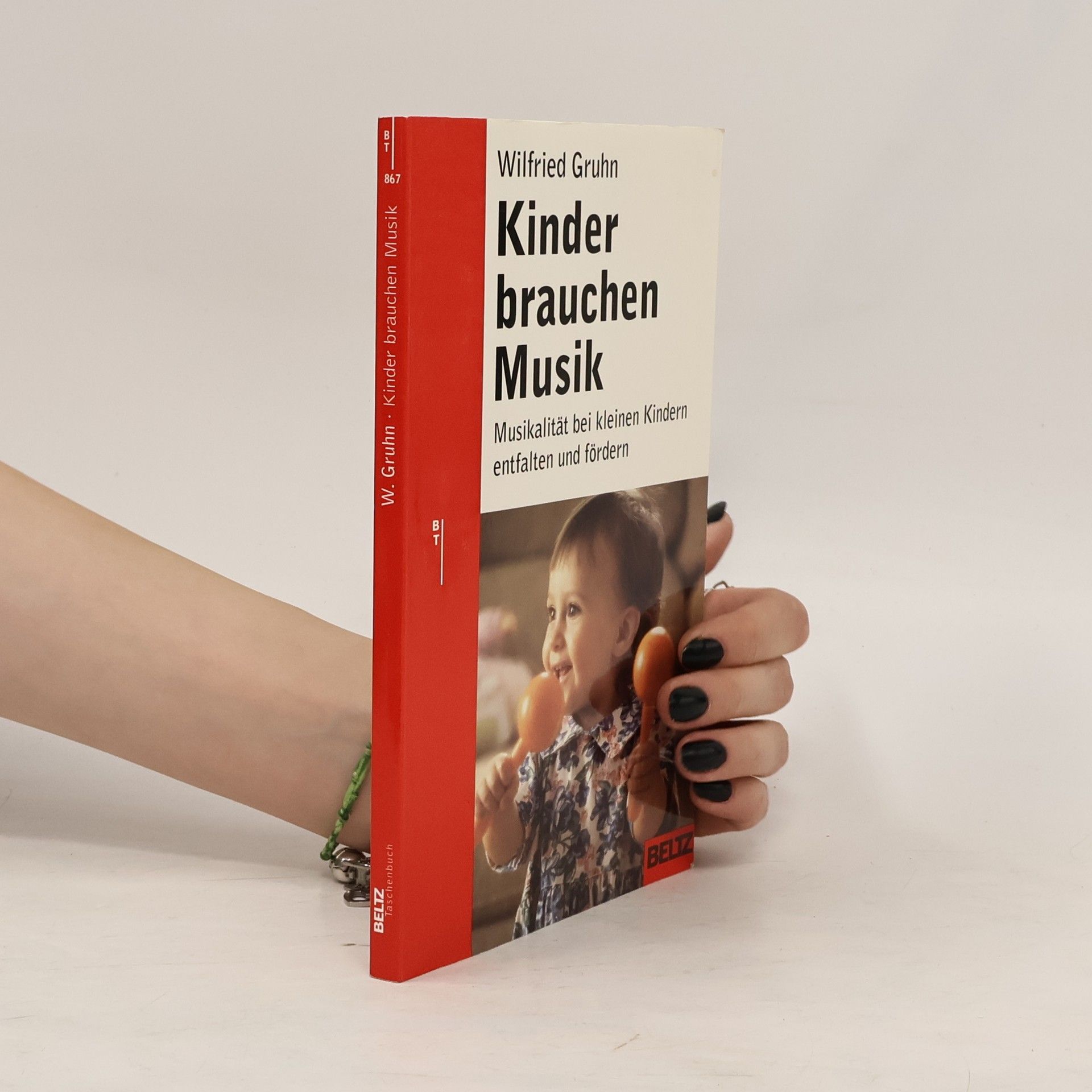

Eine neurophysiologische Theorie der musikalischen Wahrnehmung
Jedes Kind reagiert auf Klänge, auf Rhythmen - schon im Mutterleib und vom ersten Lebenstag an. Dieses Buch möchte Eltern, Großeltern, Lehrerinnen und Erzieherinnen ein Ratgeber in ihrem Bestreben sein, kleine Kinder von Geburt an mit Musik vertraut zu machen und sie ihnen auf ganz natürliche Weise nahe zu bringen, ohne gleich an spätere Leistungen zu denken. Was können wir tun, wenn sich bei Vorschulkindern das Bedürfnis nach Klang und Musik zeigt? Wie können wir möglichst offen und vielseitig musikalische Anregungen geben? Wie können wir da, wo sich eine besondere Anlage nicht offen zeigt, vielleicht musikalisches Interesse wecken? Auf diese und viele andere Fragen antwortet das Buch und erklärt darüber hinaus aus lernpsychologischer Sicht, wie Kinder eigentlich Musik lernen, d. h. welche Schritte dabei aufeinander folgen. Ausführlich und fundiert geht der Autor auch auf die aktuelle Fragestellung ein, ob und wie sich Musik auf die Entwicklung des Gehirns schon des Kleinkinds auswirkt und welche Voraussetzungen hierfür im welchen Alter am günstigsten sind. Ebenso behandelt wird die Frage, ob und welcher Zusammenhang zwischen Musikerfahrung und Intelligenz („Mozart-Effekt“) besteht.
Eine Kultur- und Sozialgeschichte vom Gesangunterricht der Aufklärungspädagogik zu ästhetisch-kultureller Bildung
Das Buch liefert Texte und Analysen zum Verständnis kompositionstheoretischer wie kompositionsästhetischer Fragestellungen. Dabei geht es weder um eine lückenlose chronologische Darstellung der neuesten Musikgeschichte, noch ist Vollständigkeit aller Tendenzen und Aspekte angestrebt; vielmehr werden übergreifende Problemzusammenhänge kompositorischen Denkens erörtert, das von exemplarischen Werken aus erschlossen werden soll, die sich als Knotenpunkte eines Netzes von Prinzipien, Verfahren, Gattungen und Funktionen der verschiedenen Entwicklungsstadien Neuer Musik erwiesen haben.