Sexualität und Emotionalität in der vormodernen Ehe
- 595pages
- 21 heures de lecture

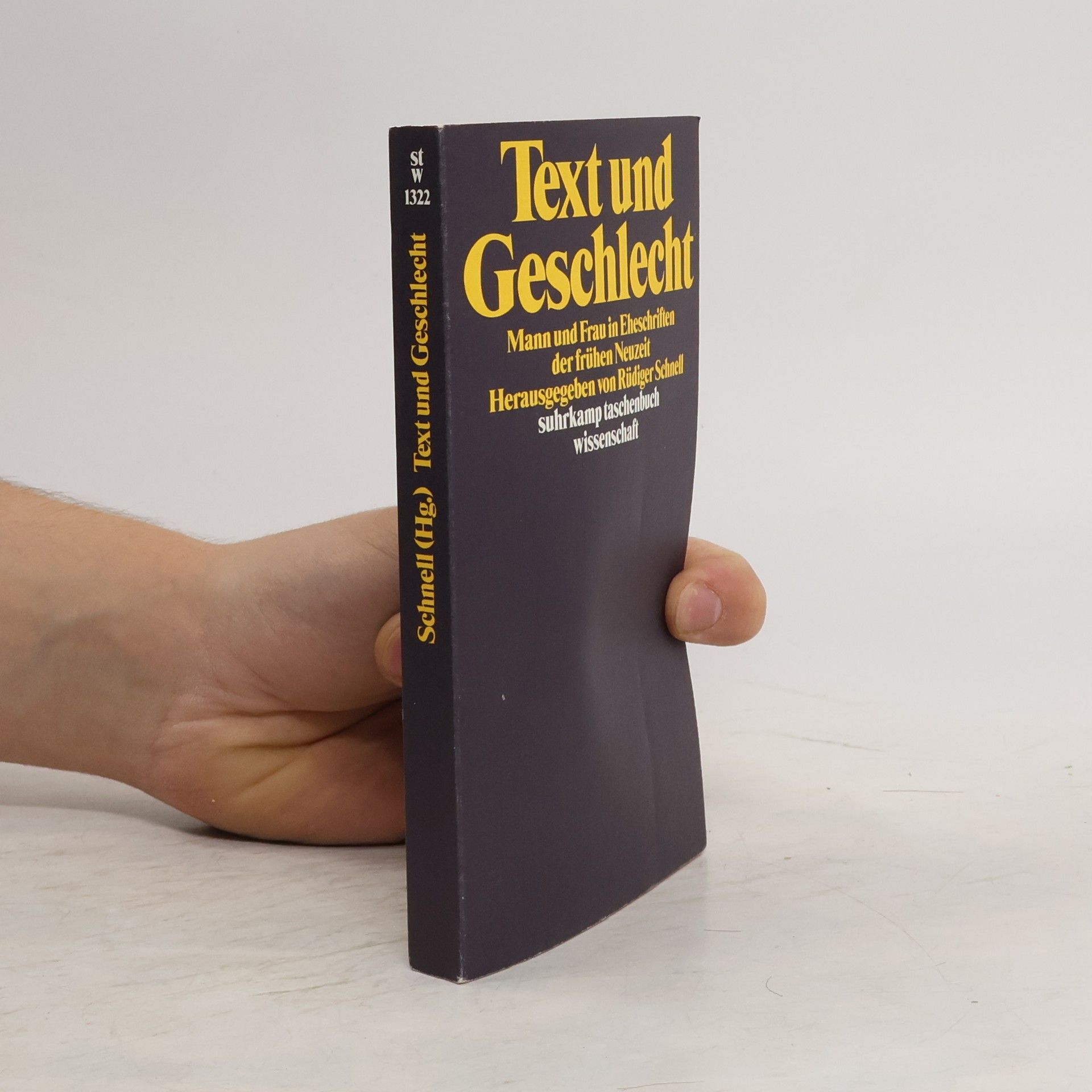

Mann und Frau in Eheschriften der frühen Neuzeit
Während neueste Untersuchungen im 15./16. Jahrhundert einen Wandel der Geschlechterbeziehungen erkannten und ihn durch sozial- und mentalitätsgeschichtliche Veränderungen zu erklären suchten, halten die Autoren der in diesem Band enthaltenen Texte in erster Linie nicht nach historischen Veränderungen und epochengeschichtlichen Zäsuren Ausschau, sondern erproben die Tragfähigkeit einer textwissenschaftlichen Analyse der Kategorie Geschlecht. Unterschiede in den Geschlechterprojektionen werden nicht vorschnell auf außertextuelle Erklärungsmomente zurückgeführt, sondern auf literarische Faktoren und rhetorische Strategien, auf wechselnde Kommunikationssituationen und Gebrauchsfunktionen.
Das 12. Jahrhundert gilt gemeinhin als ein Jahrhundert der Paradigmenwechsel: Es soll die Natur, das Individuum, die Liebe und die Fiktionalität entdeckt haben. Zu dieser Zeit setzt die Rezeption der naturphilosophischen aristotelischen Schriften ein, und die volkssprachige weltliche Dichtung etabliert sich im mittelalterlichen Literatursystem. Einer der zahlreichen Kristallisationspunkte für die Umbrüche und Adaptionen zwischen den verschiedenen Wissenstraditionen ist die Frage nach der Seele: nach ihrer Natur, Entstehung und Substanz, ihrem Verhältnis zum sterblichen Körper und zu Gott. Der Band lotet aus, welche gemeinsamen Grundlagen in der mittelalterlichen Auseinandersetzung mit der Seele erkennbar sind. Es wird danach gefragt, worin die jeweiligen fachspezifischen Differenzen in der Konzeption dessen bestehen, was in der Theologie, der Philosophie oder der Dichtung als ‚Seele‘ aufgefasst und diskutiert wird. Die interdisziplinär ausgerichteten Beiträge widmen sich u. a. Themen wie der ‚Seele im Paradigma von Affekt und Emotion‘, ‚Mikrokosmos-Makrokosmos: Die Seele im Kontext der Schöpfung‘ oder den ‚Architekturen von Innen und Außen‘.