Lebenslanges Lernen wird immer wichtiger – und damit die Erwachsenenbildung. Das findet seinen Niederschlag im Studium der Bildungs- und Erziehungswissenschaft, auch schon im grundständigen BA-Studium, zu dem die Erwachsenenbildung als fester Bestandteil gehört. Ein neuer Band aus der Reihe »Bachelor | Master«: mit Definitionskästen, Reflexionsfragen, Beispielen, Übersichten, weiterführender Literatur und zusätzlichem Material zum Downloaden im Internet. Aus dem Inhalt • Lehren und Lernen • Einrichtungen und Organisationen • Teilnehmer und Adressaten • berufliche Handlungskompetenzen
Peter Faulstich Ordre des livres

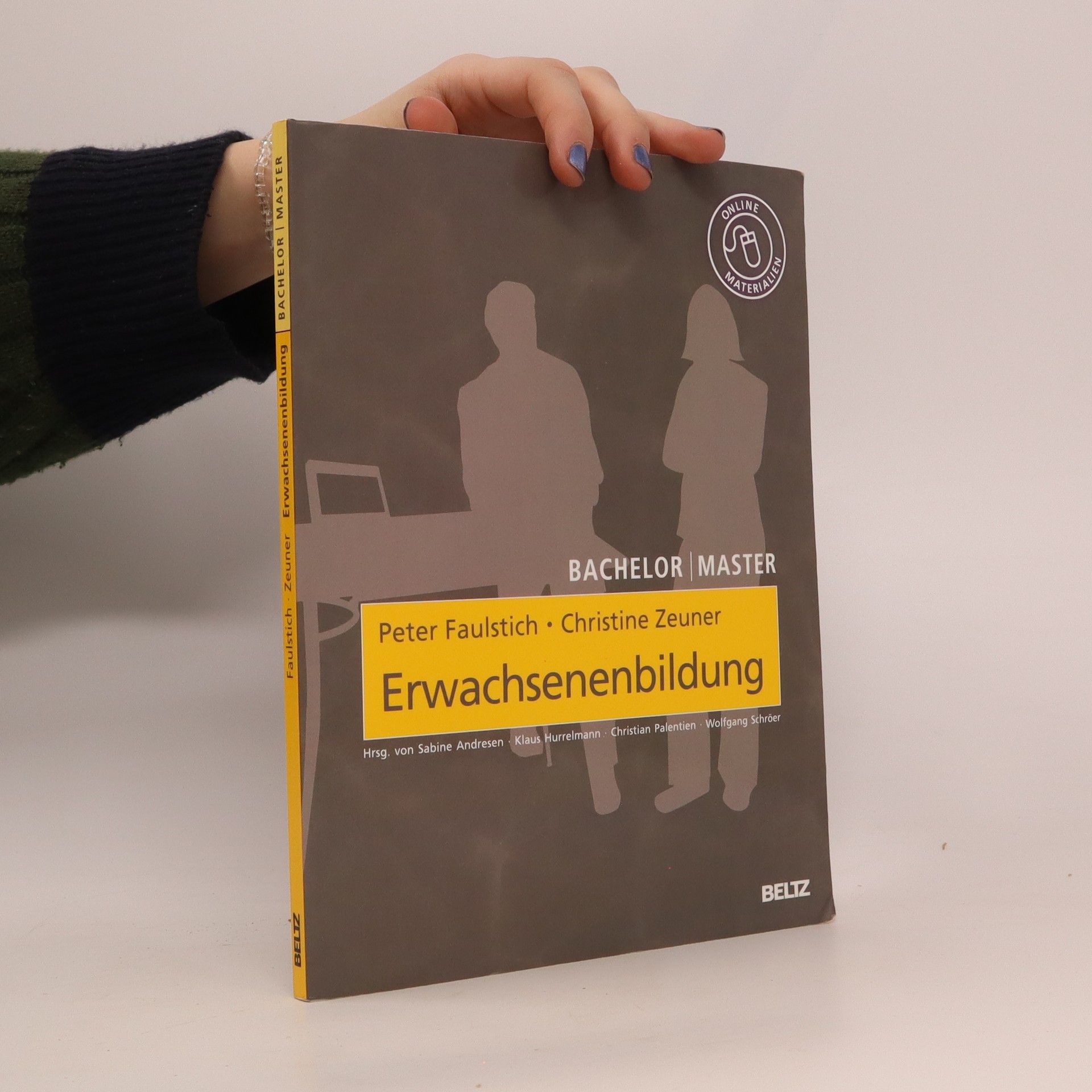
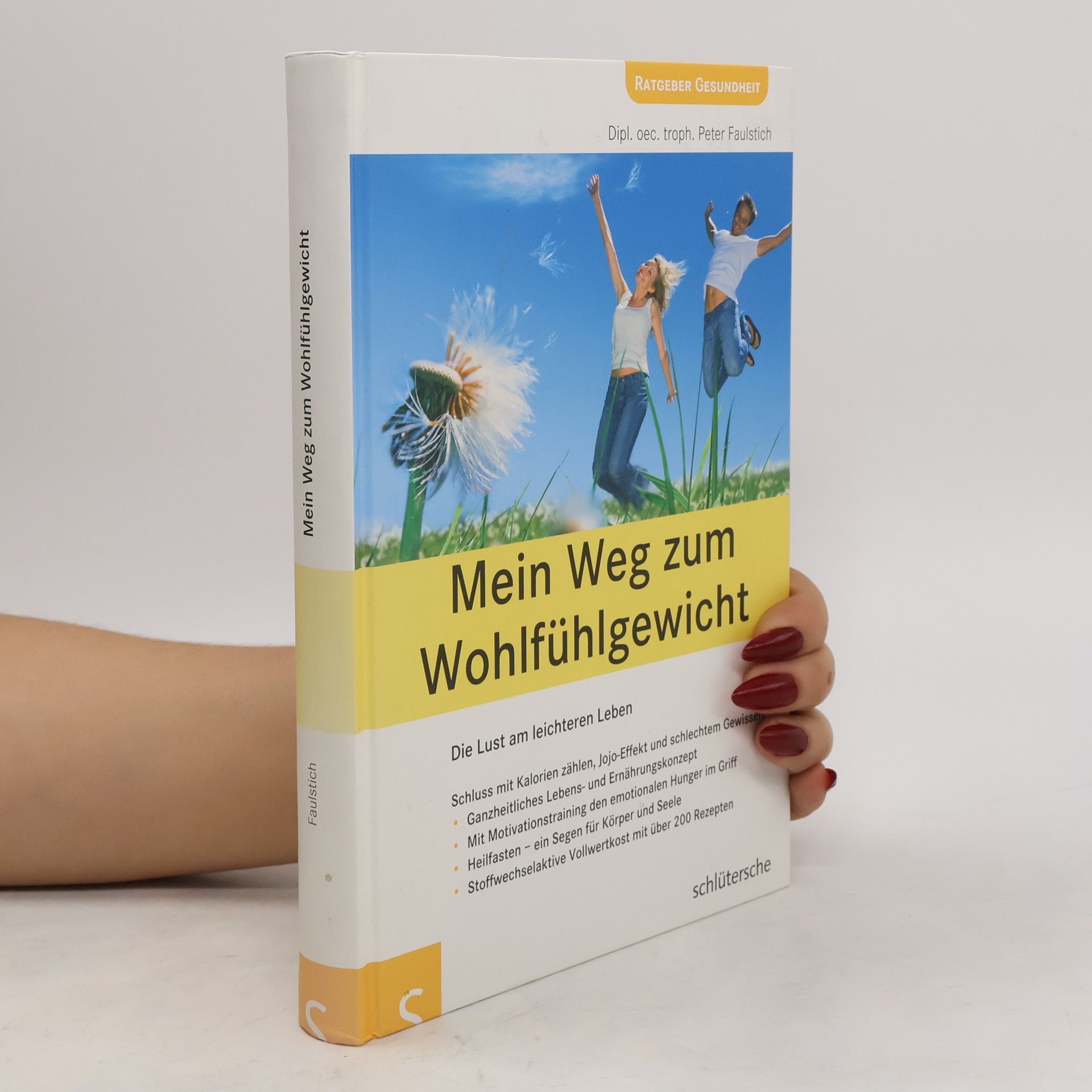
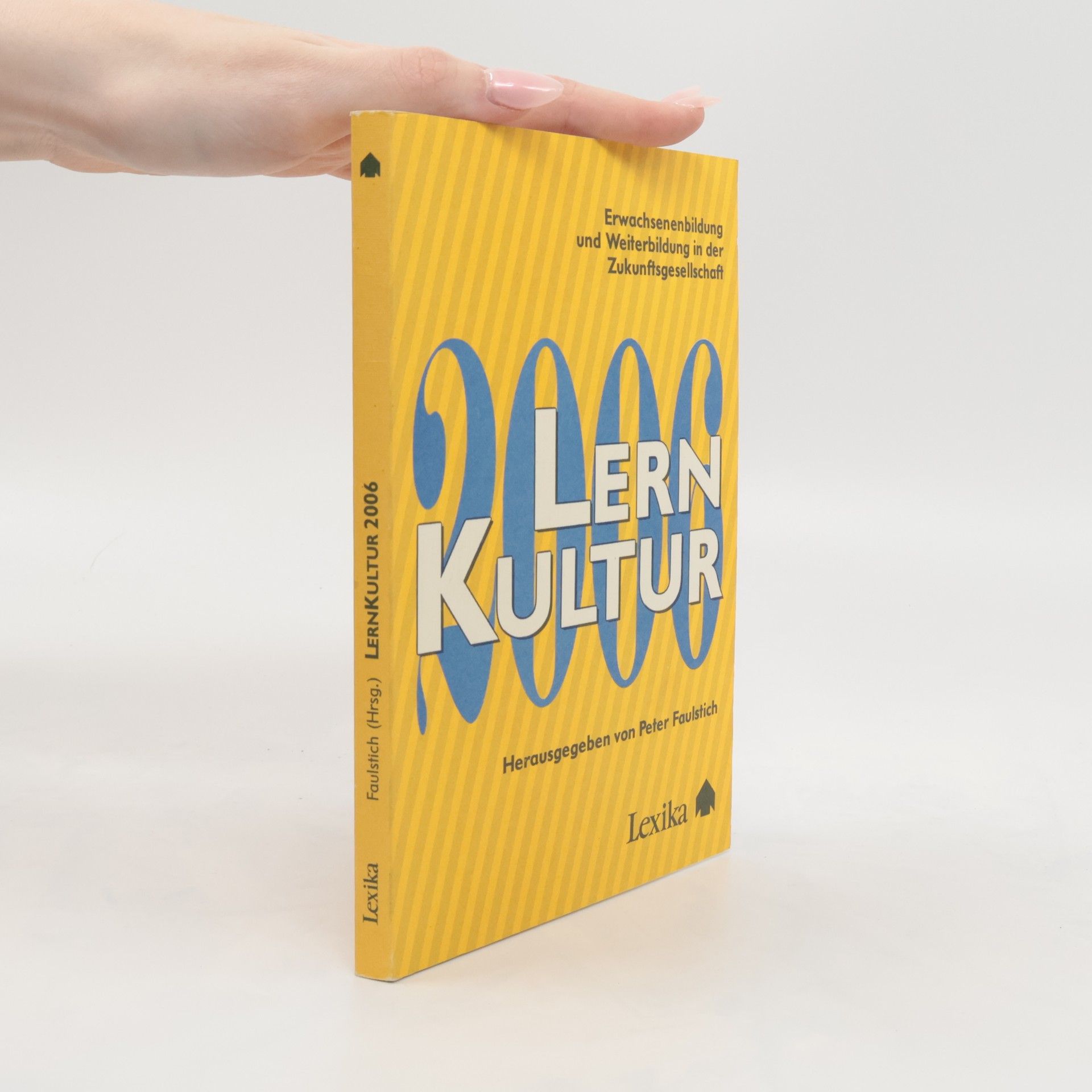

- 2010
- 2007
Die Diätmentalität wird durch ein ganzheitliches Lebens- und Ernährungskonzept herausgefordert, das Körper, Geist und Seele in Einklang bringt. Der Autor ermutigt dazu, ein normales Essverhalten ohne Selbstkasteiung und Schuldgefühle zu entwickeln. Ziel ist es, übergewichtigen Personen zu helfen, ihr individuelles Wohlfühlgewicht zu erreichen, das nicht den Erwartungen anderer entspricht, sondern dem eigenen körperlichen und seelischen Wohlbefinden dient. Langfristiger Erfolg erfordert die Identifikation und Veränderung der Ursachen für Gewichtsprobleme, was eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit und den individuellen Gefühlen erfordert. Erfolgreiches Abnehmen bedeutet, persönliche Wünsche und Bedürfnisse ernst zu nehmen sowie Lebensfreude und ein positives Lebensgefühl zu entwickeln. Eine bewusste Ernährung ist der Schlüssel zu einer guten Figur, gesundem Aussehen und körperlicher sowie geistiger Fitness. Um dies zu erreichen, wurde eine „Stoffwechselaktive Vollwertkost“ entwickelt, die nicht nur für Übergewichtige, sondern für alle, die aktiv an ihrer Gesundheit arbeiten möchten, geeignet ist. Essen soll wieder Spaß machen, und der kreative Umgang mit Lebensmitteln wird gefördert, um das Essen als etwas Positives zu empfinden und mit allen Sinnen zu genießen.
- 2003
Weiterbildung ist inzwischen ein bedeutender, wachsender und anscheinend selbstverständlicher Lernbereich. Das Werk liefert eine theoretische Grundlegung „lebenslangen Lernens“.
- 1998
Strategien der betrieblichen Weiterbildung
Kompetenz und Organisation
- 1990