Endlich wagt wieder einmal eine Frau, Kinder- und Jugendliteraturgeschichte zu schreiben! G. Mattenklott untersucht die in den Westzonen und der Bundesrepublik seit 1945 erschienene Kinder- und Jugendliteratur und berücksichtigt dabei auch einflußreiche, stilbildende Übersetzungen.§"Niemand hat bisher so viele Titel dieses Zeitraumes berücksichtigt, niemand die in den letzten Jahren errungenen theoretischen Positionen so geschickt in eine historische Übersicht eingebaut." (ekz-Informationsdienst)§"Wer sich mit Kinderbüchern der vergangenen vier Jahrzehnte sowohl unter dem Aspekt der Kindheitsvorstellungen als auch des literarischen Werkes beschäftigen möchte, findet in Gundel Mattenklotts Untersuchung reichlich und detaillierte Information." (Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel)
Gundel Mattenklott Livres
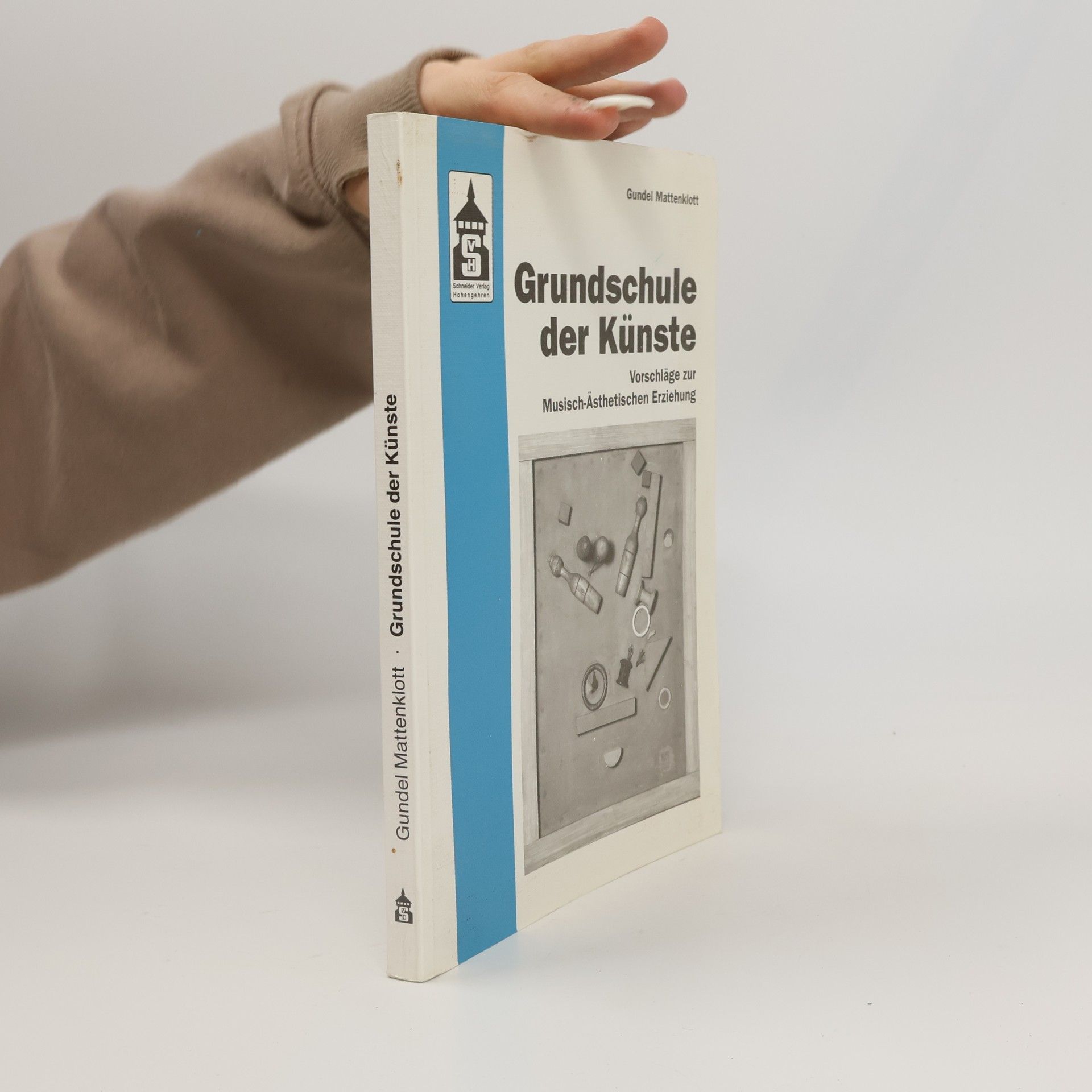
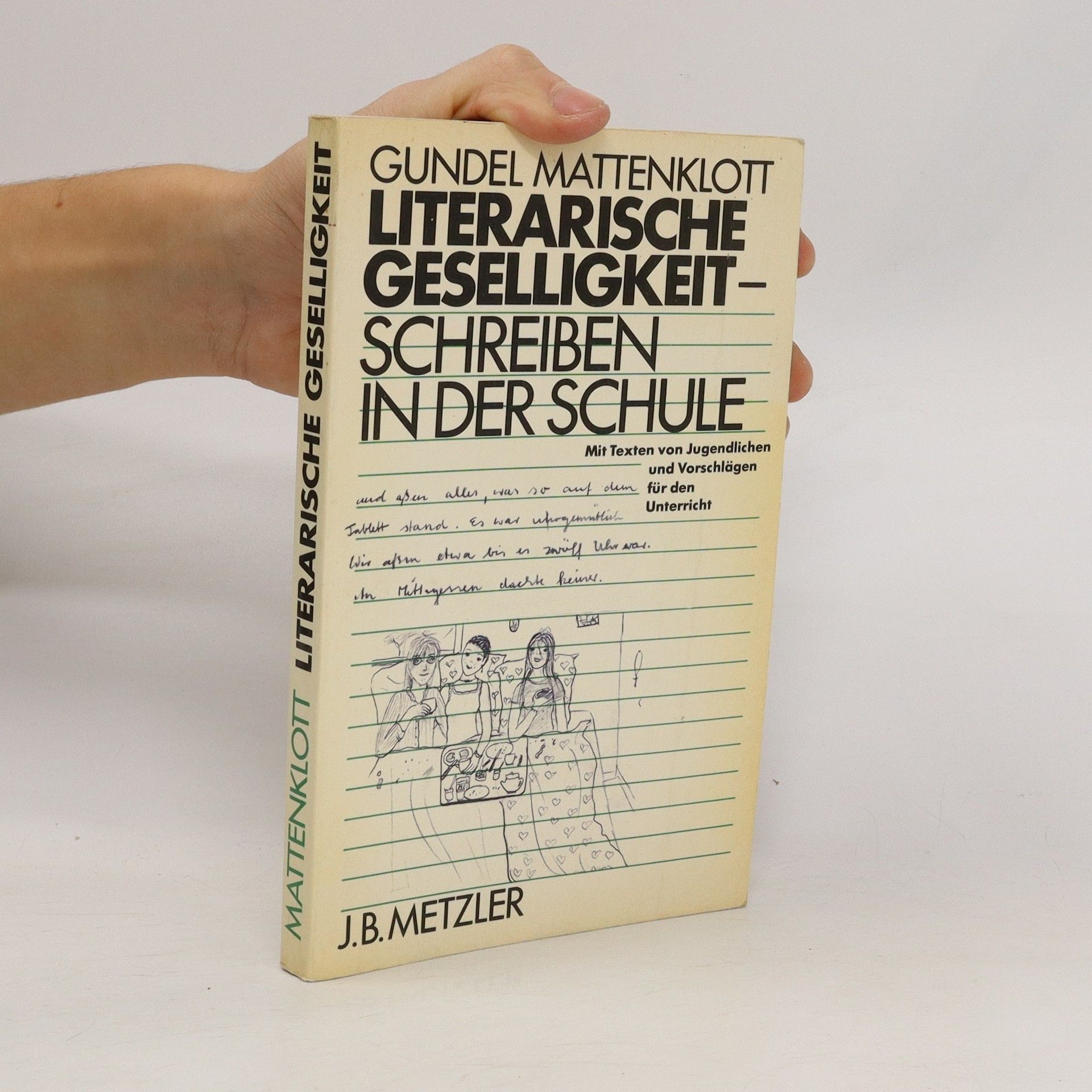


Arbeit an der Einbildungskraft, 1. Band: Perspektiven
Praxis Musisch-Ästhetischer Erziehung
Grundschule der Künste
- 179pages
- 7 heures de lecture