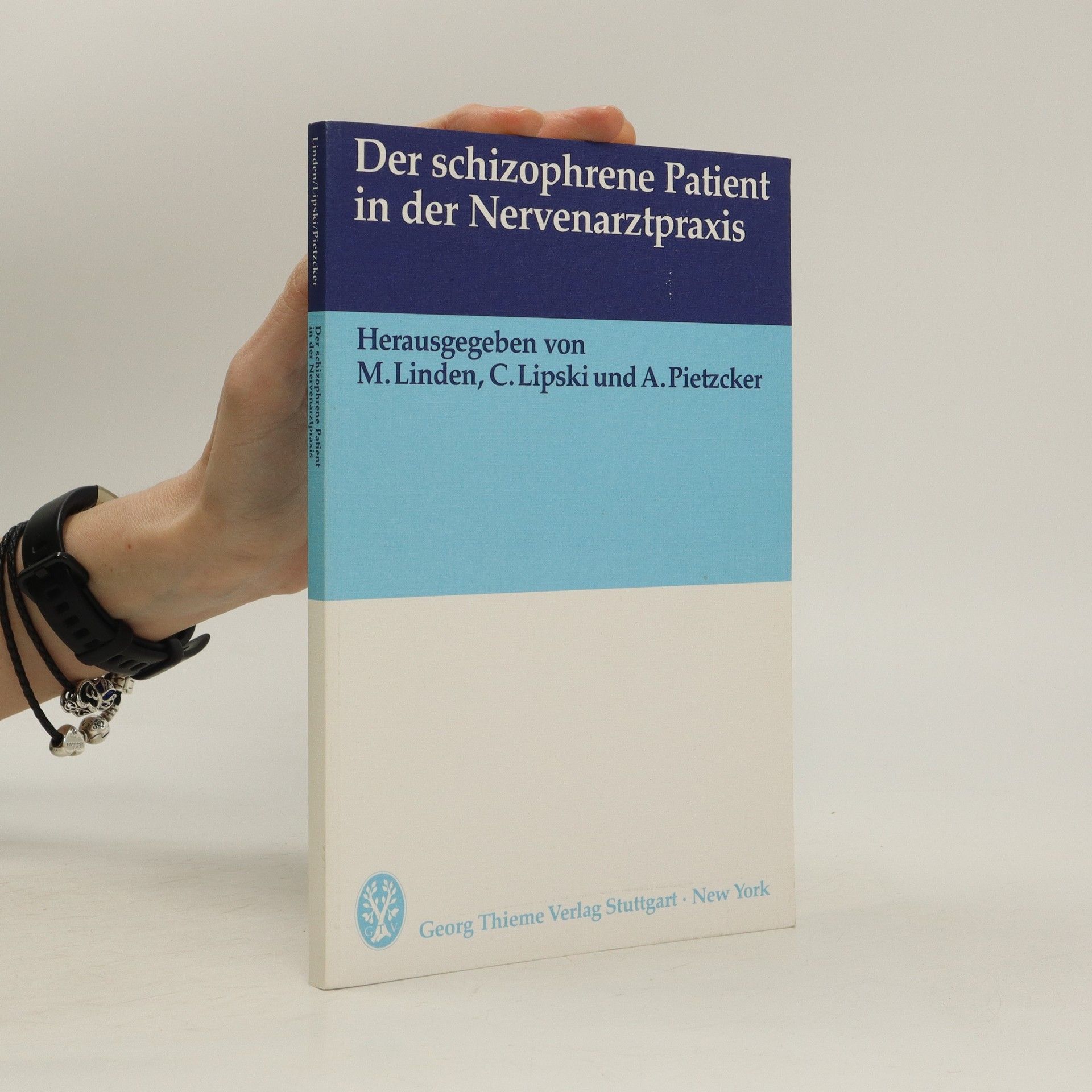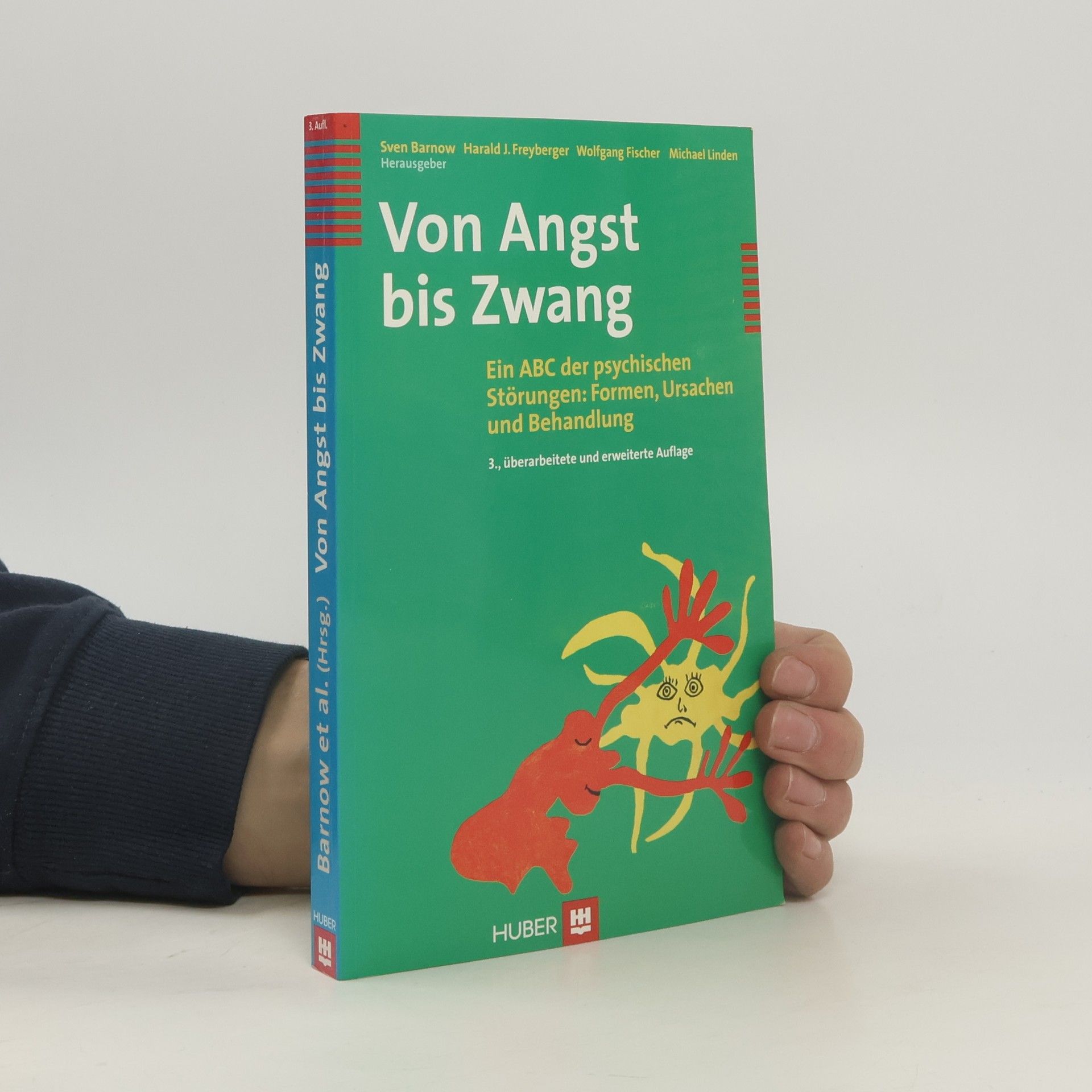Feelings of embitterment and posttraumatic embitterment disorder are prevalent in society, often stemming from injustices, humiliation, and breaches of trust. These emotions can cause significant suffering for both the affected individuals and those around them, even when clients appear otherwise stable. The aggressive tendencies and reluctance to seek help among this group pose challenges for practitioners, complicating treatment efforts. This practical, evidence-based guide offers models for understanding and diagnosing embitterment disorder, alongside state-of-the-art treatment approaches such as cognitive behavior therapy integrated with wisdom strategies. It emphasizes teaching clients to process their feelings of hurt and humiliation, fostering reconciliation with the events that triggered their distress. The guide is rich with practice-oriented tips to assist clients in achieving closure and reorienting towards the future, including methods for reevaluating critical events and their impacts. Wisdom therapy is highlighted, featuring various tools illustrated through numerous case vignettes. Additionally, the author addresses social, medical, and legal considerations related to the disorder, including work incapacity and criminal responsibility. For further support, clients can refer to the accompanying resource, which offers strategies for overcoming embitterment through wisdom.
Michael Linden Livres

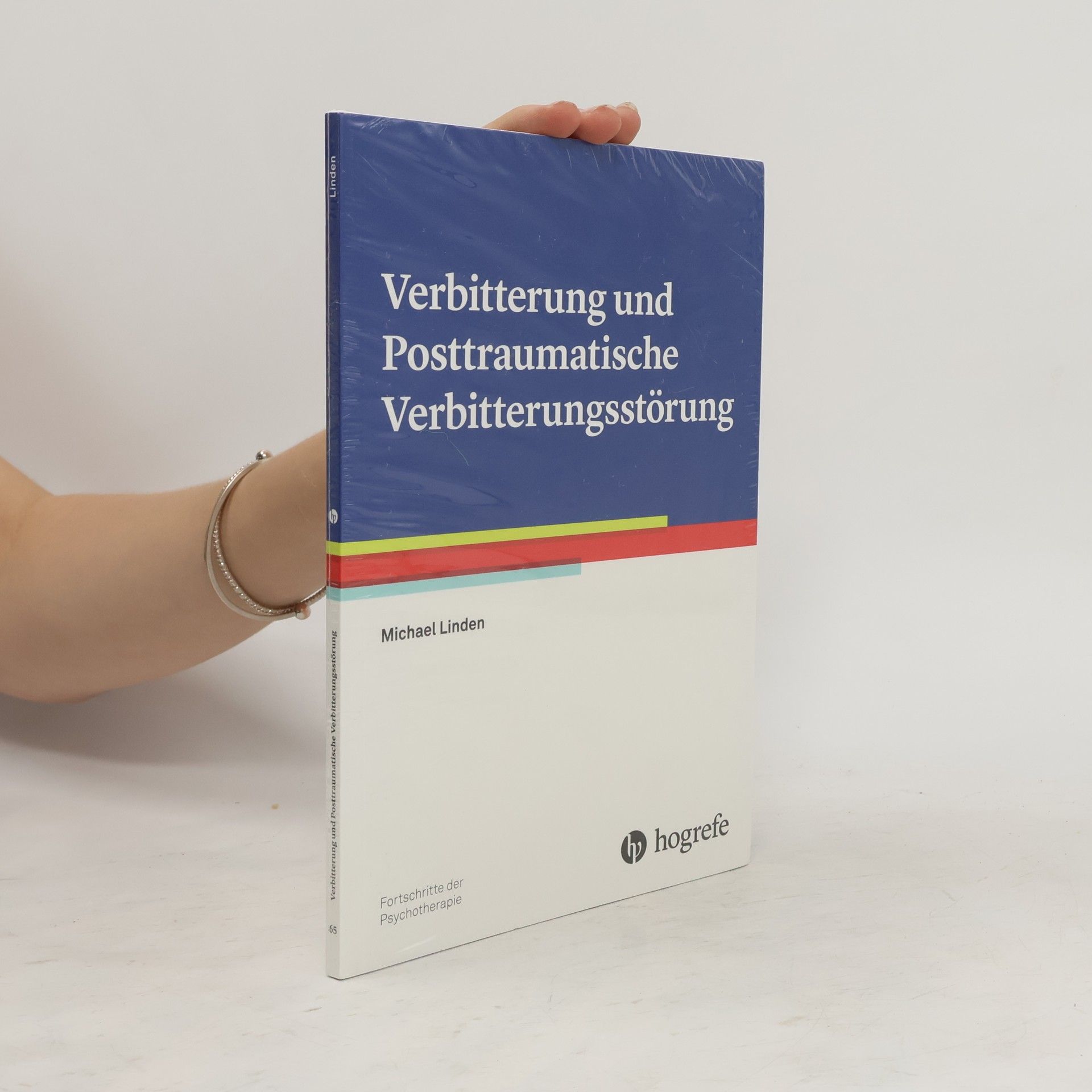




Psychosomatik in der Hausarztpraxis
- 132pages
- 5 heures de lecture
Hausarztpraxen sind oft die erste Anlaufstelle für Patienten, die sowohl somatische als auch psychische Erkrankungen haben. Das Buch beschreibt Szenen, die in der täglichen Praxis häufig vorkommen. Es werden Fälle präsentiert, in denen Patienten in der Hausarztpraxis vorgestellt, analysiert und behandelt werden. Von speziellen Fällen wird auf allgemeine Muster geschlossen, wobei Informationen zu Diagnose und Therapie bereitgestellt werden. Neben Routinefällen werden wichtige Aspekte der Notfallintervention, Krankschreibung und Überweisungen an Fachärzte für Psychotherapie behandelt. Anhand von 25 konkreten Fällen, wie Patienten mit Bauchschmerzen oder aggressiven und ängstlichen Verhaltensweisen, lernen Sie, psychosomatische Störungen besser einzuschätzen und zu erkennen, wann eine Überweisung an psychiatrische oder psychotherapeutische Praxen notwendig ist. Das Buch richtet sich an Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung in der Inneren Medizin und Allgemeinmedizin sowie an Fachärztinnen und Fachärzte in diesen Bereichen. Es bietet wertvolle Einblicke in Beziehungstypen und Interaktionsprobleme sowie psychische und somatische Probleme, die in der Hausarztpraxis auftreten können.
Fähigkeitsbeeinträchtigungen bei psychischen Erkrankungen
Diagnostik, Therapie und sozialmedizinische Beurteilung in Anlehnung an das Mini-ICF-APP
Verbitterungszustände, insbesondere die Posttraumatische Verbitterungsstörung, treten häufig auf. Sie führen zu erheblichem Leid für die Betroffenen und ihre Umwelt und sind u. a. aufgrund der Aggressivität der Betroffenen und der Zurückweisung von Hilfe schwer zu behandeln. Das Buch beschreibt die Störung und stellt Modelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Verbitterungszuständen vor. Praxisorientiert wird die Behandlung der Verbitterungsstörung mit Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie, insbesondere mithilfe von Weisheitsstrategien, dargestellt. Patienten erlernen dabei Strategien, die innere Kränkung zu verarbeiten, um so die Voraussetzung für eine innerliche „Aussöhnung“ mit den verbitterungsauslösenden Ereignissen und Verursachern zu schaffen. Es geht darum, aktiv mit der Vergangenheit abzuschließen, um eine Neuorientierung in die Zukunft zu ermöglichen. Ein Weg, dies zu erreichen, ist eine Um- bzw. Neubewertung des kritischen Ereignisses und seiner Folgen. Die Weisheitstherapie stellt dafür verschiedene Methoden zur Verfügung, die anhand zahlreicher Beispiele beschrieben werden. Abschließend geht der Band auf sozialmedizinische sowie auf juristische Aspekte ein, z. B. auf Fragen der Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit und der Schuldfähigkeit.
Das gilt auch für die Psychotherapie. Nicht nur die Wirkung der Therapie selbst, sondern ebenso die Interaktion zwischen Therapeut und Patient, das Verhalten des Therapeuten oder das Setting bergen Risiken für beide Seiten.Ausgehend von einer grundlegenden Definition, Klassifikation und den empirischen Befunden zu Psychotherapienebenwirkungen werden die wesentlichen Risiken verschiedener Psychotherapieverfahren und -formen dargestellt. Das Thema wird aus der Perspektive des Therapeuten wie auch des Patienten abgehandelt, die beide Nebenwirkungen erleiden können. Es werden konkrete Strategien zur Vorbeugung und Reduktion von Risiken und Nebenwirkungen gegeben. Das Buch wendet sich an Wissenschaftler sowie Praktiker und will zu einer offenen und sachlichen Diskussion des Themas beitragen.
Verhaltenstherapie
- 456pages
- 16 heures de lecture
Strikt Verhaltenstherapie-orientiert, bietet das erfolgreiche Nachschlagewerk => Lernenden einen profunden Überblick über Einzelverfahren und Methoden der Verhaltenstherapie, über deren Einsatzmöglichkeiten sowie allgemeine Grundlagen psychotherapeutischen Arbeitens; => Praktikern gezieltes Nachschlagen der Methoden, Indikationen, Kontraindikationen und der Durchführung; => vorgebildeten Lesern verständliche Informationen über Möglichkeiten der verhaltenstherapeutischen Psychotherapie.
Der schizophrene Patient in der Nervenarztpraxis
- 139pages
- 5 heures de lecture
Von Angst bis Zwang
Ein ABC der psychischen Störungen: Formen, Ursachen und Behandlung - 3., überarbeitete und erweiterte Auflage
- 298pages
- 11 heures de lecture
Das Buch gibt einen komprimierten Überblick über die einzelnen Symptome. Es eignet sich für alle, 'die sich gezielt fundierte Informationen über einzelne Störungsbilder aneignen möchten'. Psychologie Heute Ein psychisch Erkrankter bekommt durchschnittlich erst nach sieben Jahren die Chance der "richtigen" (psychotherapeutischen und/oder psychopharmakologischen) Behandlung. Das mag auch daran liegen, dass es kaum Übersichtsbücher gibt, die Symptome, Ursachen und Behandlung psychischer Störungen allgemeinverständlich beschreiben. Die Autoren dieses Buches wollen diese Lücke schließen. Sie informieren klar und übersichtlich - aber immer auf dem Niveau des heute gesicherten Wissens. In der dritten Auflage wurden sämtliche Beiträge aktualisiert und überarbeitet. Ein Kapitel zu psychischen Problemen im Alter mit Schwerpunkt Demenz wurde hinzugefügt, was von vielen Lesern gewünscht wurde.
Ärztliche Gesprächsführung
Ein Leitfaden für die Praxis