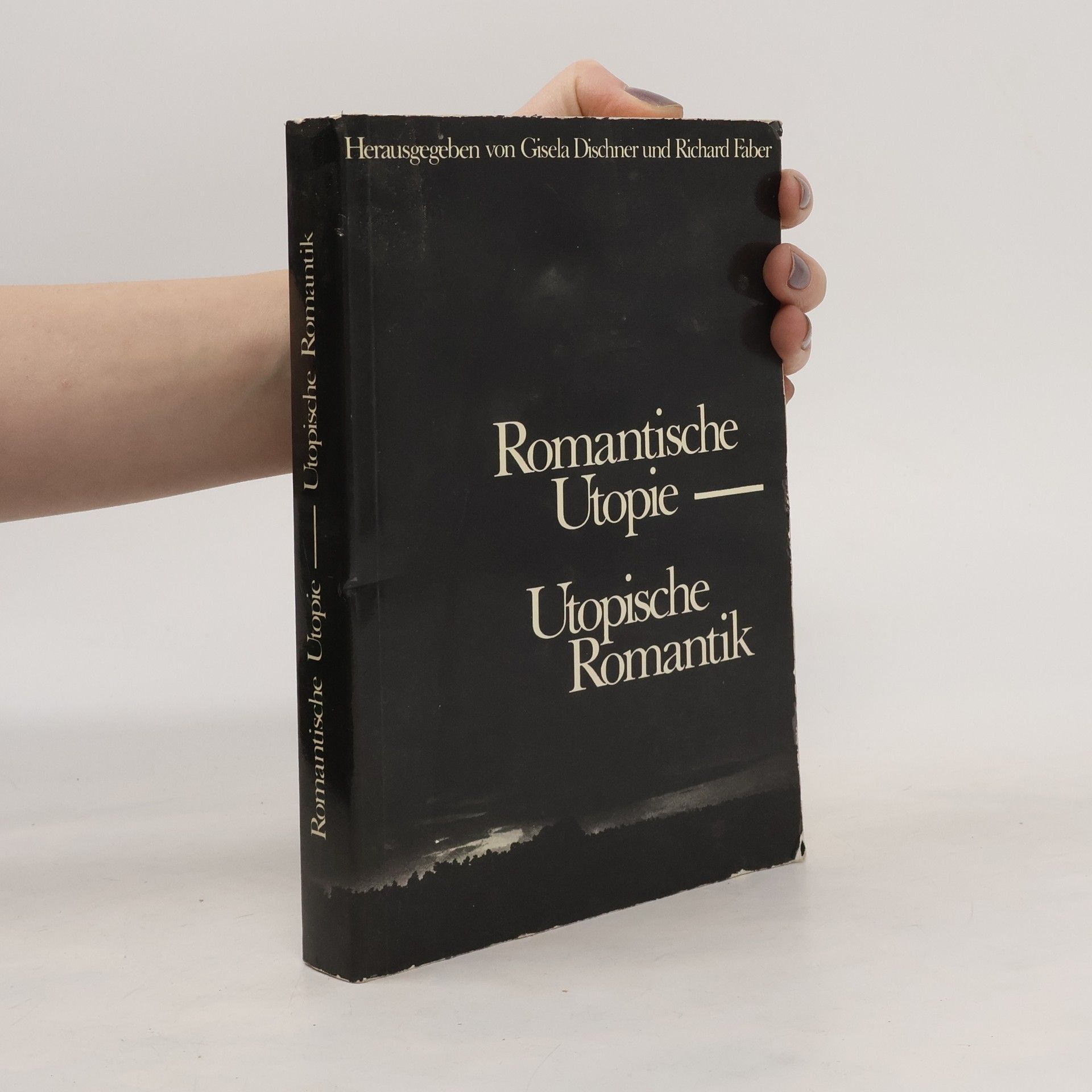Komm. u. zus.gest. aus Briefromanen und Dokumenten v. Dischner, Gisela. Mit Abb. N.-A.
Gisela Dischner Livres
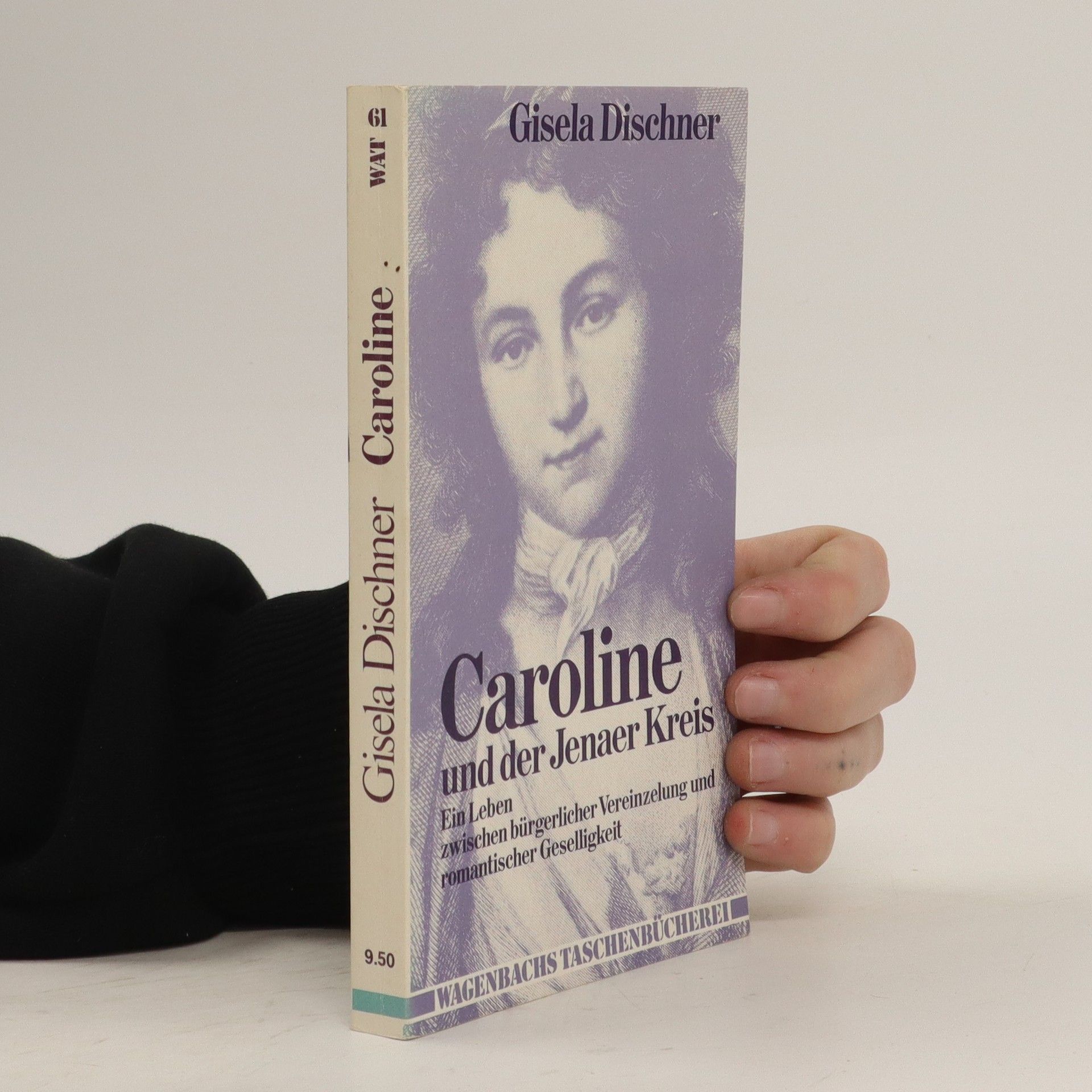
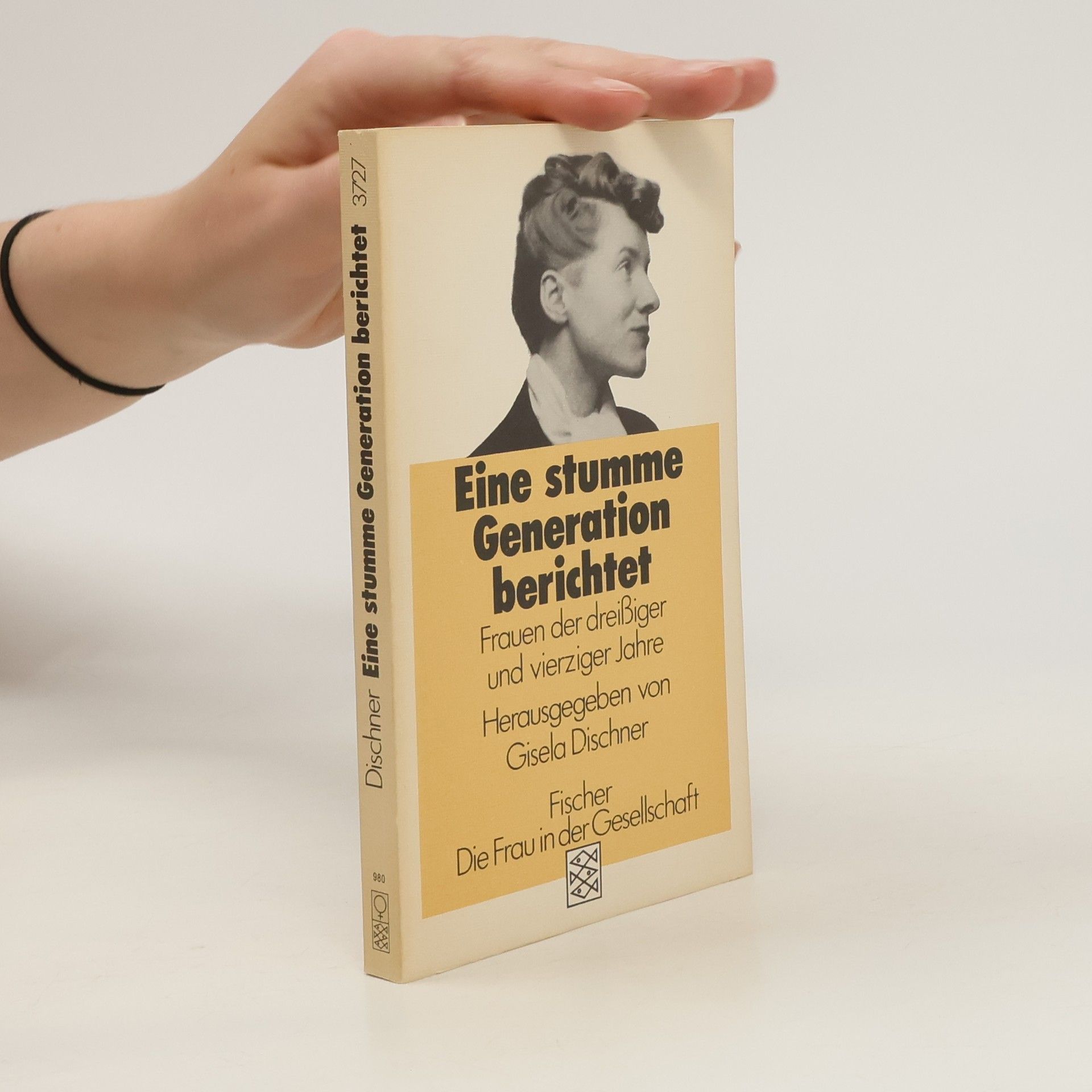
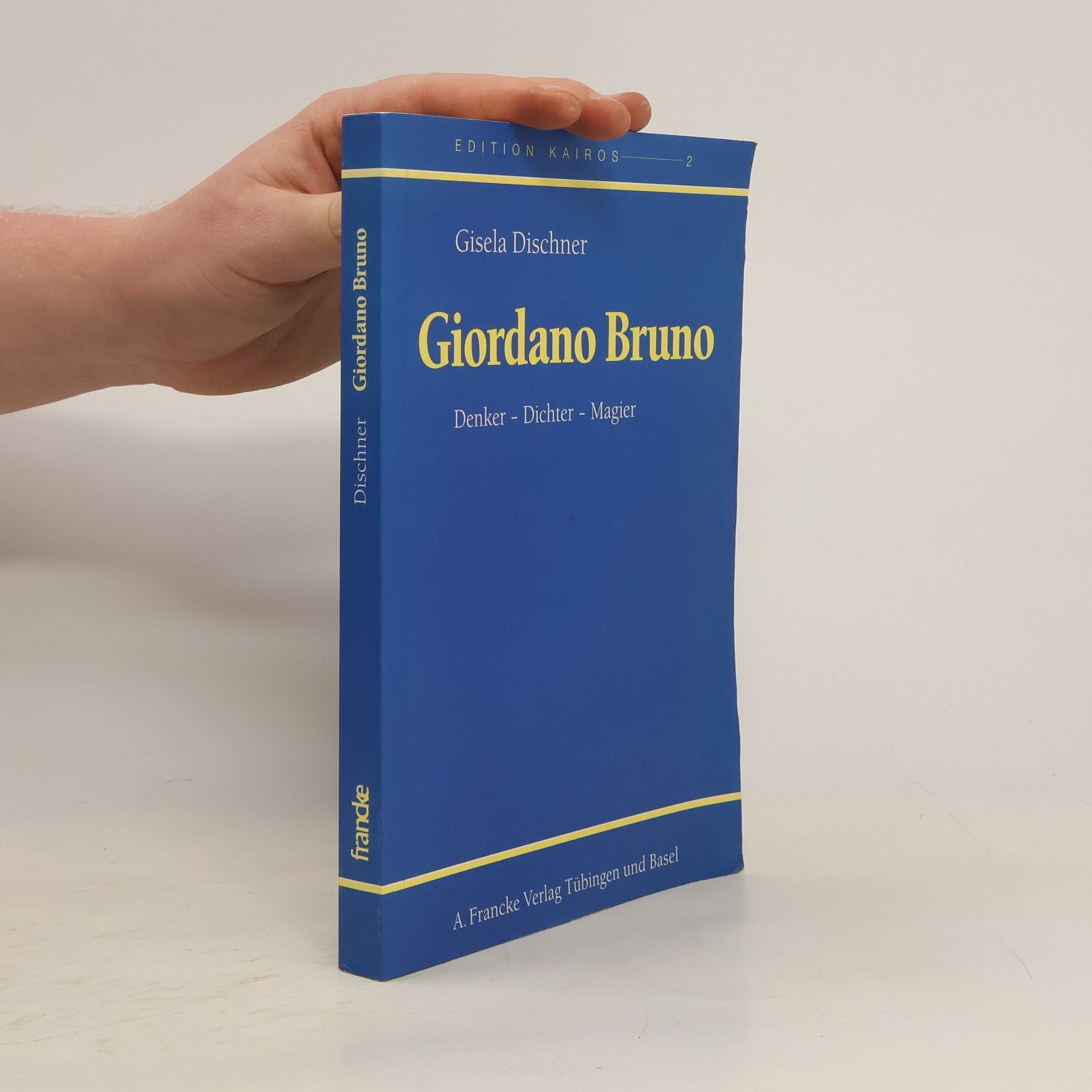
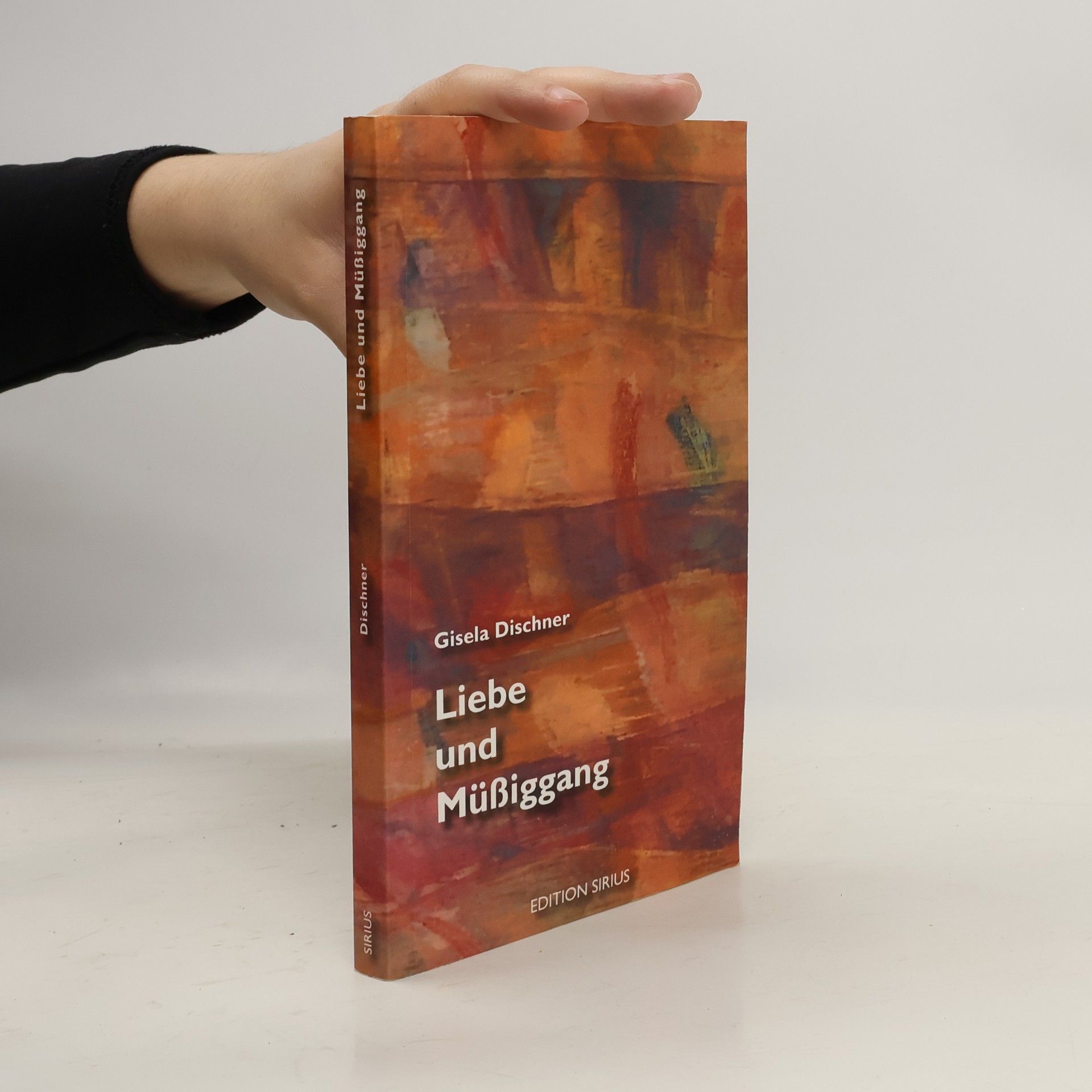
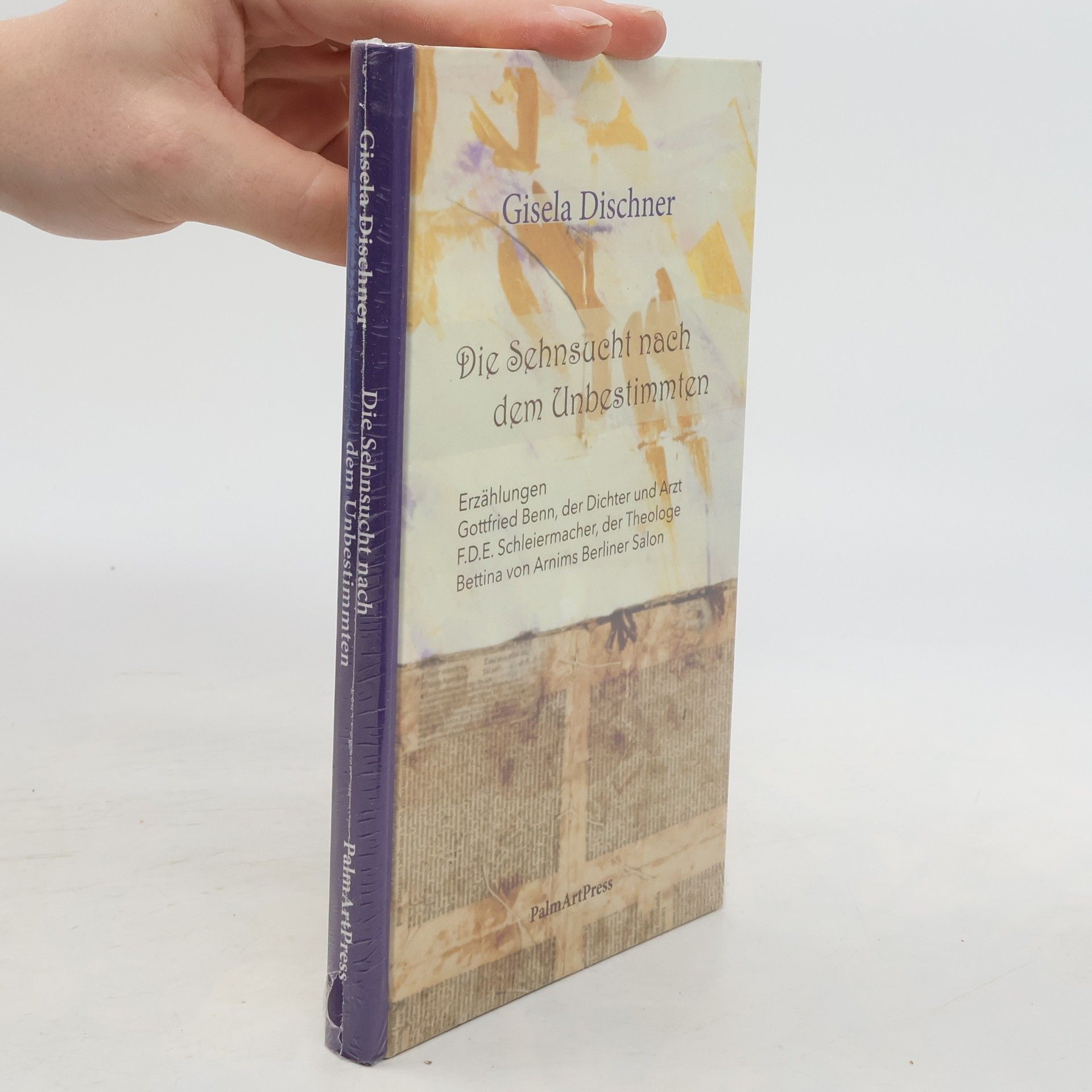
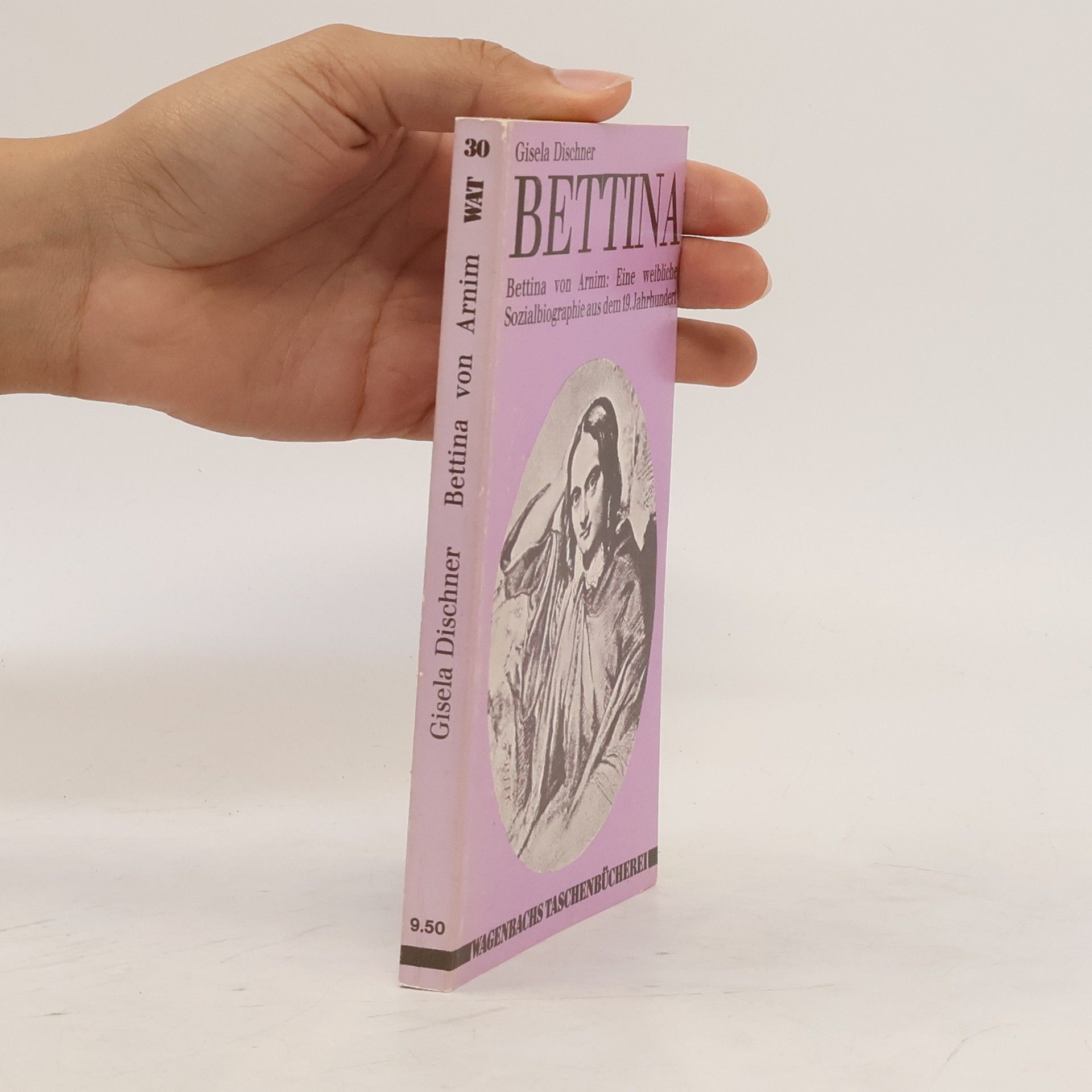
Die Erzählung über Gottfried Benn und seine dritte Ehefrau Ilse spielt in der russischen Besatzungszone 1949. Ilse, ebenfalls Ärztin an der Charité, schildert die katastrophalen Zustände im Krankenhaus, wo viele hungernde Menschen, vor allem Frauen, Kinder und alte Menschen, täglich sterben. Die Ärzte sind überfordert, ebenso wie Benn, der zum ersten Mal eine eigene Praxis hat und arme Patienten oft kostenlos behandelt. Die Autorin beschreibt das Nachkriegsberlin aus einer individuellen Perspektive, die in bisherigen Berichten nicht thematisiert wurde. Die Geschichte über Friedrich Schleiermacher, den berühmten Sprachphilosophen, basiert auf wahren Begebenheiten. Seine Aussage „Kein Denken ohne Sprache“ kritisiert sozial-darwinistische Ansätze. Die Erzählung beginnt mit seiner Sonntagspredigt, in der er die Brutalität der Berliner Polizei anprangert, die friedliche Demonstranten erschoss. Er fordert den Berliner Senat auf, die Autonomie der Universität gesetzlich zu garantieren und sie als Freie Universität zu benennen. Bettina von Arnims Salon von 1831 wird als kritische Kleinöffentlichkeit beschrieben, in der Bürger, einschließlich der Polizei, willkommen waren. Hier trafen sich berühmte Dichter, um ihre Werke vorzustellen und über ästhetische sowie politische Themen zu diskutieren. Bettinas Engagement für die Kunstautonomie und ihr Eintreten für den Weberaufstand verdeutlichen ihren Mut, auch wenn sie gezwungen war, ihre
Liebe und Müßiggang
- 162pages
- 6 heures de lecture
Das viel zu lange verdrängte Thema Müßiggang wird endlich wieder intensiv diskutiert. Immer mehr Menschen entdecken den Müßiggang als eine wesentliche Bedingung alles Schöpferischen. Gisela Dischners These, daß der Müßiggang auch Voraussetzung für Liebesfähigkeit ist, läßt sich weit zurückverfolgen. Von der Antike über die Renaissance bis hin zur Gegenwart werden Liebe und Müßiggang in Philosophie und Literatur immer wieder als konstitutiv zusammengehörig betrachtet. Gisela Dischner macht auf aktuelle Anzeichen eines Paradigmenwechsels vom homo oeconomicus zum homo aestheticus aufmerksam, der durch das Wissen um den Zusammenhang von Müßiggang und Liebe verstärkt und beschleunigt werden könnte. Ihr neues Buch schließt an ihr „Wörterbuch des Müßiggängers“ (2. Aufl. 2009) an, dem die FAZ bescheinigte, es sei „eines der raren Bücher“, mit denen man „überall gut durchkommen“ könne.
Giordano Bruno ist in den letzten Jahren neu entdeckt worden. In dieser Studie wird sein Werk als untrennbare Einheit aus Naturphilosophie, Dichtung und Ansätzen einer modernen Anthropologie dargestellt. Die Offenheit seiner Texte lädt die Leser zum schöpferischen Nachvollzug ein.
Eine stumme Generation berichtet
- 223pages
- 8 heures de lecture
Romantische Utopie, utopische Romantik
- 358pages
- 13 heures de lecture