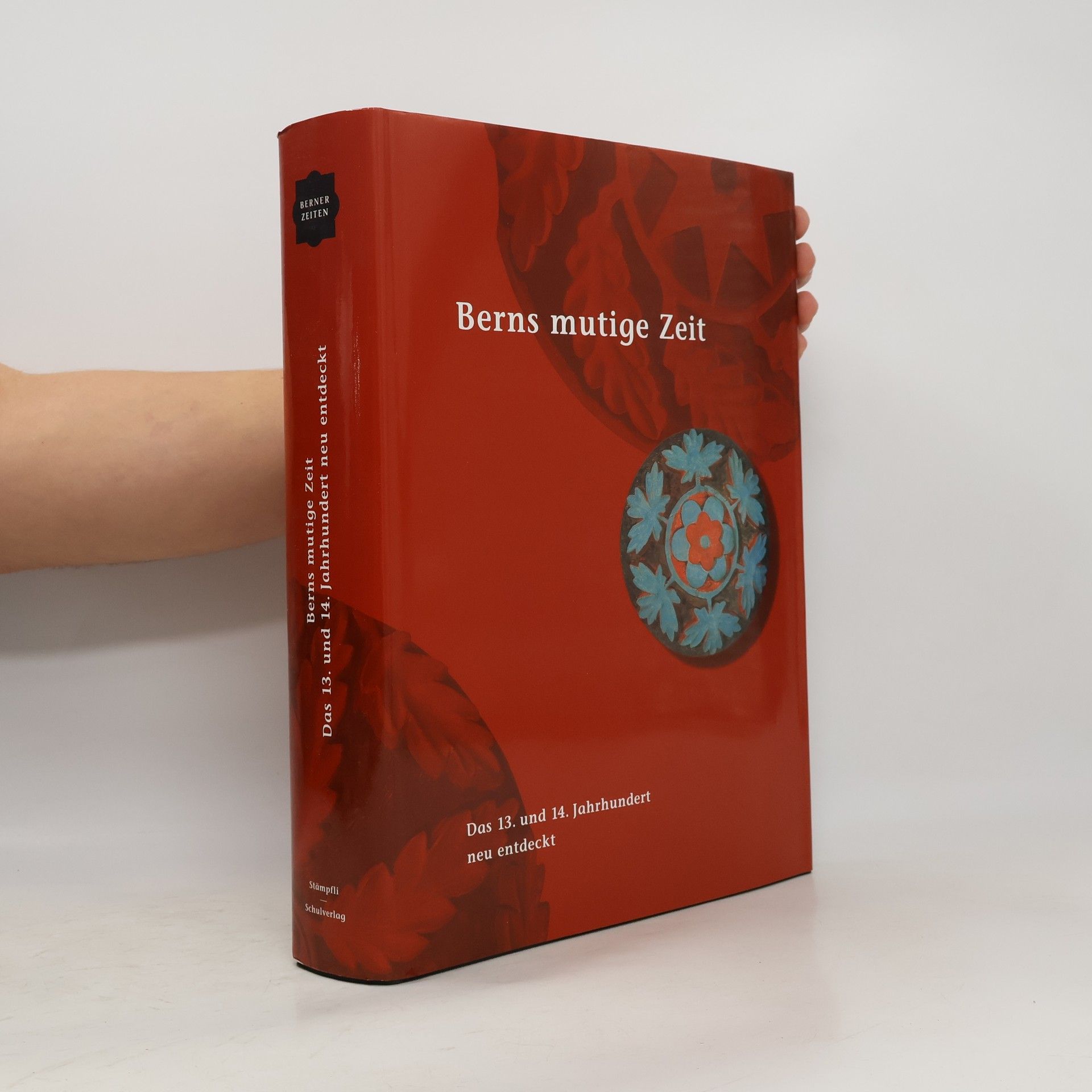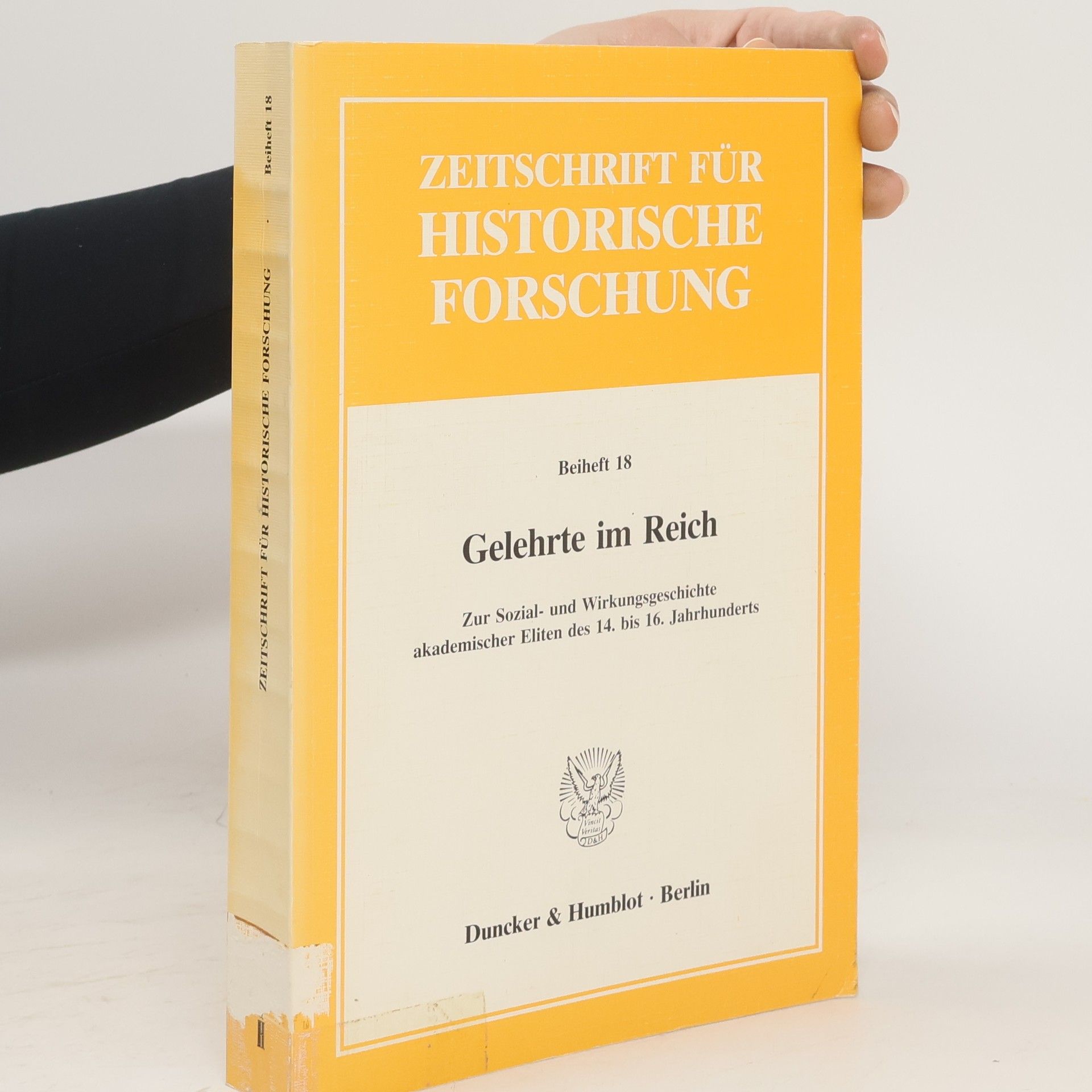Gelehrte im Reich
- 549pages
- 20 heures de lecture
Die Beiträge dieses Beiheftes beschäftigen sich mit der Frage, auf welche Weise und mit welchem Erfolg akademische Eliten des deutschen Spätmittelalters, vornehmlich gelehrte Juristen, Theologen, Mediziner und zum Teil auch Artisten - neben einer Fülle von nicht weniger wirksamen „Halbgelehrten“ - ihr Wissen und ihre Fertigkeiten in städtische und landesherrliche Verwaltungen, in Höfe, Gerichte, Kirchen, Universitäten und Schulen hineingetragen, angewendet und dabei selbst Karriere gemacht haben. An der Spitze der deutschen Universitätsbesucher gehörten diese Eliten auf einer vermutlich mittleren Führungsebene unterhalb des Adels und des Großbürgertums zu den wichtigsten Modernisierungsträgern in Reich und Territorien. Doch anders als in den vergleichsweise modernen Monarchien Frankreichs und Englands bedienten sich die führenden politischen Kräfte des Reiches des Angebots an Gelehrten und ihres Fachwissens bis weit ins 16. Jahrhundert in noch sehr ungleicher Weise.