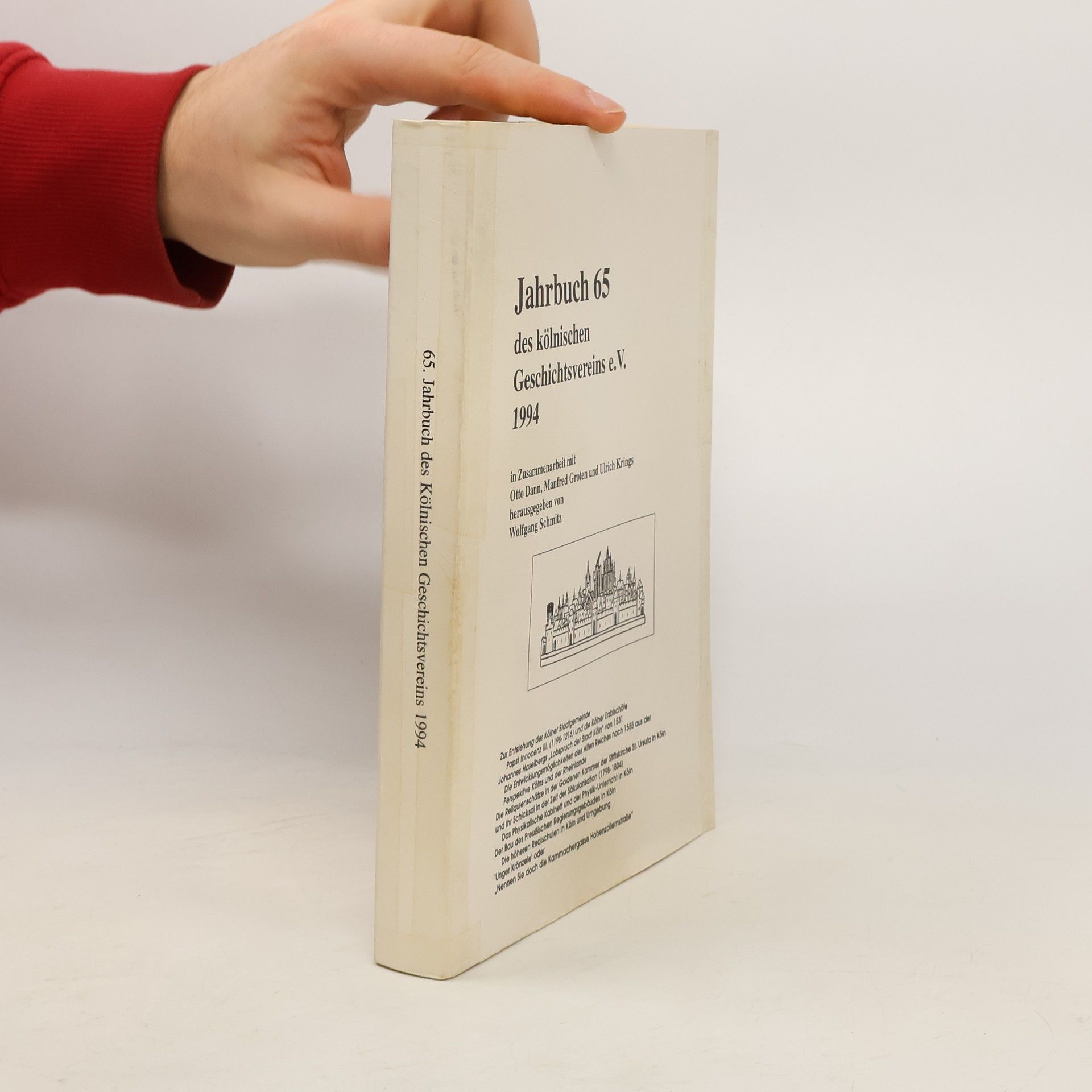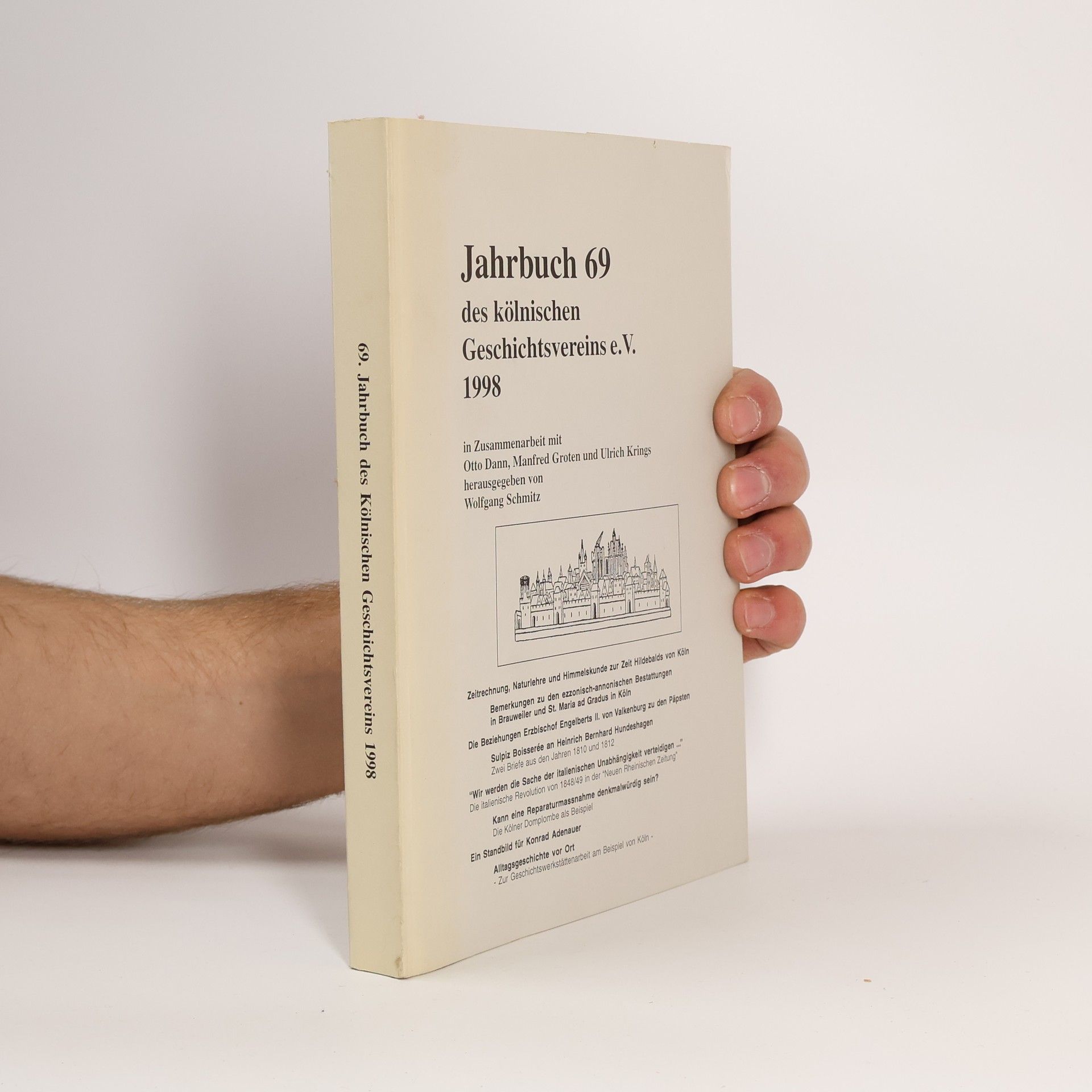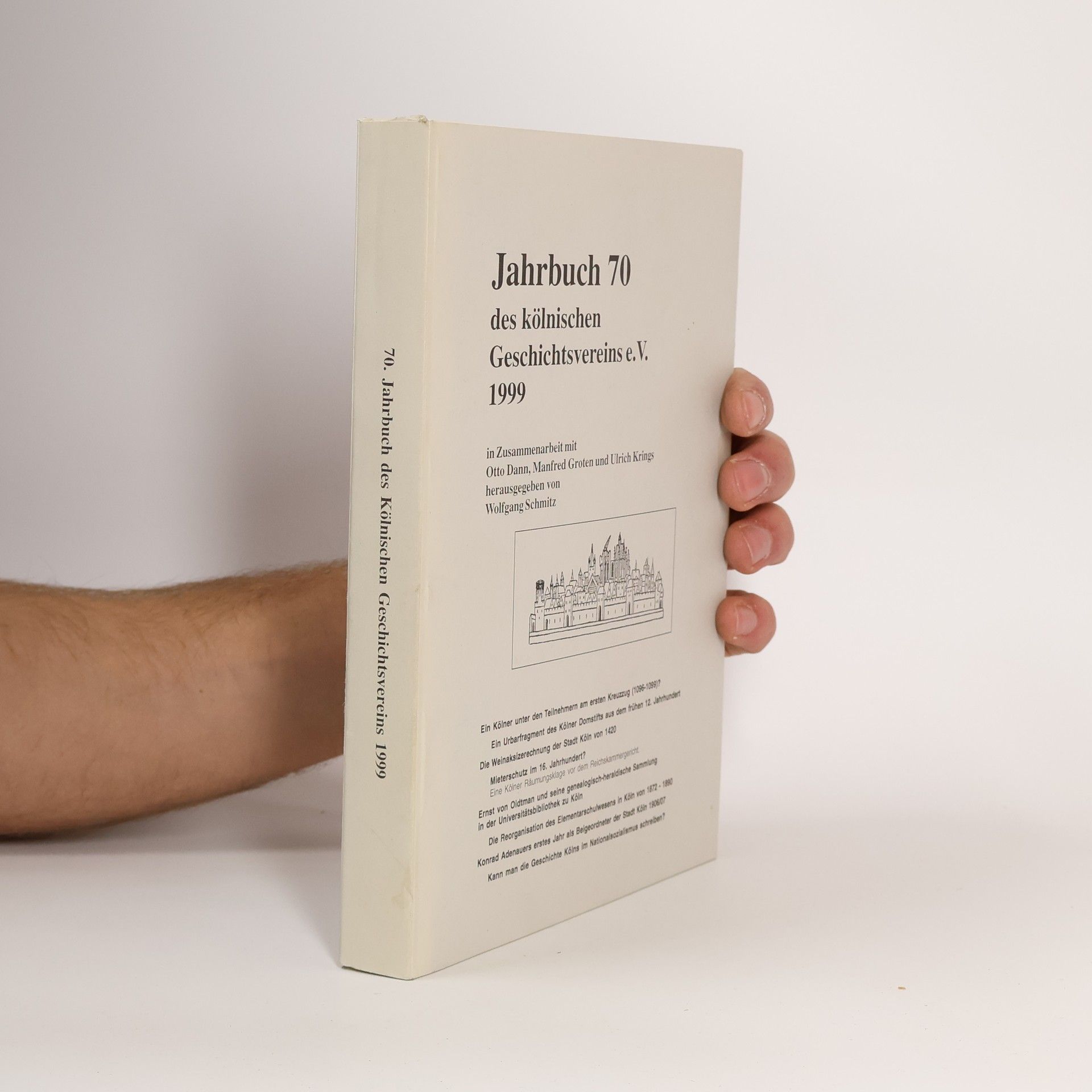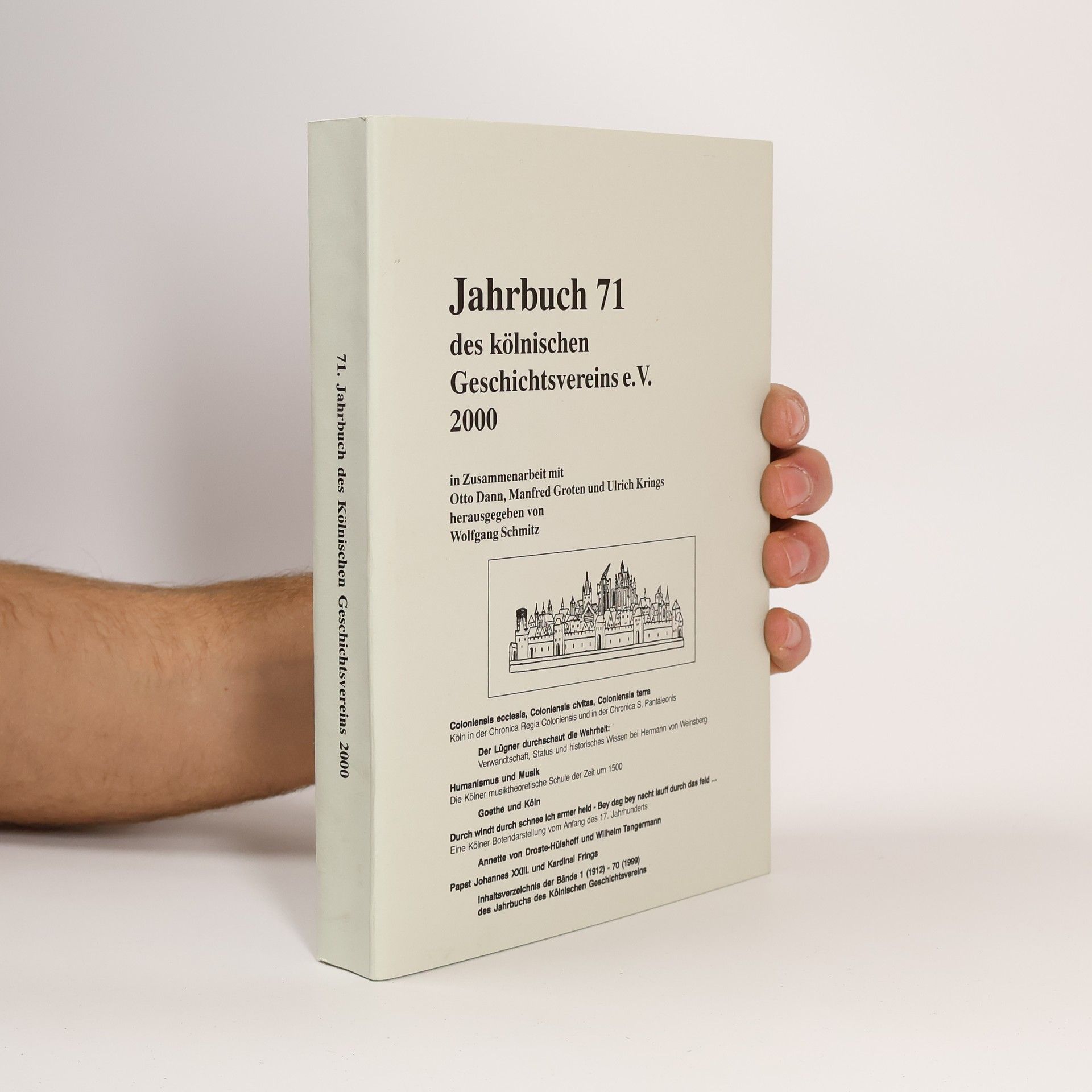Wer schneller liest, ist in der Schule klar im Vorteil!
Wolfgang Schmitz Livres
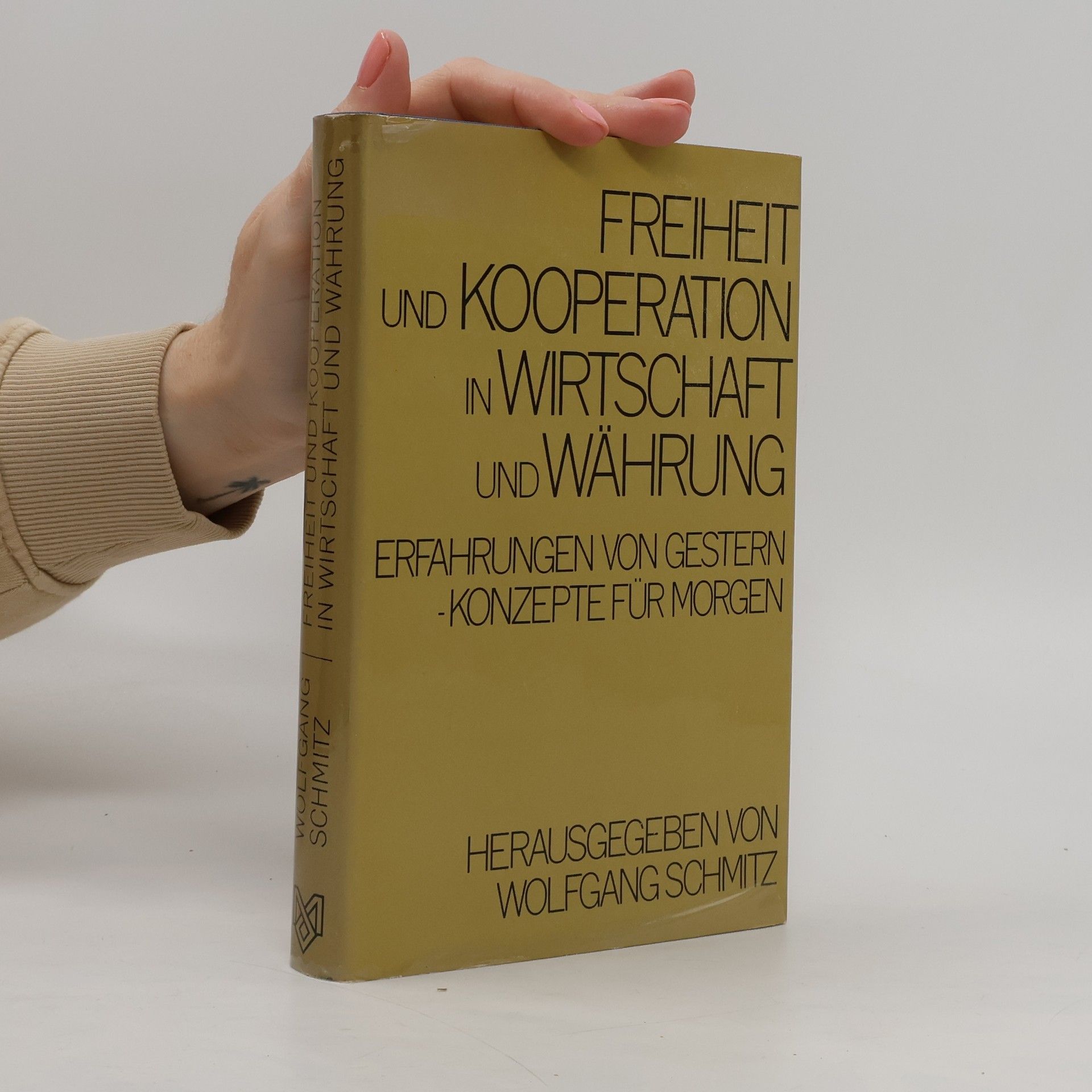

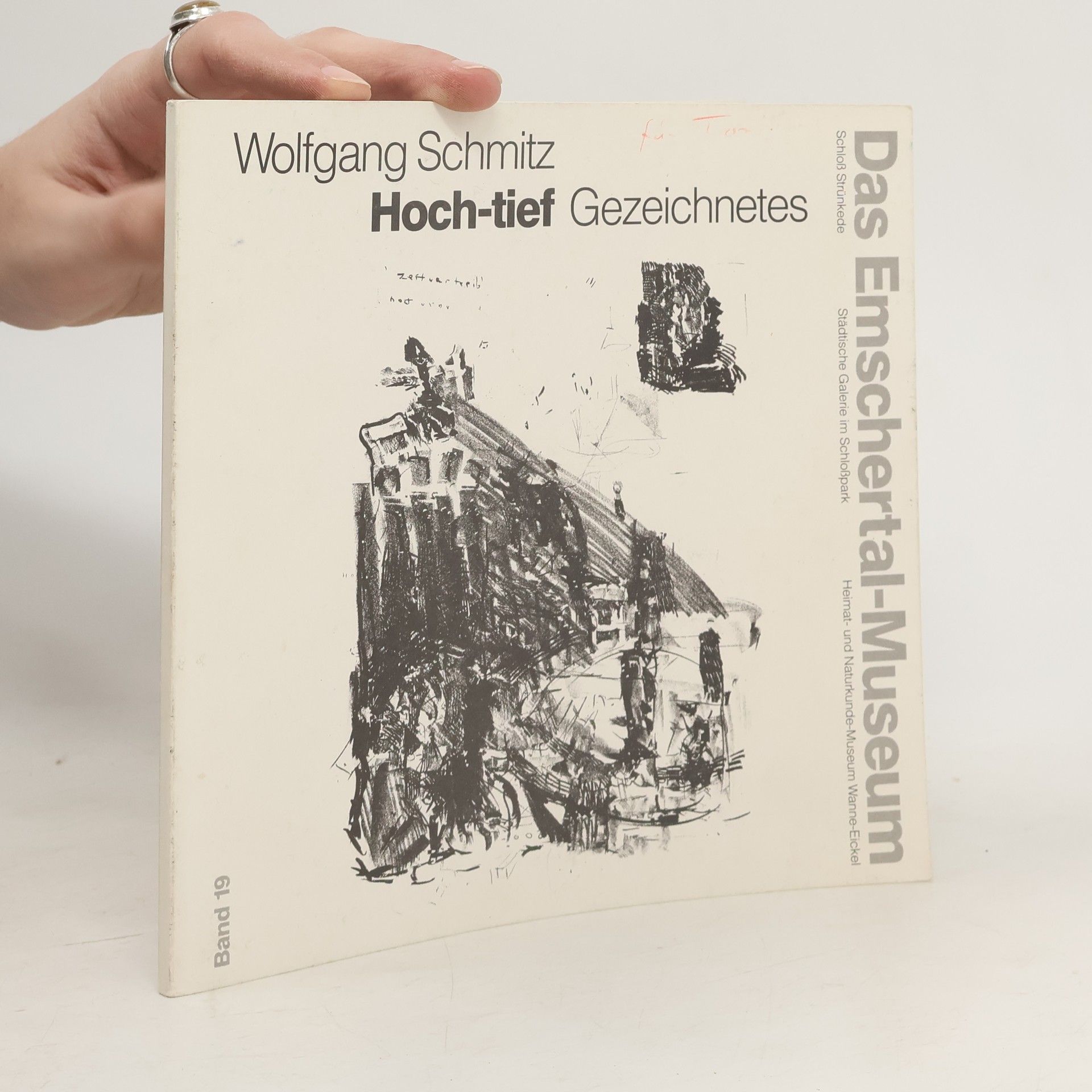


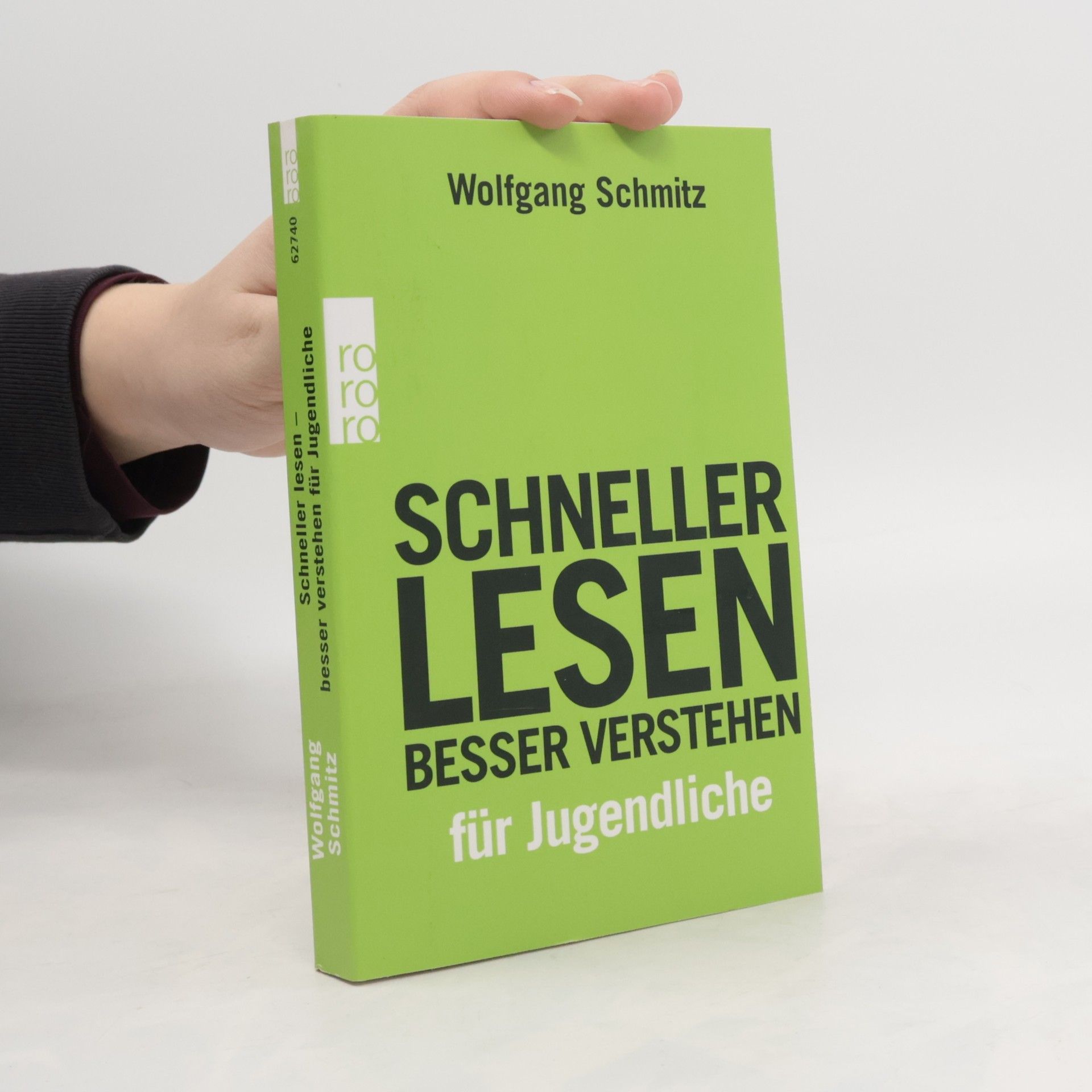
In fünf Schritten zum effizienten Lesen Zwei Stunden täglich liest man im Durchschnitt in deutschen Büros – und während des Studiums oft noch mehr. Ein Viertel dieser Zeit lässt sich gewinnen, wenn Sie effiziente Techniken einsetzen, mit denen Sie schneller ans Ziel gelangen und das Gelesene besser verarbeiten. Denn ein deutlich höheres Lesetempo ist möglich und fördert gleichzeitig Textverständnis, Merkfähigkeit und Konzentration. Diese überarbeitete Ausgabe des Bestsellers zur Lesetechnik bietet neue Verständnistests und Übungen (auch am PC!) sowie eine Aktualisierung der wissenschaftlichen Basis. Profitieren Sie vom erprobten Konzept der führenden Lesetrainer Deutschlands!
Geschichten aus der Wissenschaft
Eine Auswahl aus Pressmitteilungen der Universität Bremen 1974-1980
Grundriss der Inkunabelkunde
Das gedruckte Buch im Zeitalter des Medienwechsels
Leicht überarbeitet und mit aktualisiertem Literaturverzeichnis und erweitertem Register ist Wolfgang Schmitz‘ Standardwerk über die Frühgeschichte des Buchdrucks nun endlich als preiswerte Studienausgabe erhältlich. Der Buchdruck des 15. Jahrhunderts, Gutenbergs epochale Erfindung, repräsentiert sowohl den Ausklang des mittelalterlichen Schriftwesens wie den Aufstieg eines neuen technischen Mediums, des Leitmediums für Jahrhunderte. Wolfgang Schmitz stellt den Prozess als Emanzipation des Drucks von den handschriftlichen Vorbildern dar, die ungefähr und geographisch unterschiedlich um 1500 abgeschlossen war. Dabei zeigt sich die mittelalterliche Tradition noch in vielfältigen Formen und den handschriftlichen Ergänzungen. Durch sie trugen die sog. Wiegendrucke oder Inkunabeln mehr oder minder individuelle Züge. Die rasante technische Entwicklung tendierte aber schnell zum Fertigprodukt sowie zur Normierungen bei der Typographie. Um 1480 hatte der Buchdruck die Wissenschaft nahezu ganz erobert, ebenso weitgehend die volkssprachige Literatur, die kirchliche und staatliche Praxis und auch die Wirtschaft. Ein wichtiger Vorteil war dabei die Möglichkeit, zuverlässige identische Exemplare zu erhalten. Autoren erhielten damit ein ganz neues Maß an Kontrolle über ihre veröffentlichten Texte. Damit waren die Publikationsmittel bereitgestellt, die wenige Jahre später in der Reformation tragende Bedeutung erlangten.
Freiheit und Kooperation in Wirtschaft und Währung
- 239pages
- 9 heures de lecture
Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins Band 69.1998
- 222pages
- 8 heures de lecture
Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins Band 70.1999
- 270pages
- 10 heures de lecture
Jahrbuch 71 des Kölnischen Geschichtsvereins e.V. 2000
- 266pages
- 10 heures de lecture