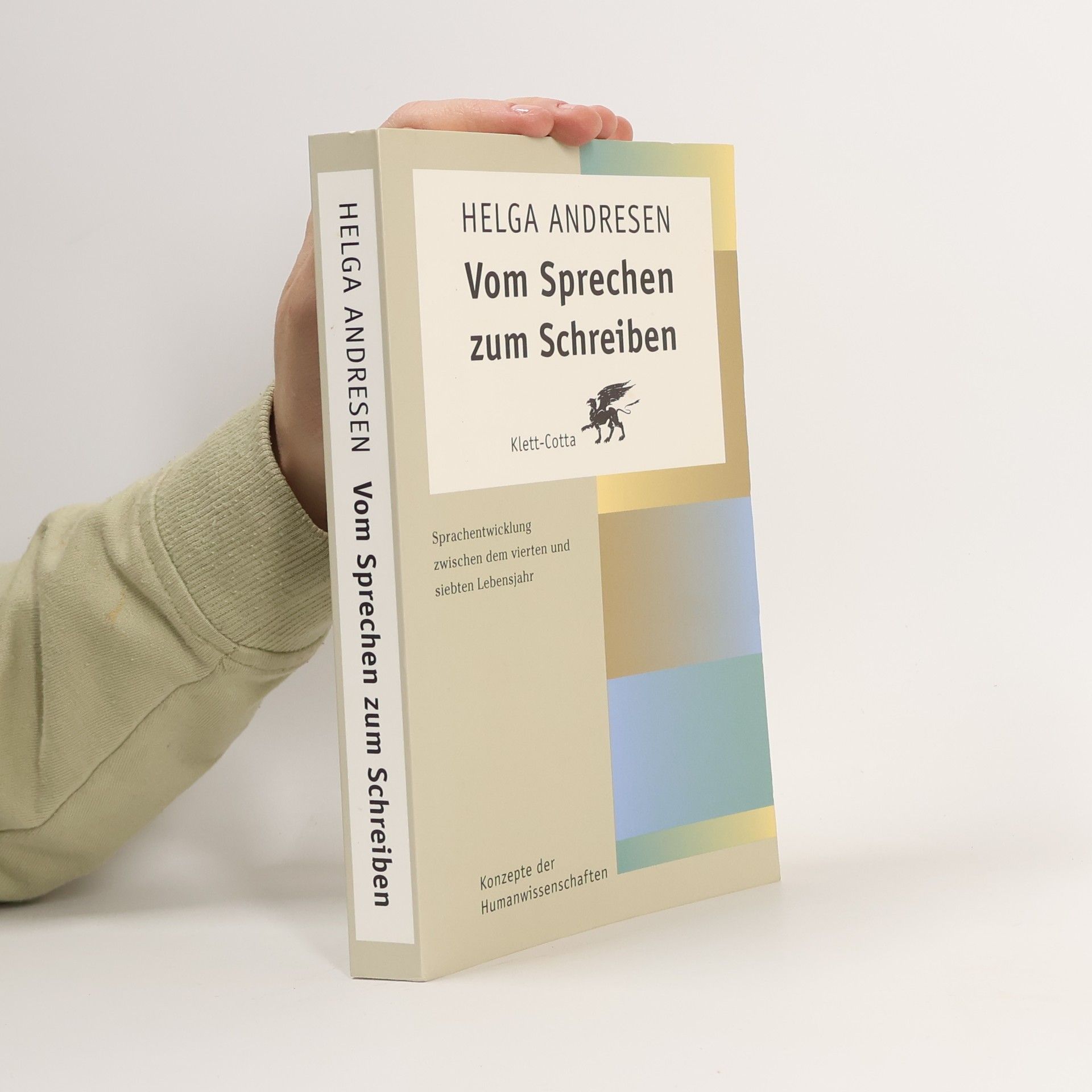Regionale Sprachenvielfalt
Standardisierung - Didaktisierung - Ästhetisierung
Kleine Sprachen, Dialekte, Standardsprachen – sprachliche Verhältnisse verändern sich in dynamischem Wechselspiel zwischen Tendenzen zur Vereinheitlichung und Standardisierung und Tendenzen zur Diversifizierung und Entstehung neuer Varietäten. Dominierten bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein Entwicklungen zur Zurückdrängung regionaler Varietäten zugunsten von Standard- bzw. Nationalsprachen, so sind seit einigen Jahrzehnten intensive Bemühungen zur Stärkung von Minderheiten- und Regionalsprachen zu verzeichnen. Die Sprachenvielfalt in der deutsch-dänischen Grenzregion bietet aufgrund historisch und gesellschaftlich bedingter Gemeinsamkeiten und Unterschiede ein reichhaltiges Spektrum für aktuelle linguistische, sprachpolitische und didaktische Fragestellungen. Die Beiträge des Bandes beschreiben und diskutieren Prozesse der Verdrängung und Revitalisierung, Verschriftlichung und Standardisierung sowie didaktische Konzepte im Spannungsfeld zwischen Muttersprach- und Fremdsprachunterricht am Beispiel von Friesisch, Niederdeutsch, Südjütisch, Standarddeutsch und Standarddänisch.