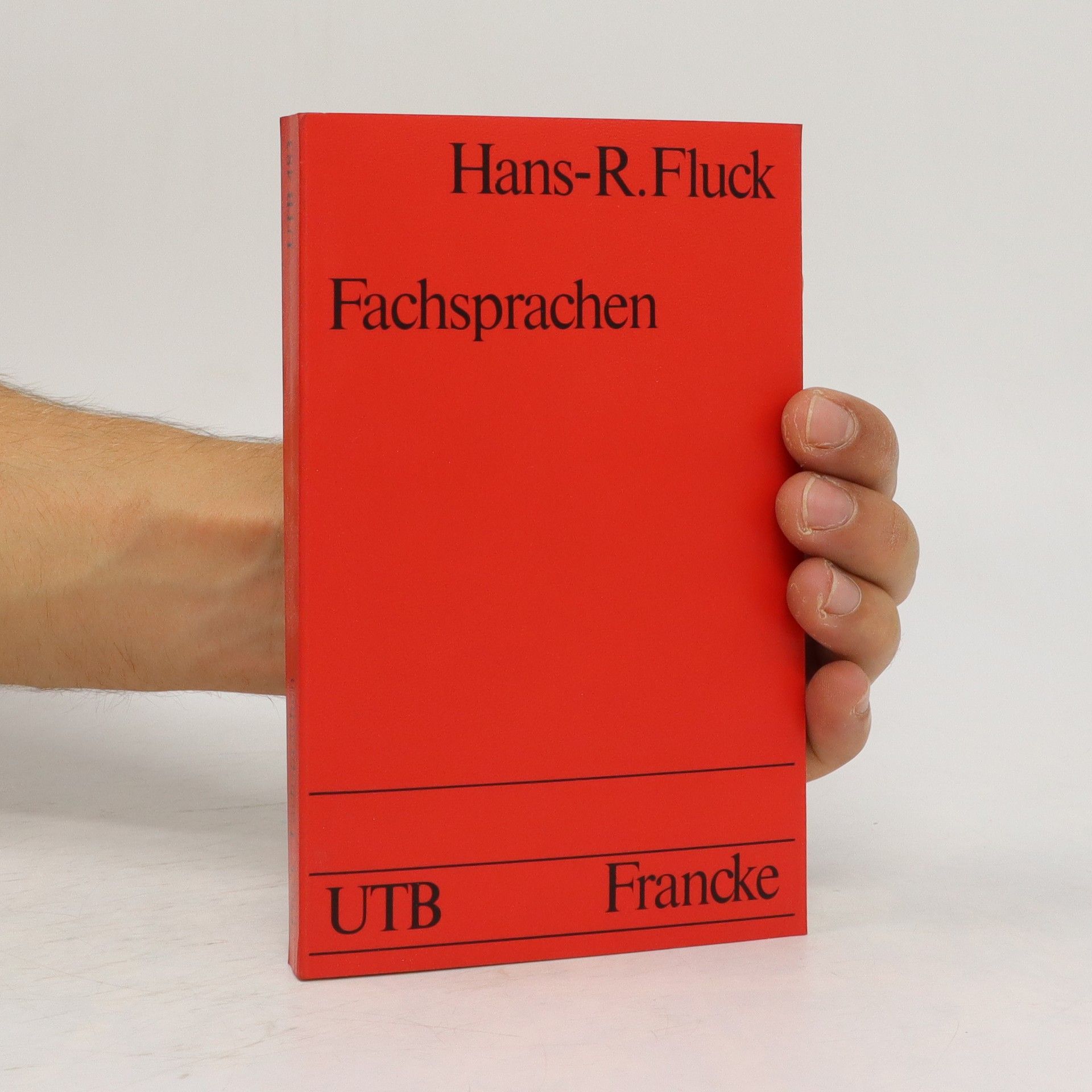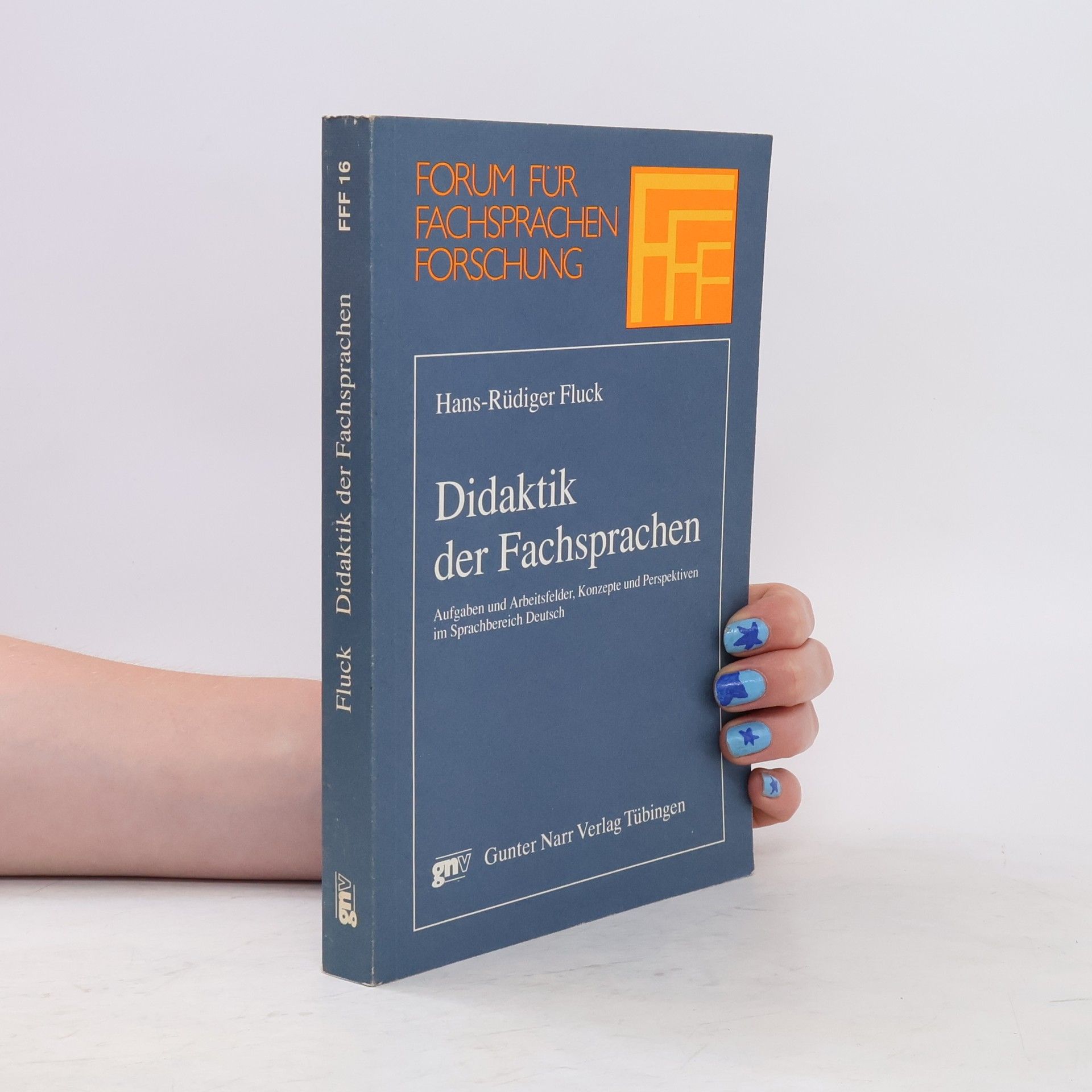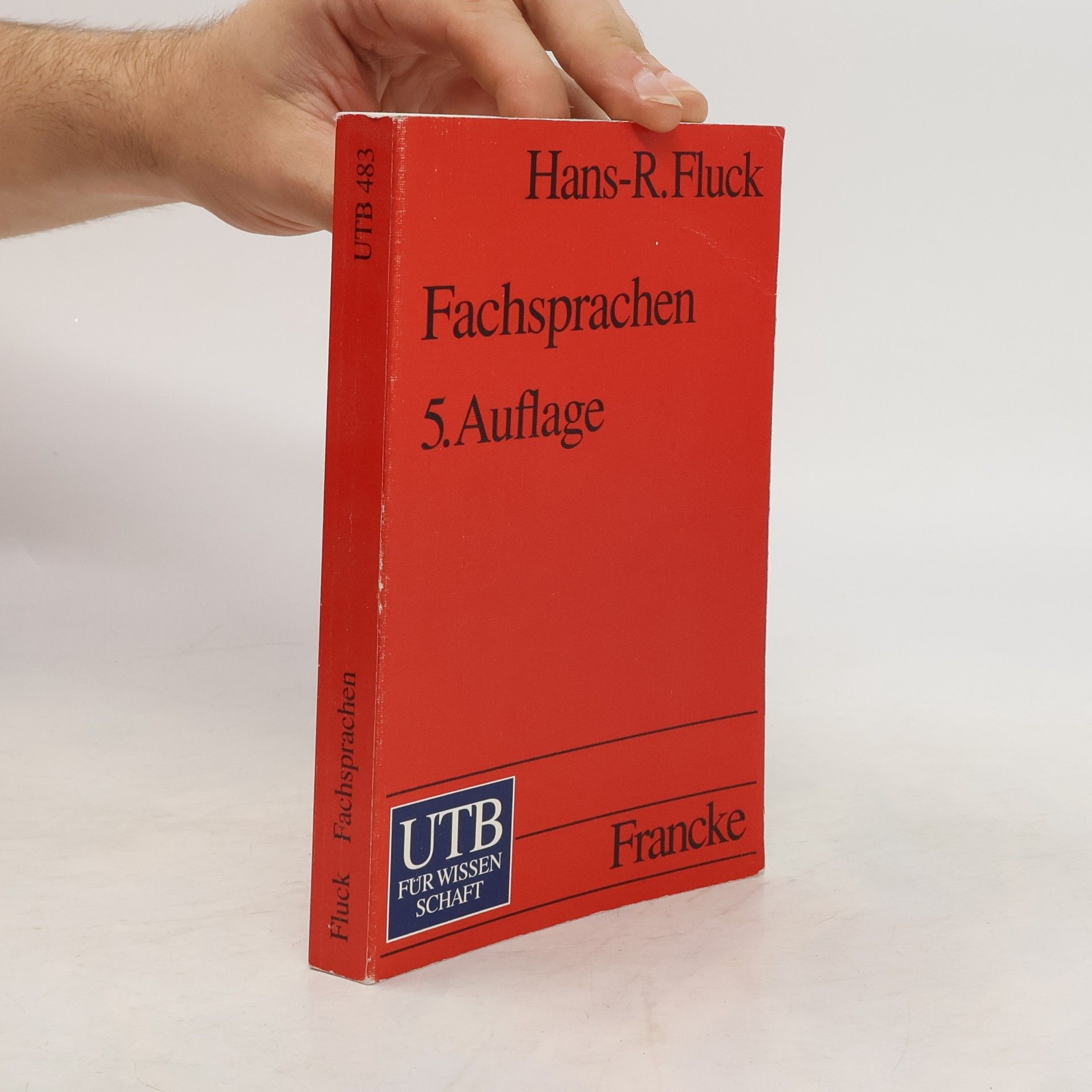Fachsprachen. Einführung und Bibliographie
- 293pages
- 11 heures de lecture
Das Buch bietet einen soziolinguistischen Überblick über Theorie und Praxis der Fachsprachen, erläutert deren Funktionen und gesellschaftliche Relevanz anhand zahlreicher Beispiele und behandelt zentrale Aspekte der Fachsprachenforschung der 90er Jahre sowie zukünftige Perspektiven. Eine umfangreiche Bibliographie und ein Gesamtregister sind enthalten.