Werner Besch Livres
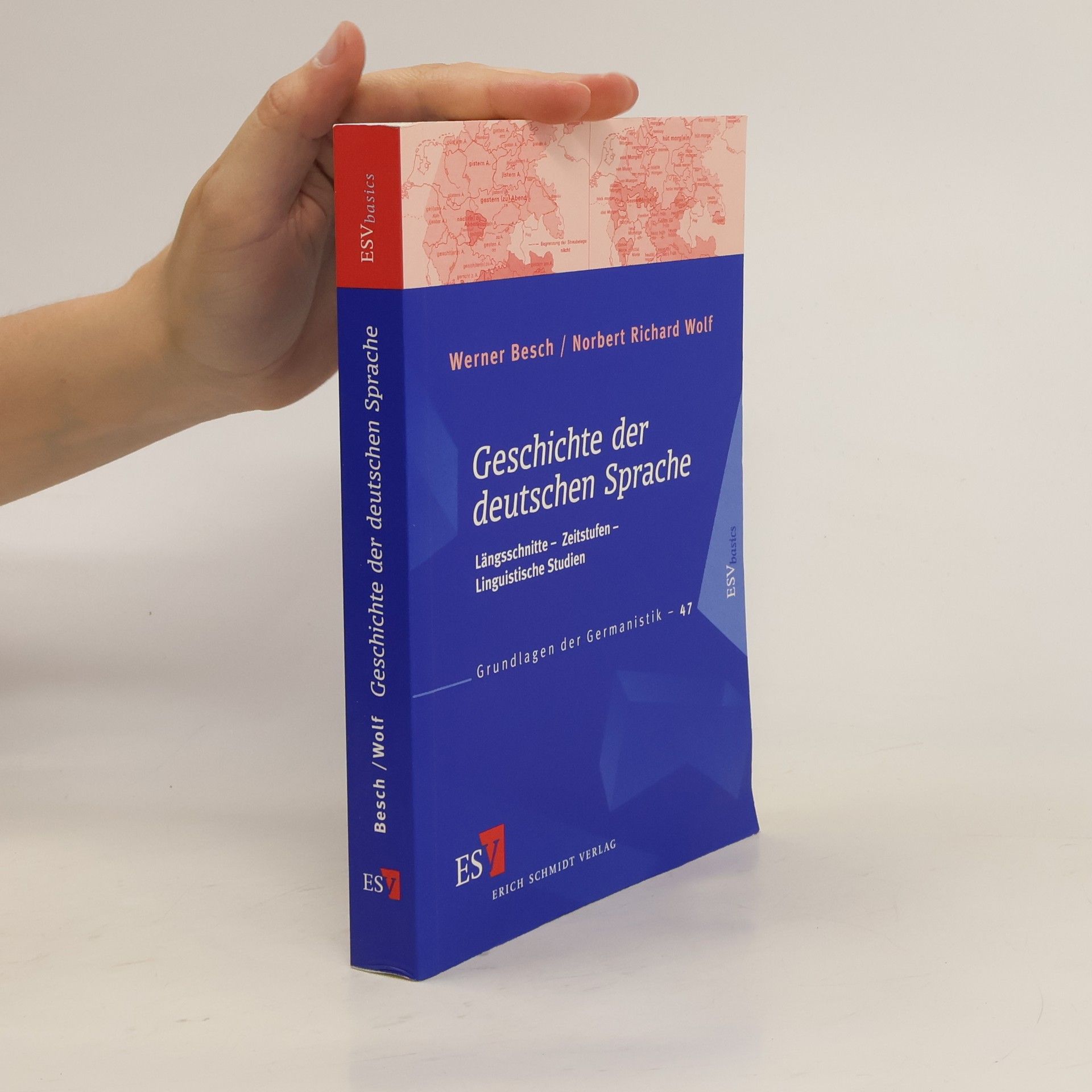
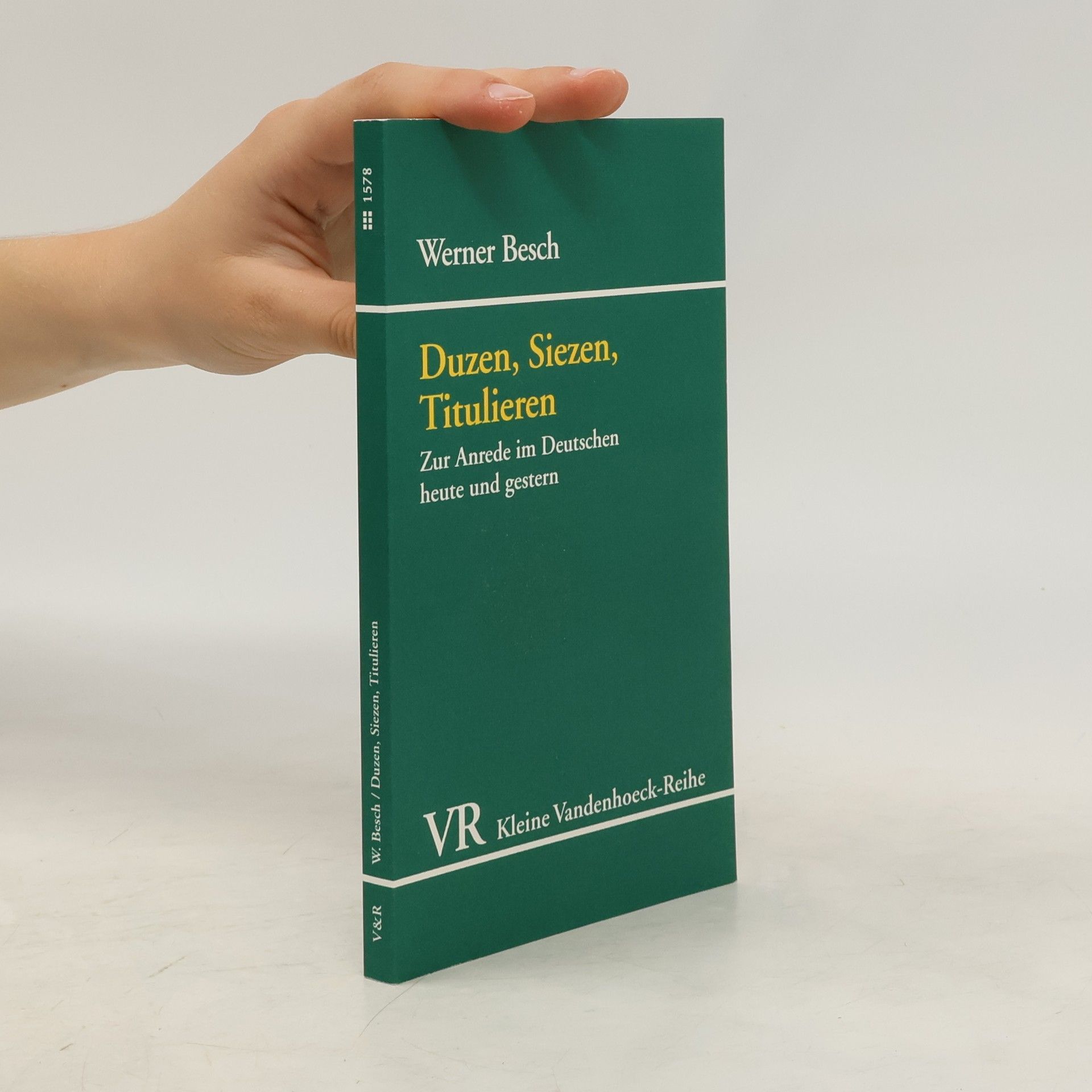
Geschichte der deutschen Sprache
Längsschnitte – Zeitstufen – Linguistische Studien
- 347pages
- 13 heures de lecture
Das Buch informiert in drei Teilen über den Gang und die wesentlichen Aspekte der deutschen Sprachgeschichte. Die großen Zusammenhänge werden durch ‚Längsschnitt-Artikel‘ von den Anfängen im 8./9. Jahrhundert bis heute dargestellt (Teil I). Es folgen ‚Querschnitt-Artikel‘, um zusätzlich die besonderen Charakteristika der einzelnen Sprachepochen vom Althochdeutschen bis zum heutigen Neudeutsch herauszuarbeiten (Teil II). Schließlich bieten ‚Linguistische Studien‘ Einsichten in vieldiskutierte Lautwandelabläufe des Deutschen. Ein solches Vorgehen hat den Vorteil, dass die großen Entwicklungen wesentlich deutlicher hervortreten können als im ‚Korsett‘ abfolgender Epochen-Querschnitte allein. Die Darstellung wird durch zahlreichen Karten, Tabellen und Abbildungen gestützt. Orientierungshilfen verschiedener Art sollen das Lesen und ein gezieltes Suchen erleichtern. Klare Untergliederungen der Artikel, Fettdruck wichtiger Begriffe, Kapitelzusammenfassungen sowie Titelangaben jeweils weiterführender Literatur erleichtern den Umgang mit dem Werk im akademischen und gymnasialen Unterricht und können auch dem sprachinteressierten Laien nützlich sein.