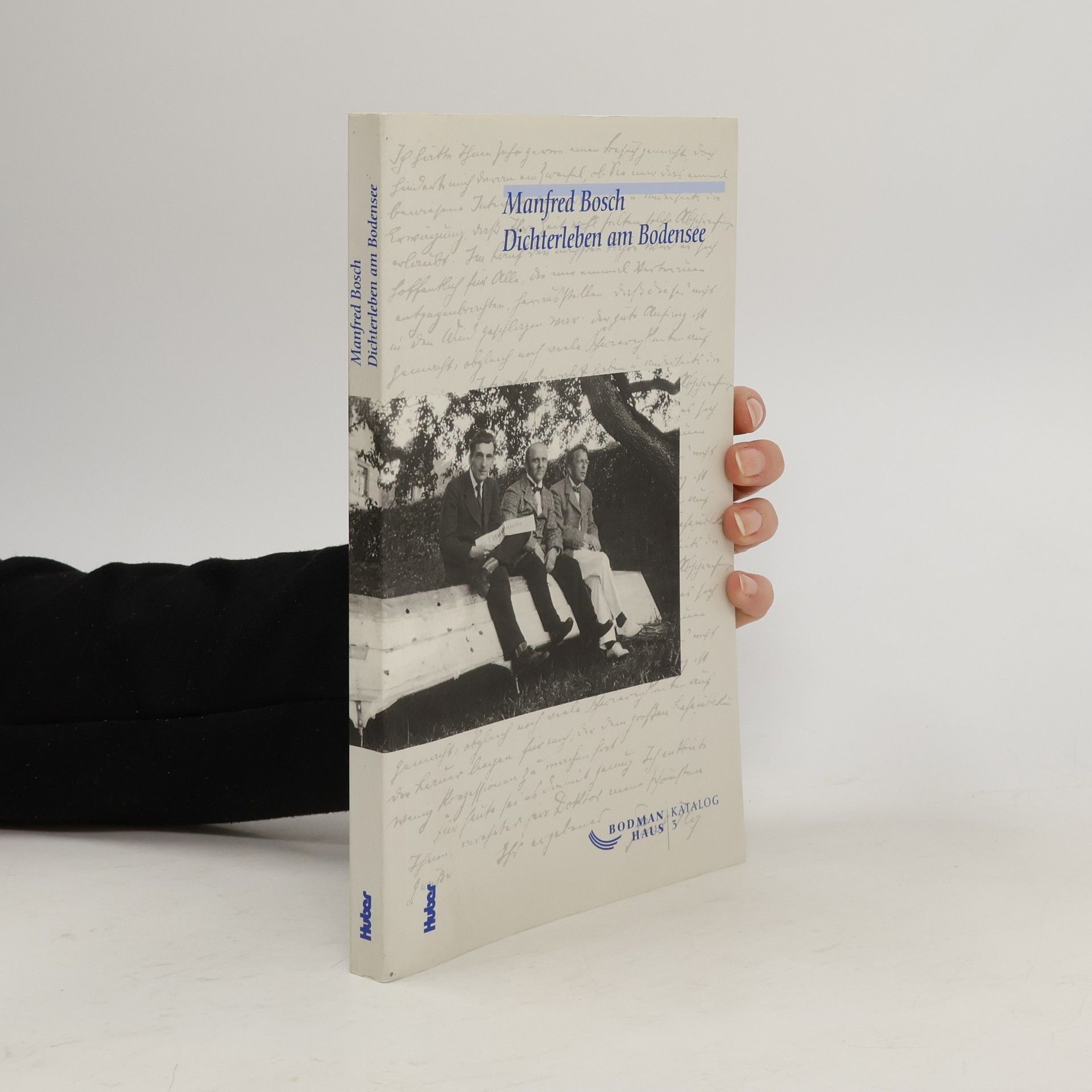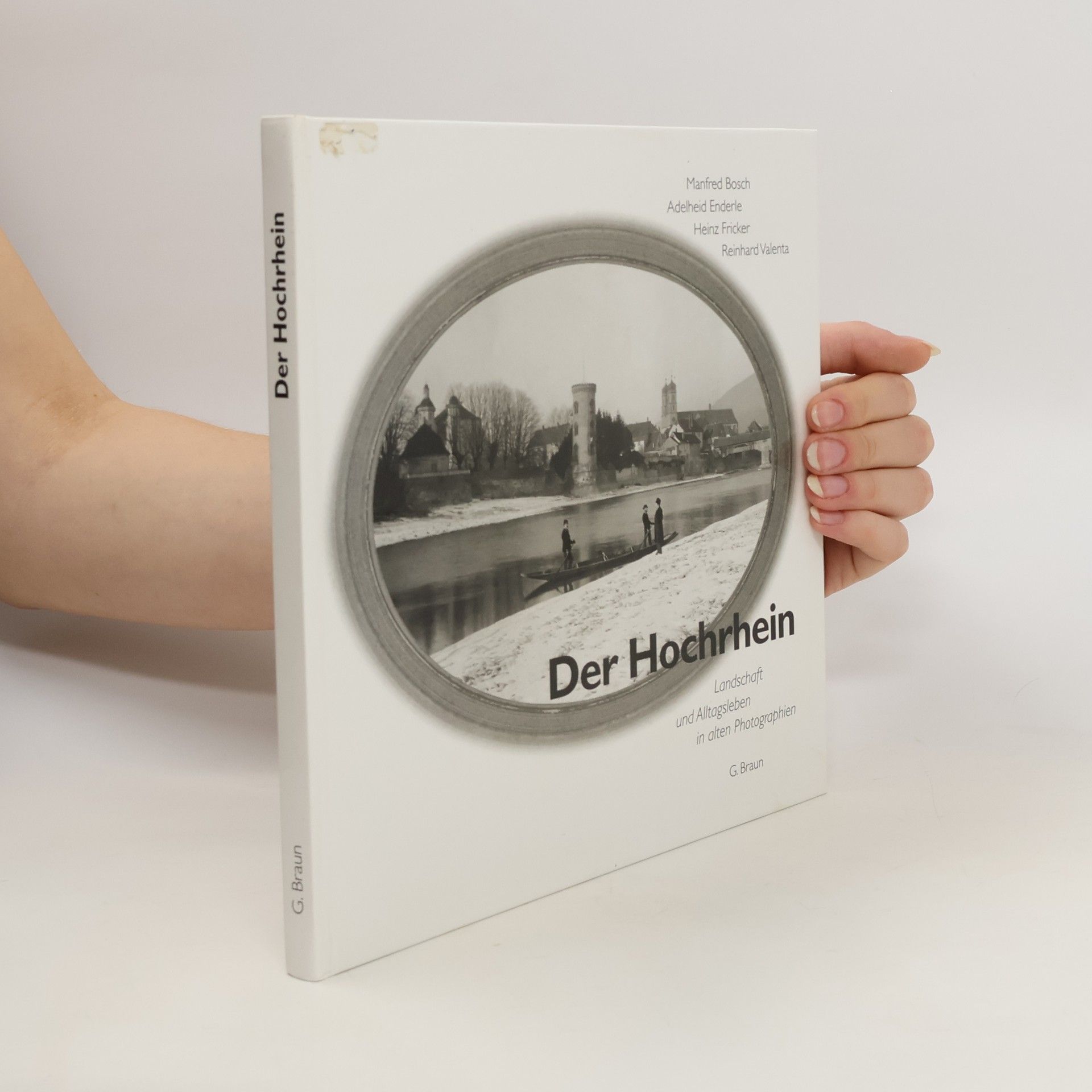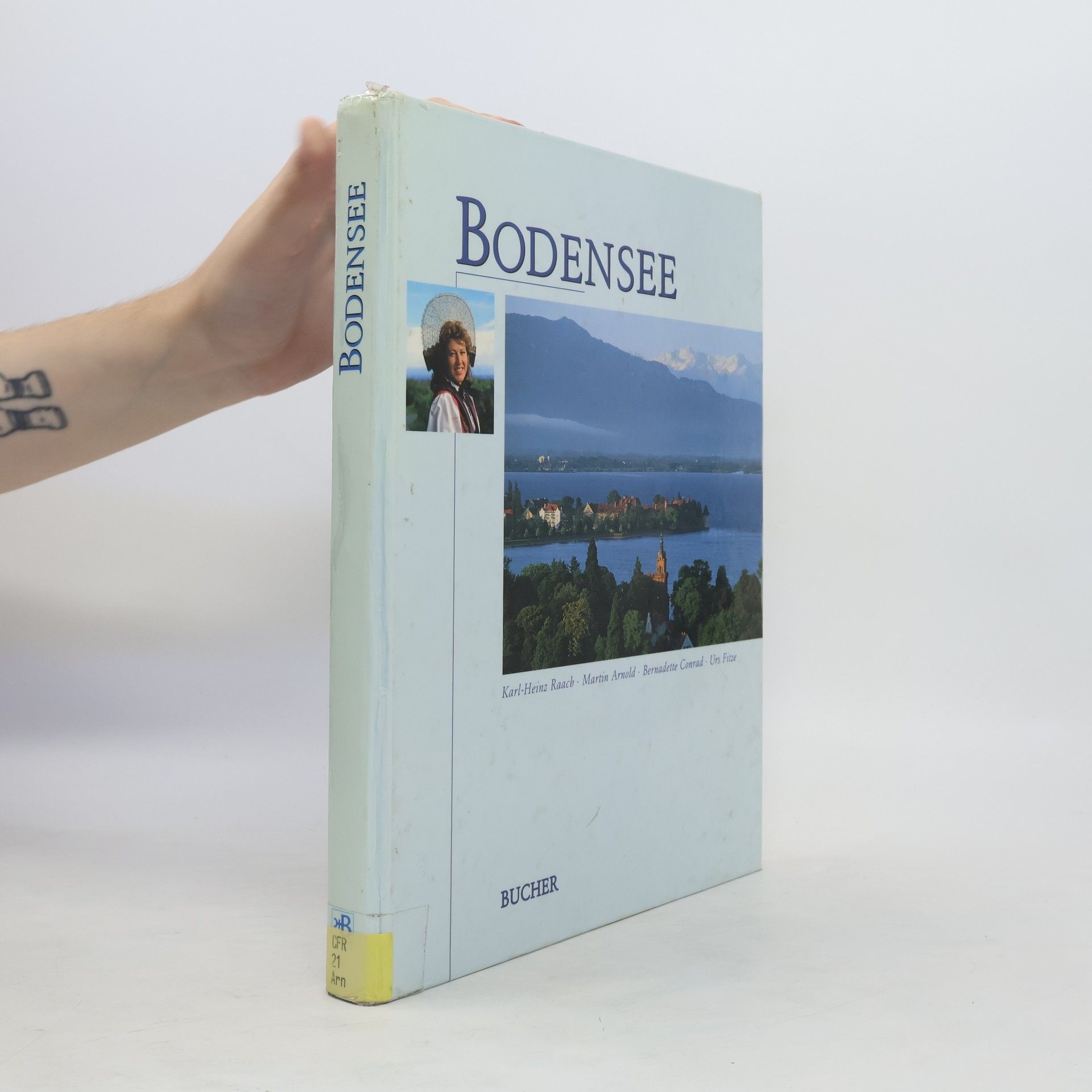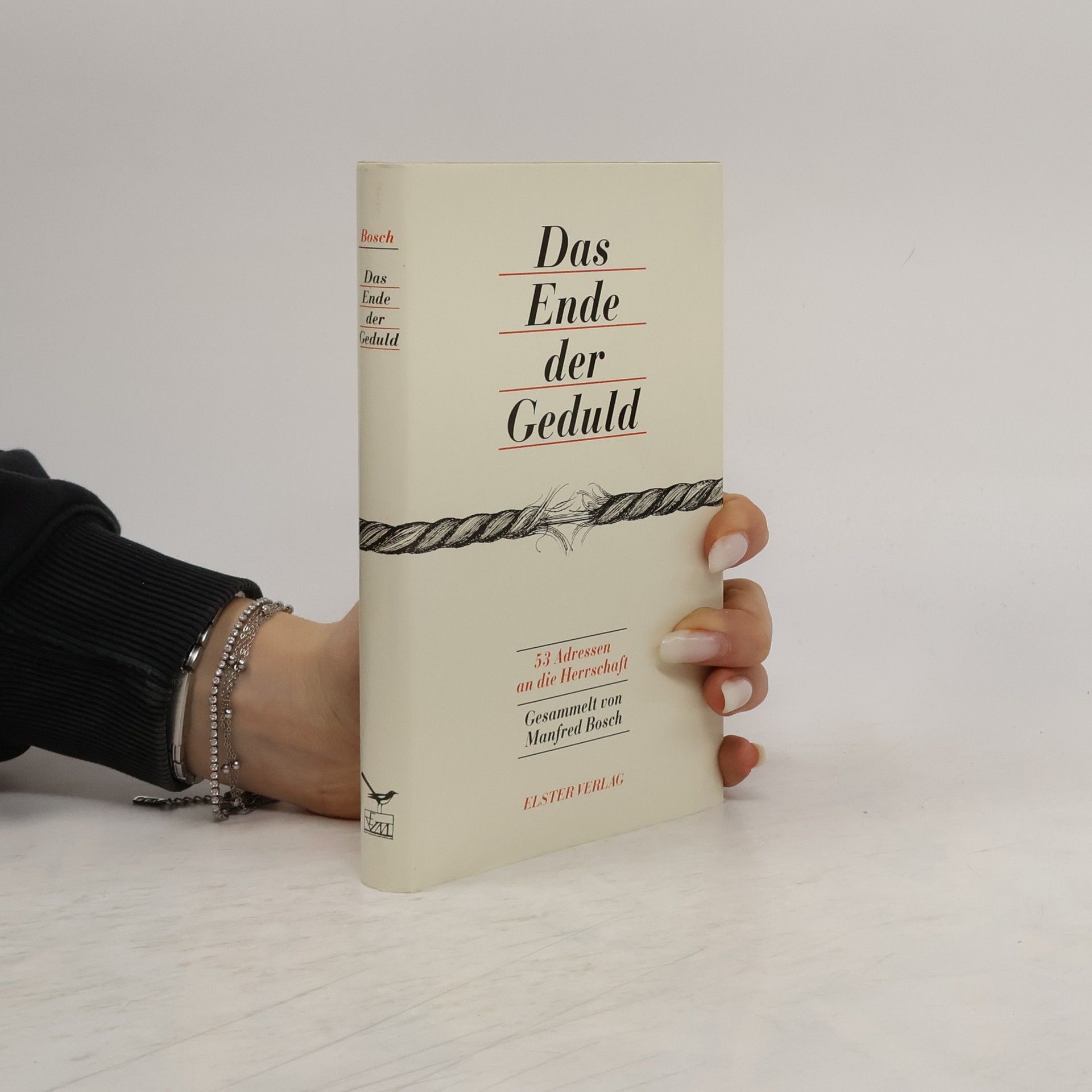Manfred Bosch Ordre des livres
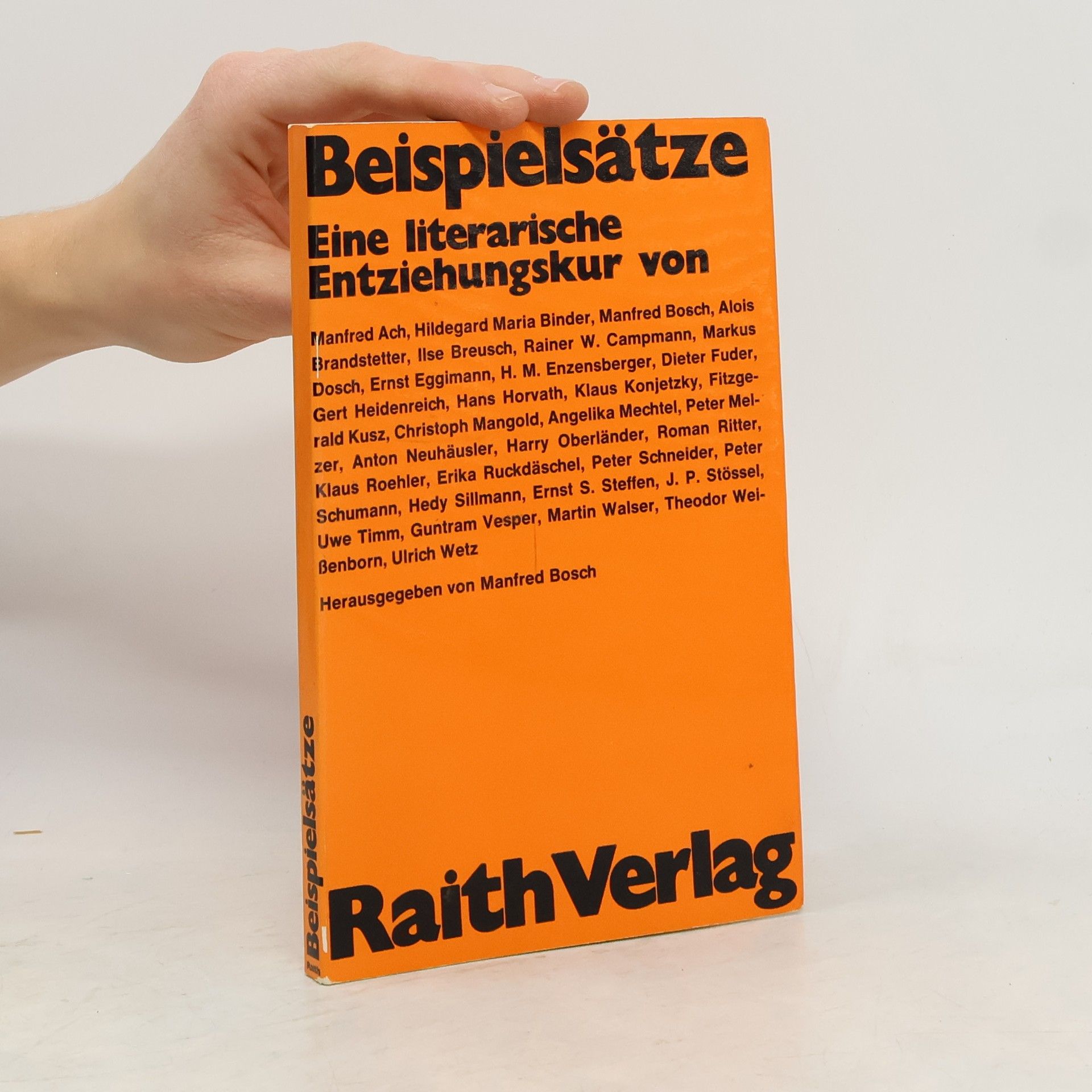
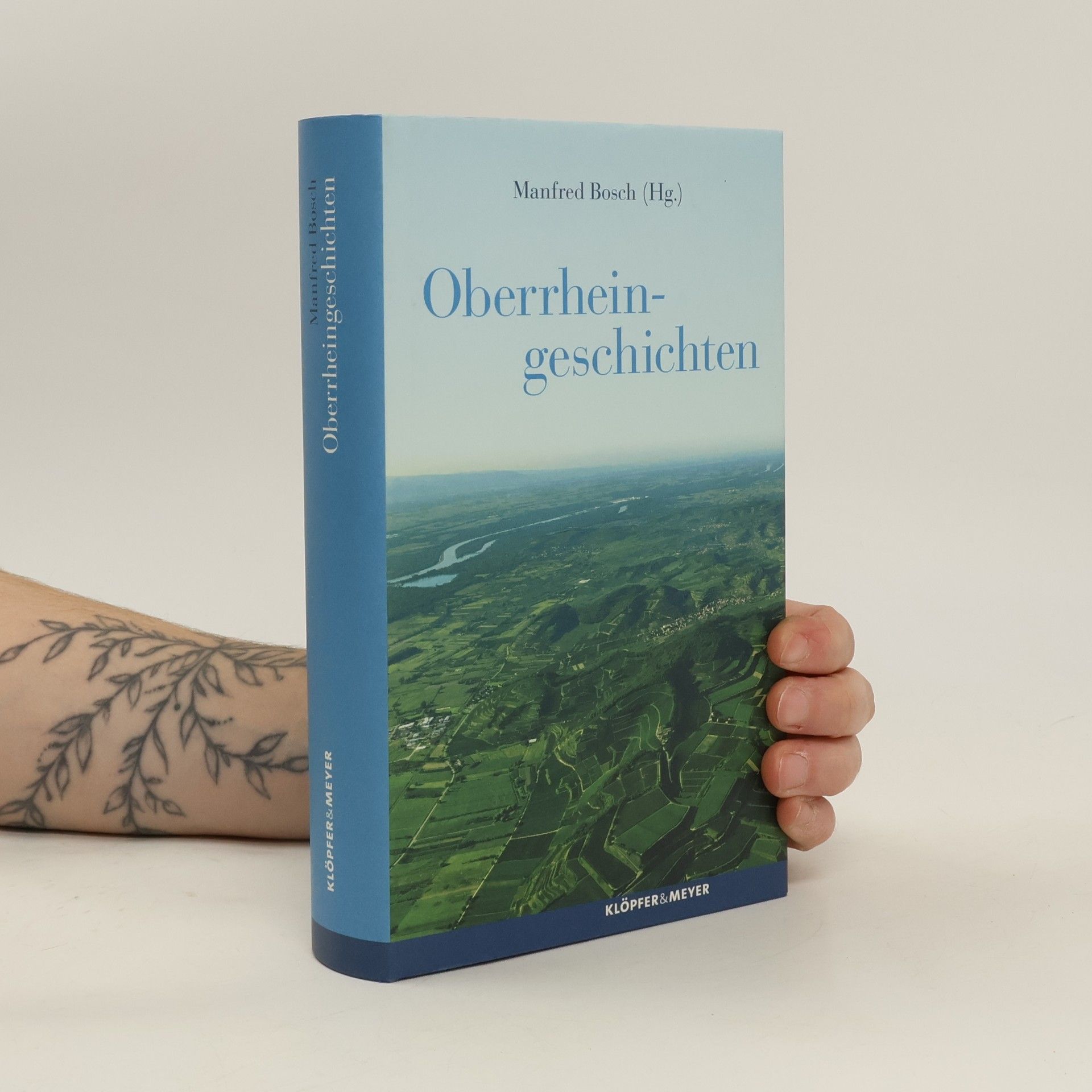

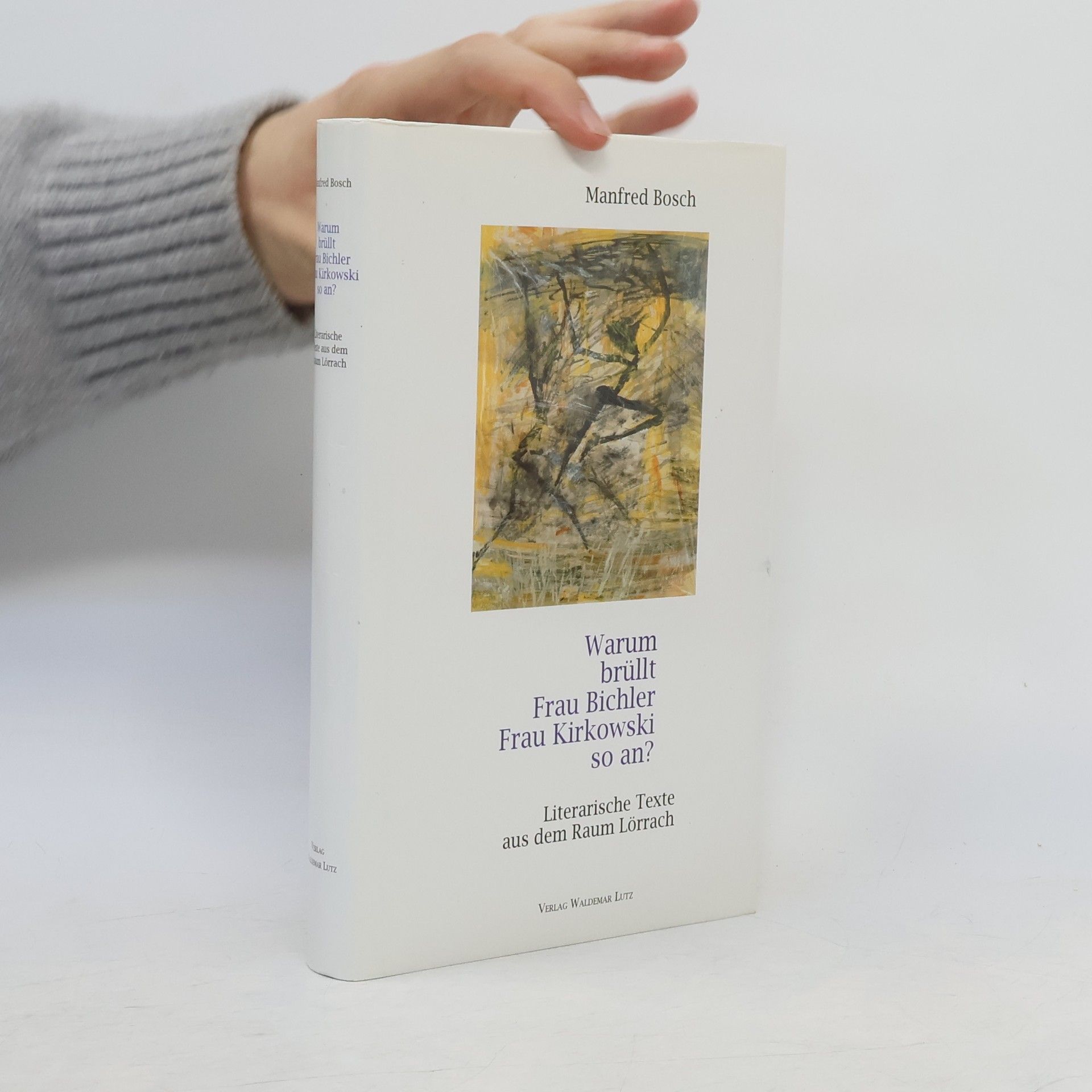
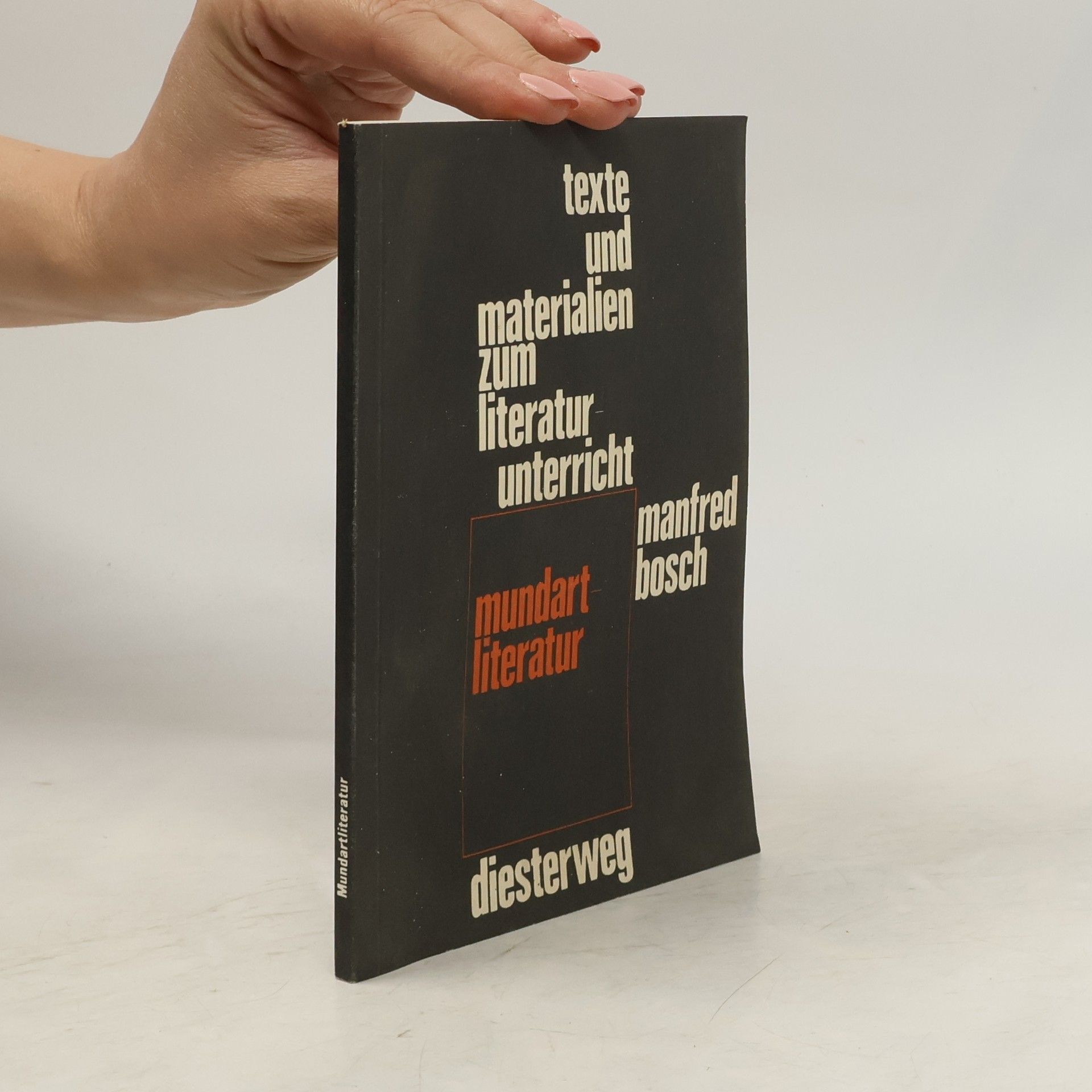

- 2020
- 2010
- 2010
Mit Erasmus von Rotterdam wurde der Oberrhein zur Wiege des deutschen Humanismus, hier schrieb Wickram seine Schwänke, Grimmelshausen seinen »Simplicissimus«, Pfeffel seine Fabeln. In Straßburg begründeten Goethe, Herder und Lenz den Sturm und Drang. Johann Peter Hebels Dichtung, in der das Alemannische klassisch wurde, verklammerte Baden, das Elsass und die deutschsprachige Schweiz. Romanciers wie René Schickele, Annette Kolb und Otto Flake haben hier ihre Hoffnungen auf Europa formuliert – von hier bis in die unmittelbare Gegenwart der Bogen der Moderne. In den Kapiteln »Landschaften, Städte«, »Lebenswelten«, »Auf Durchreise«, »Querelles alemanniques« und »Identität und Wandel« werden Querschnitte durch fünf Jahrhunderte gelegt, in denen die Geistes- und Literaturlandschaft zwischen Basel und Karlsruhe in Romanauszügen und Erzählungen, Essays und Gedichten plastisch wird: als fruchtbare Literaturlandschaft und als ehemalige »Katastrophenzone Europas« als Landschaft des Protestes (Whyl!) und als europäische Modellregion.
- 2002
Dichterleben am Bodensee
- 173pages
- 7 heures de lecture
- 2000
Warum brüllt Frau Bichler Frau Kirkowski so an?
- 357pages
- 13 heures de lecture
- 1997
- 1992
Jacob Picard
- 71pages
- 3 heures de lecture
- 1989
Bodensee
- 158pages
- 6 heures de lecture
- 1985