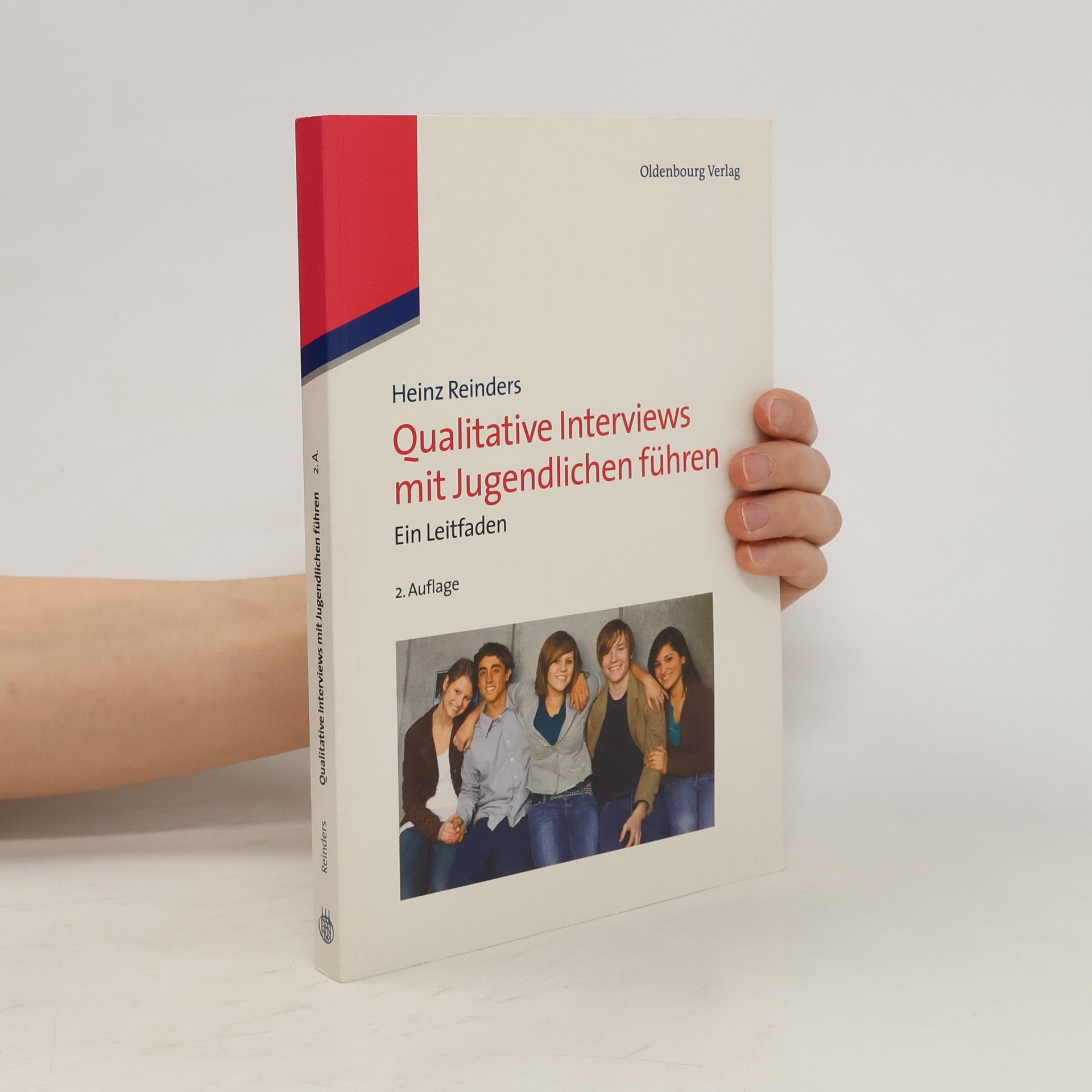Empirische Bildungsforschung
Eine elementare Einführung
Das Lehrbuch ist eine umfangreiche und gleichzeitig elementare Einführung, in der die Empirische Bildungsforschung in ihren Forschungsmethoden, theoretischen Zugängen und Untersuchungsfeldern aufbereitet wird. In kompakten und gut lesbaren Beiträgen von ausgewiesenen Fachexpertinnen und -experten wird in grundlegende Aspekte der Empirischen Bildungsforschung eingeführt. Ziel ist es, Studierenden einen Überblick über die ausgewählten Themen zu geben. Die Themenauswahl orientiert sich an gängigen Modulbeschreibungen grundständiger Studiengänge. Studierende in Lehramtsstudiengängen und angrenzenden bildungswissenschaftlichen Bereichen erhalten gesichertes Grundlagenwissen zu allen relevanten Themen in einem Band.