Wolfgang Lauterbach Livres
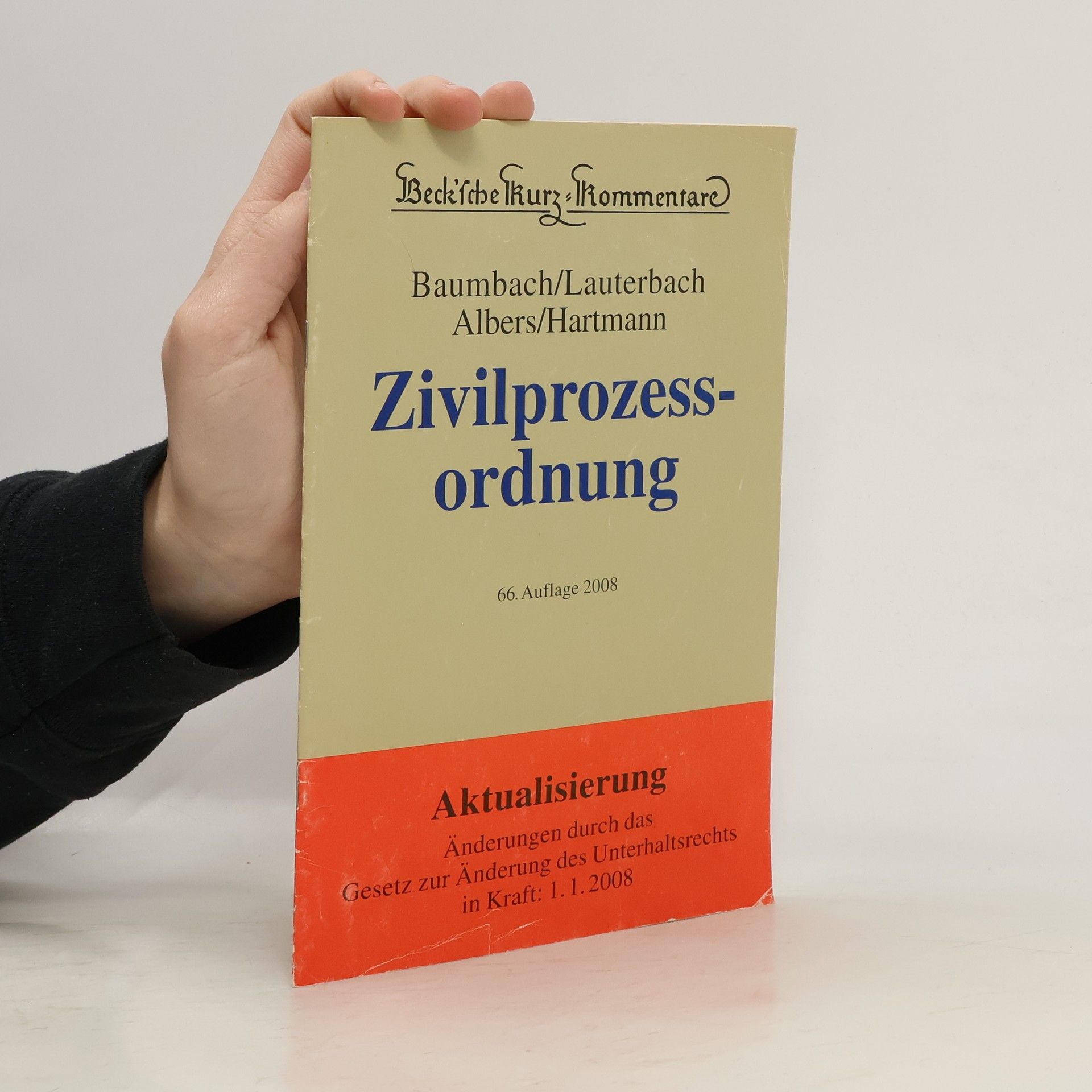

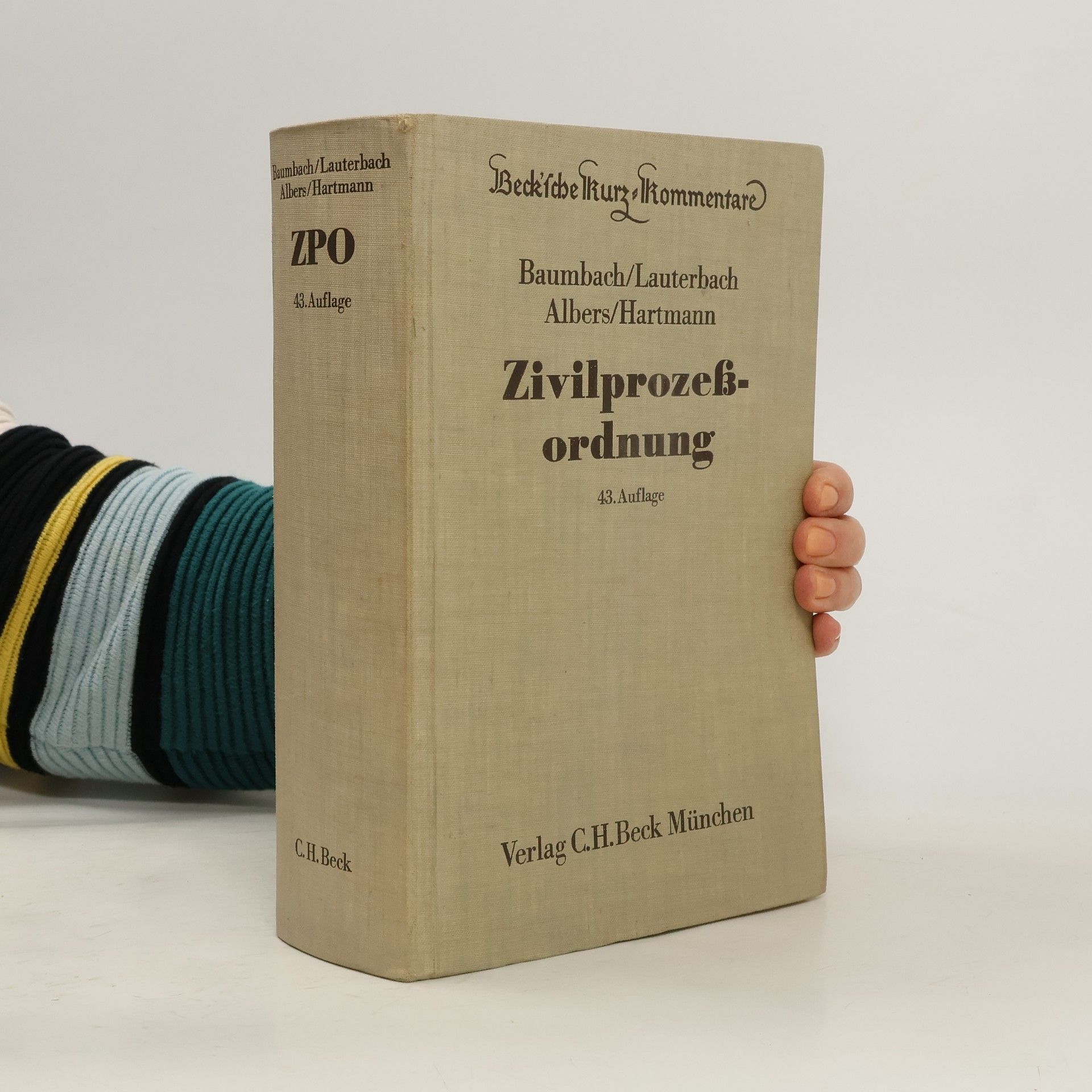

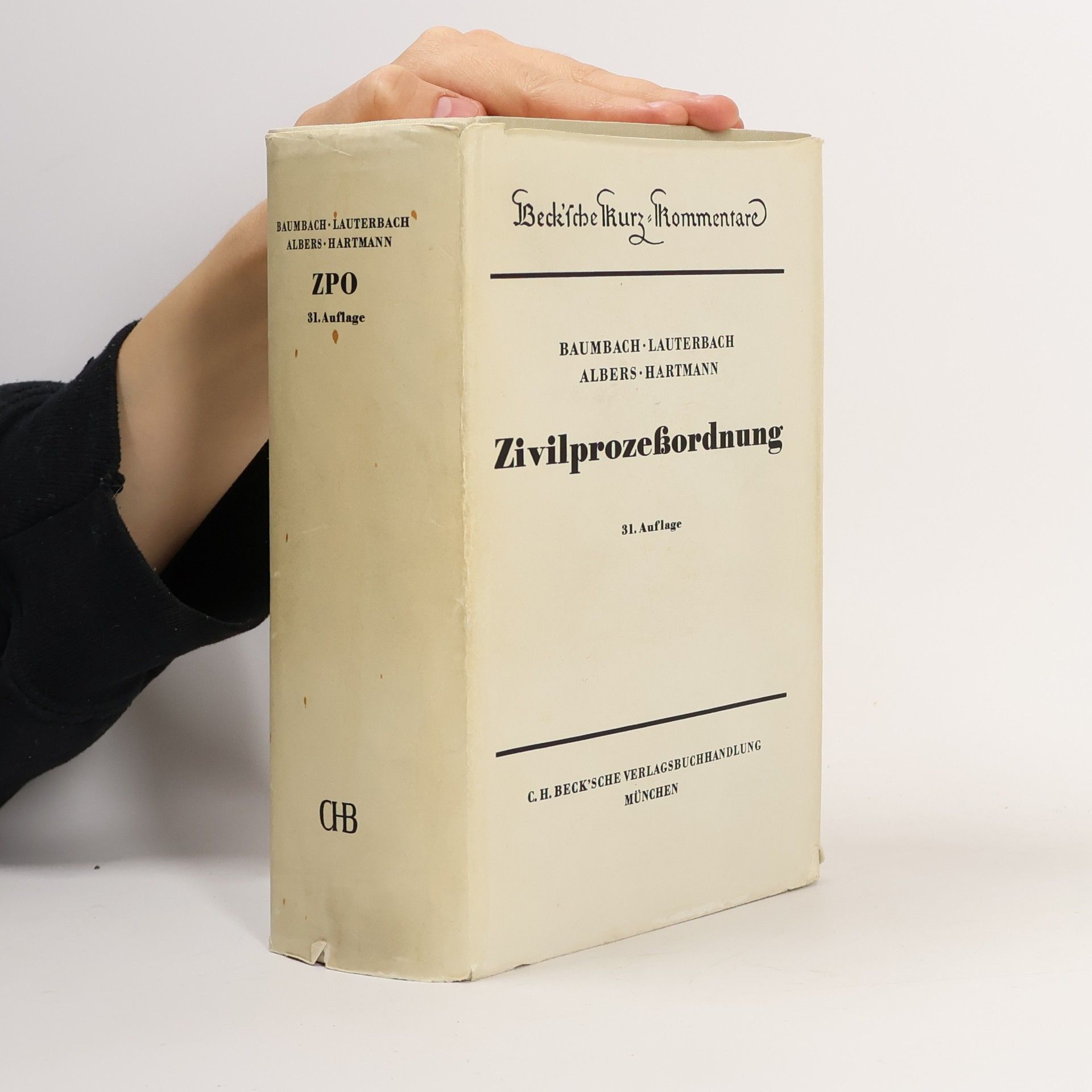
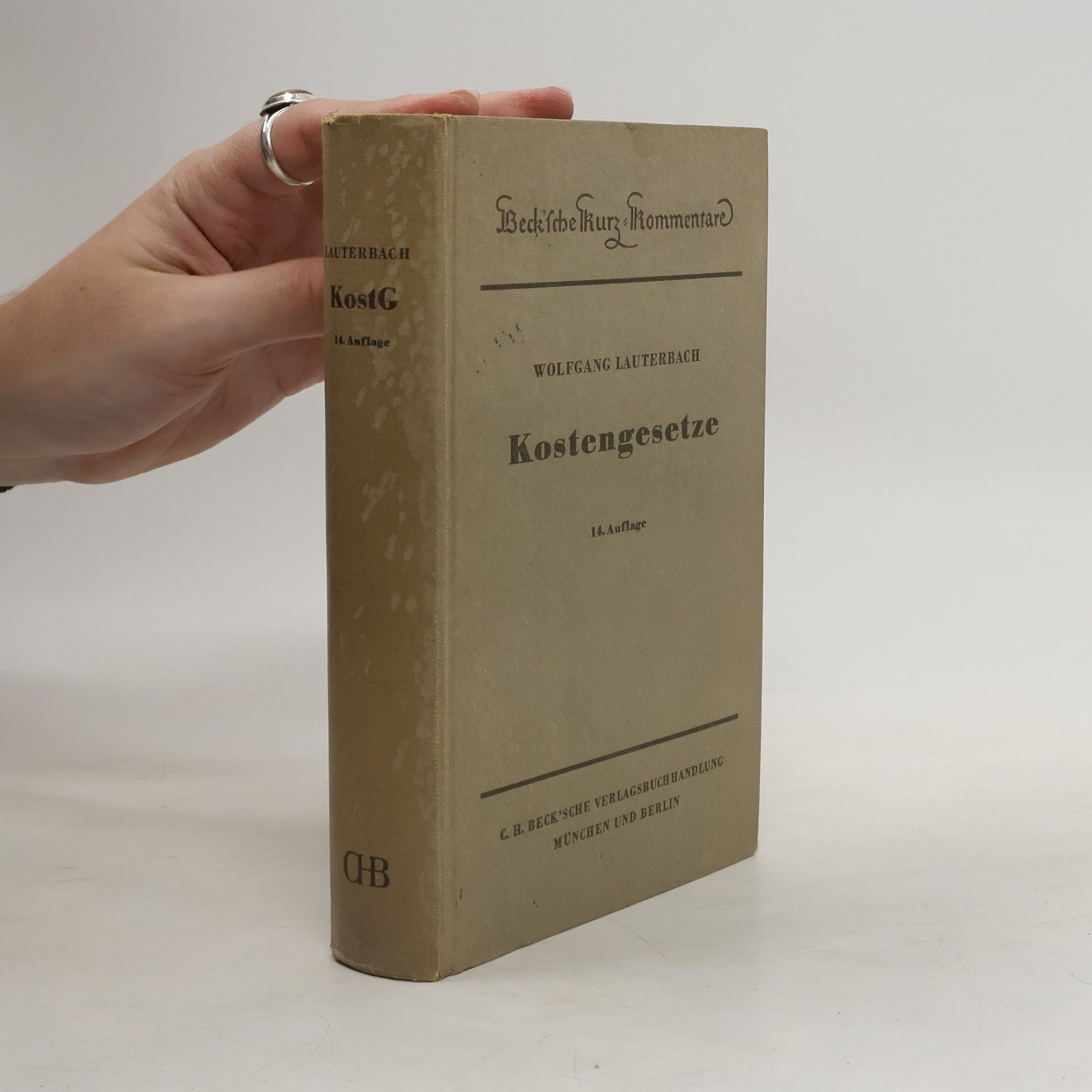
Zivilprozessordnung
- 2319pages
- 82 heures de lecture
Reichtum und Vermögen
Zur gesellschaftlichen Bedeutung der Reichtums- und Vermögensforschung
- 298pages
- 11 heures de lecture
Die jüngsten finanz- und gesellschaftspolitischen Ereignisse rücken Fragen zur Bedeutung von Wohlstand, Reichtum und Vermögen in ein neues Licht. So ist in den letzten Jahren in vielen Gesellschaften der Anteil Wohlhabender und Reicher gestiegen und damit auch die Notwendigkeit, ihre gesellschaftliche Teilhabe transparent zu machen. Diese globale Entwicklung erfordert ein neues Denken über die Bedeutung dieser Gruppen in und für die Gesellschaft. Auch wenn Reichtum ein „scheues Wild“ ist, sind die Anstrengungen verstärkt worden, diesen Mythos zu enträtseln. Neben die etablierte Reichtumsforschung trat die Vermögensforschung. Gemeinsam wurden theoretische Positionen überdacht und Begriffe wie beispielsweise Verantwortung, Engagement, Ungleichheit, Erbschaften und Generationen neu diskutiert. Im Anschluss an eine zu diesem Thema durchgeführte Tagung gibt der vorliegende Band einen umfassenden Überblick zu derartigen Fragen. Vorgestellt werden neue empirische Ergebnisse und theoretische Positionen zum gesellschaftlichen Engagement Vermögender, dem Sozialprofil sowie dem Lebensstil von Reichen und der Genese von Wohlstand und Reichtum.
Zivilprozessordnung
mit Gerichtsverfassungsgesetz und anderen Nebengesetzen - 43. Auflage
- 2497pages
- 88 heures de lecture
Im Buch "Vermogen in Deutschland. Heterogenitat und Verantwortung" werden die neuesten Erkenntnisse zu den Daten der Studie Vermogen in Deutschland (ViD) prasentiert, die erstmals einen detaillierten Einblick in die Besonderheiten der wohlhabenden und reichen Bevolkerung bieten. In den Beitragen von Soziologen und Psychologen werden Unterschiede zur Mittelschicht, gesellschaftliches Engagement sowie Verantwortung untersucht und mentale Typen aus der Perspektive der Vermogenskultur vorgestellt."
Zivilprozessordnung
Änderung durch das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts : in Kraft: 1.1.2008. Aktualisierung [zur 66. Aufl.]
- 24pages
- 1 heure de lecture