Waldhonig entsteht nicht aus Baumnektar, sondern aus dem Honigtau von Läusen, die auf Nadelbäumen leben. Peter Buchner, ein erfahrener Wanderlehrer, vermittelt in diesem Buch umfassendes Wissen über die Lebensweise dieser "Honigläuse" und deren Zyklus. Er zeigt Imkern, wie sie die Gewinnung von Waldhonig effektiv nutzen können, und kombiniert seine Erklärungen mit beeindruckenden Makroaufnahmen der Läuse. Dieses Werk bietet eine faszinierende Perspektive auf die Beziehung zwischen Bienen und ihren Nahrungsquellen im Wald.
Peter Büchner Livres

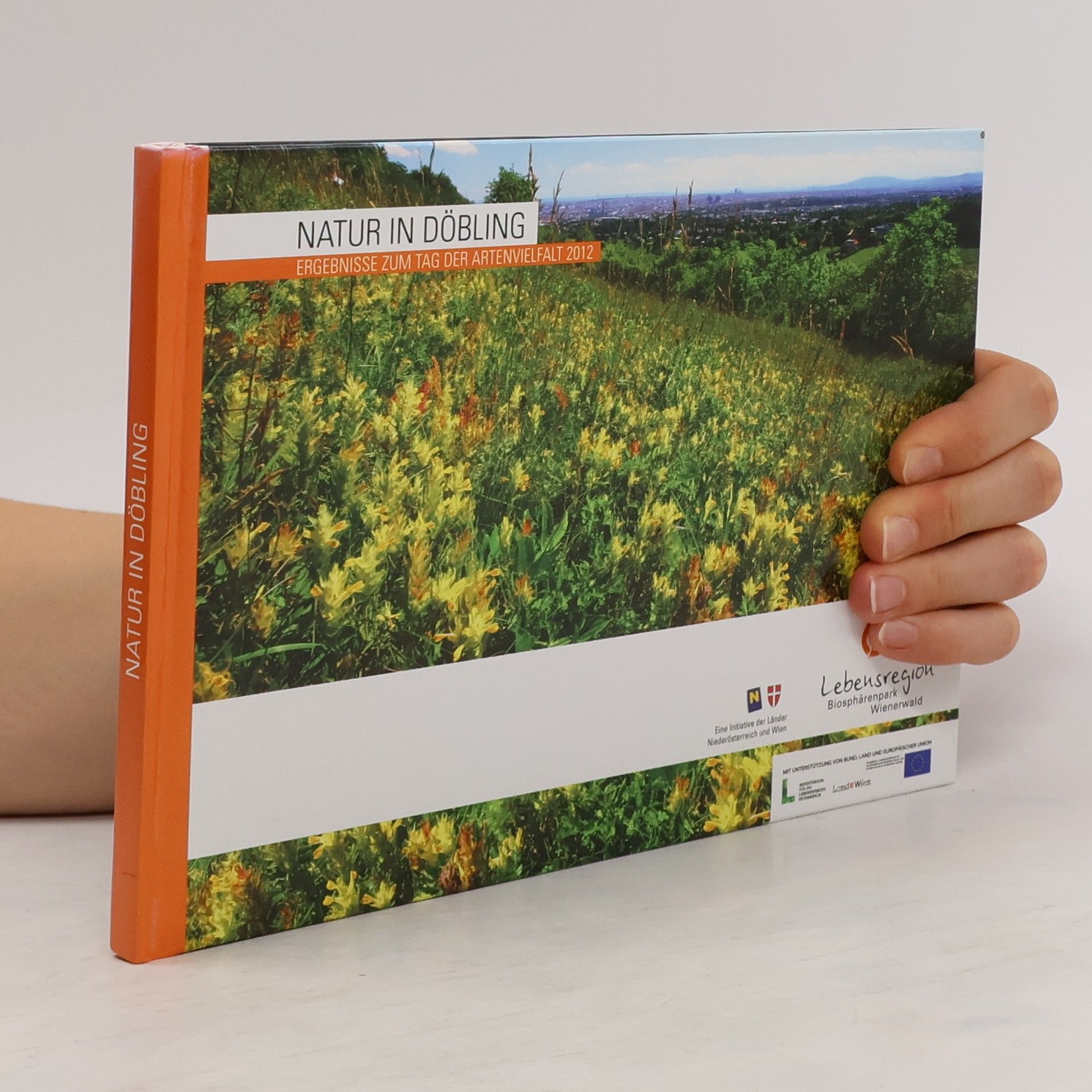

Grundriss der Pädagogik | Erziehungswissenschaft - 35: Bildung und soziale Ungleichheit
Eine Einführung
- 263pages
- 10 heures de lecture
Über die großen Schulleistungsstudien PISA, TIMSS und Co. ist das Problem der bildungsbezogenen Ungleichheit auf die Agenda von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit zurückgekehrt. Danach erweist sich die soziale Herkunft der Schüler und Schülerinnen als eine zentrale Stellgröße für deren Bildungsbeteiligung. Der Band knüpft an diese Befunde an und erweitert dabei den Blick auf die Zusammenhänge von Bildung und soziale Herkunft in mehrfacher Hinsicht: Nicht nur die institutionellen Bildungsprozesse in der Schule, sondern auch in der vorschulischen Betreuung, an den Universitäten und im beruflichen (Aus)Bildungs- und Weiterbildungsbereich werden beleuchtet. Darüber hinaus nehmen die Autoren auch zentrale informelle Bildungskontexte wie Familie, Peers, Freizeit und Mediennutzung in ihrer Beteiligung an der Reproduktion sozialer Ungleichheit in den Blick.