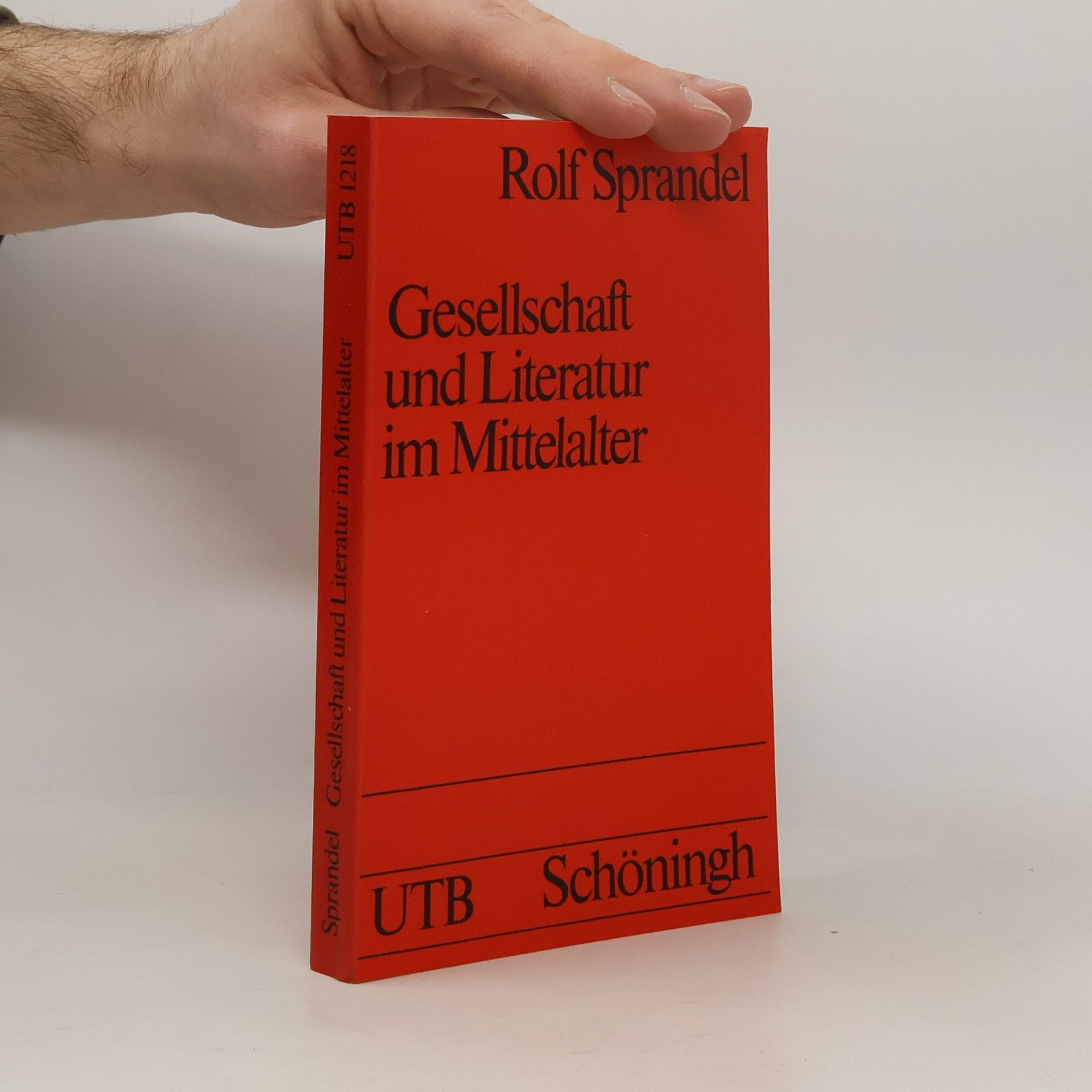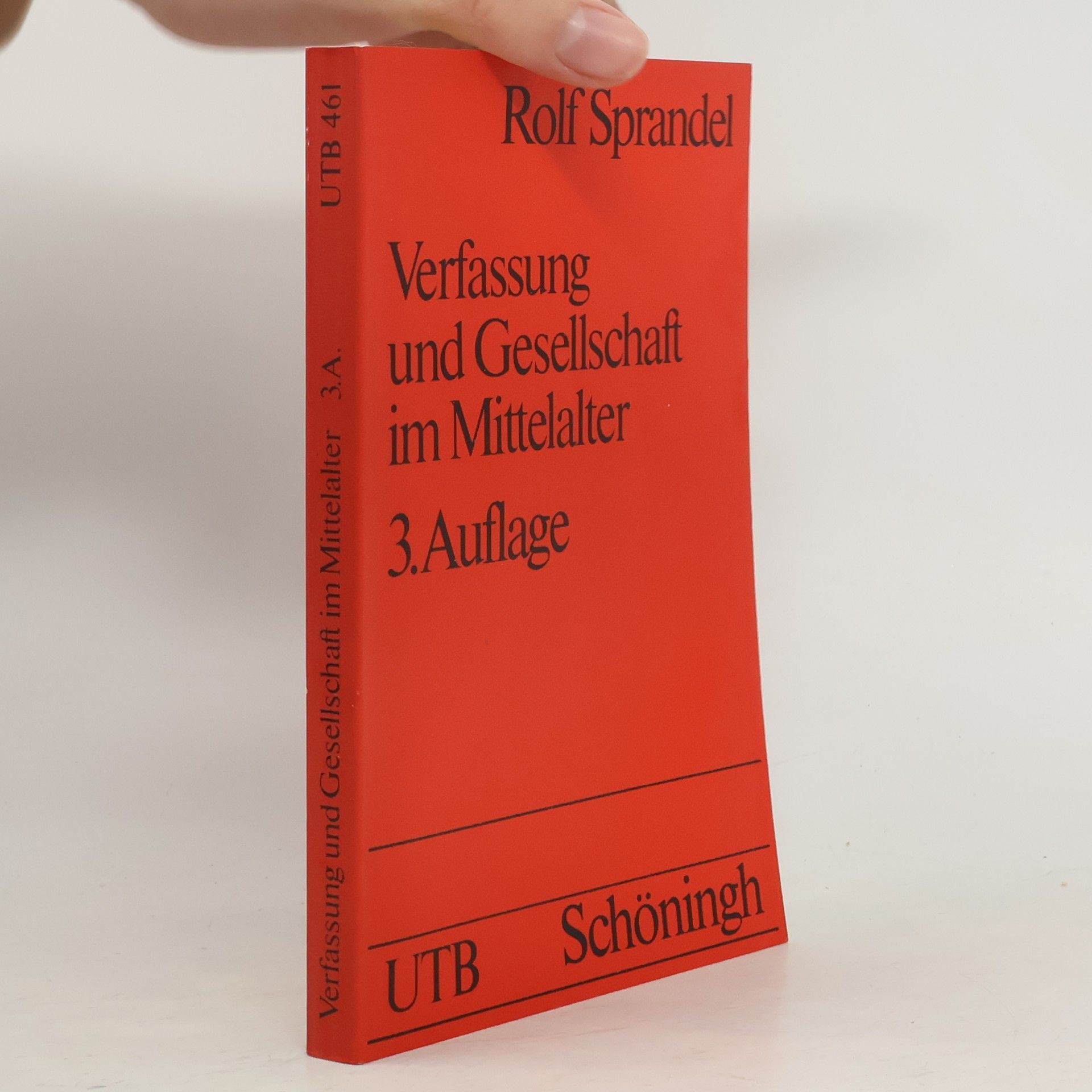Die Einführung untersucht die Ordnungen des Zusammenlebens von Gruppen im 19. und 20. Jahrhundert, anstatt die Vorgeschichte der Verfassungen im Mittelalter zu betrachten. Sie beleuchtet ein Gefüge von familiären Bindungen bis hin zu den Rechten der Könige und den Gemeinsamkeiten der abendländischen Christenheit.
Rolf Sprandel Livres
9 novembre 1931 – 17 février 2018