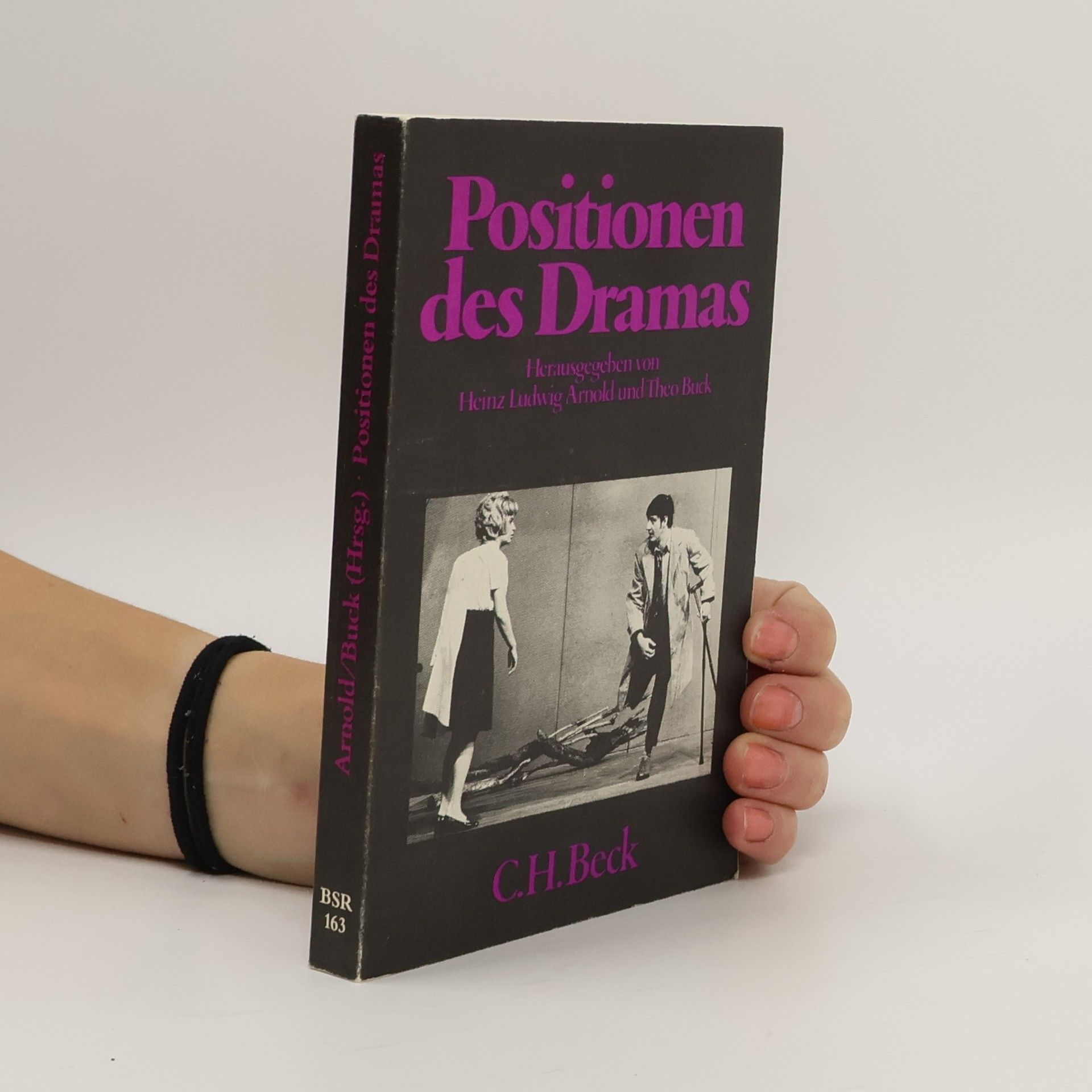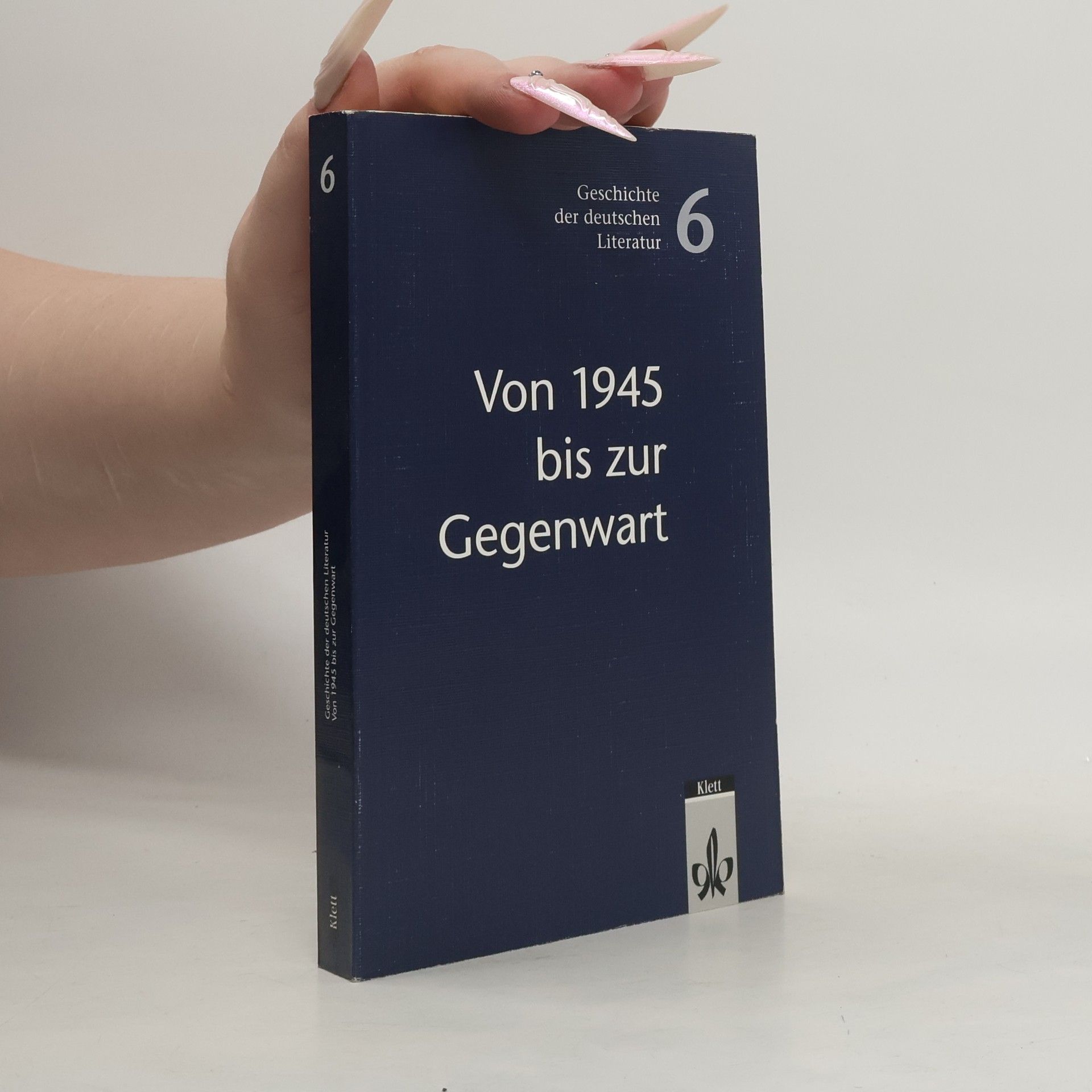Die künstlerische Arbeit Goethes als Dramatiker wird in diesem Band umfassend analysiert, einschließlich seiner Kurzdramen, Festspiele, Prologe und Singspiele. Durch die systematische Erschließung dieser Werke wird ein bedeutender Teil der deutschen Dramengeschichte sowie ein herausragender Beitrag zum Welttheater beleuchtet.
Theo Buck Livres
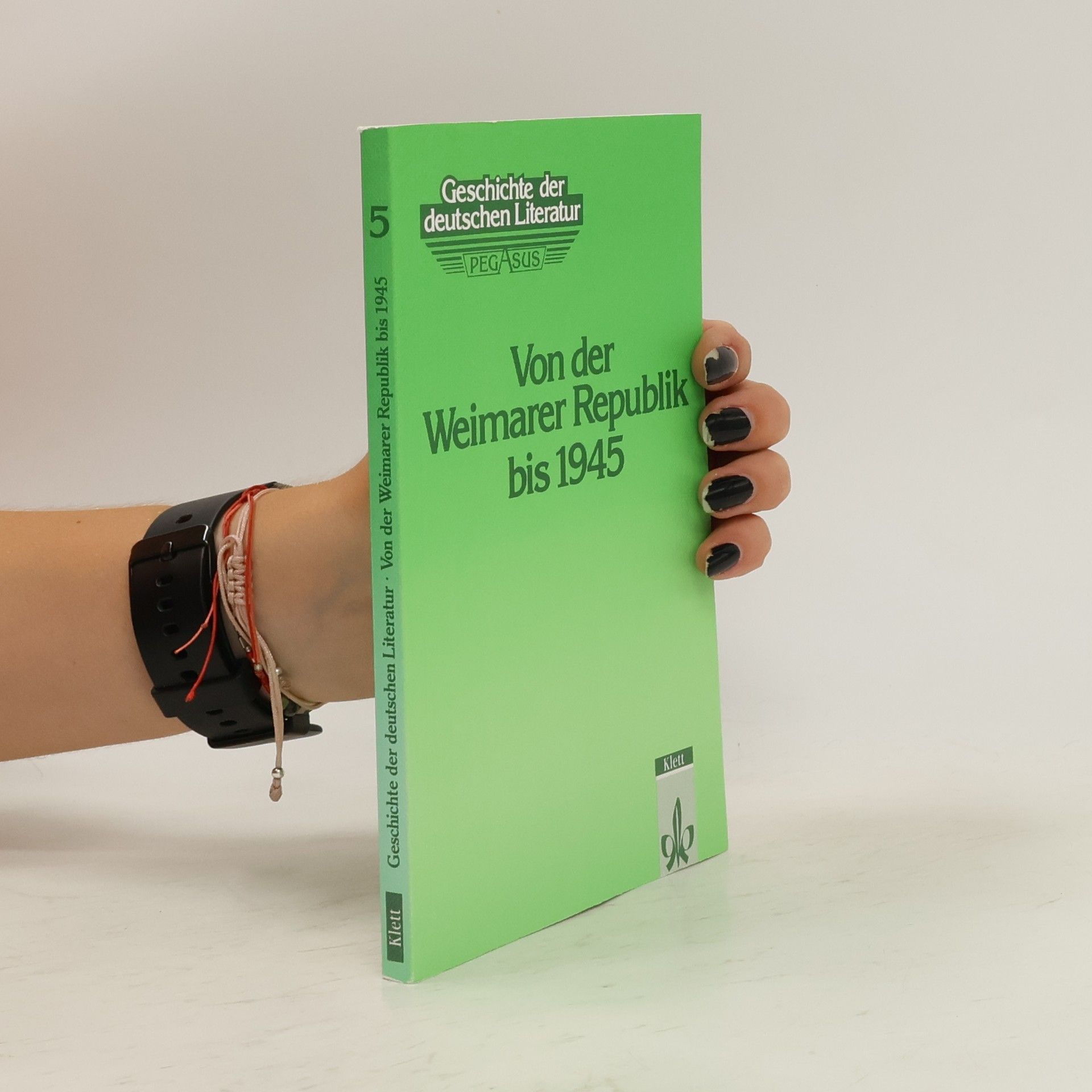




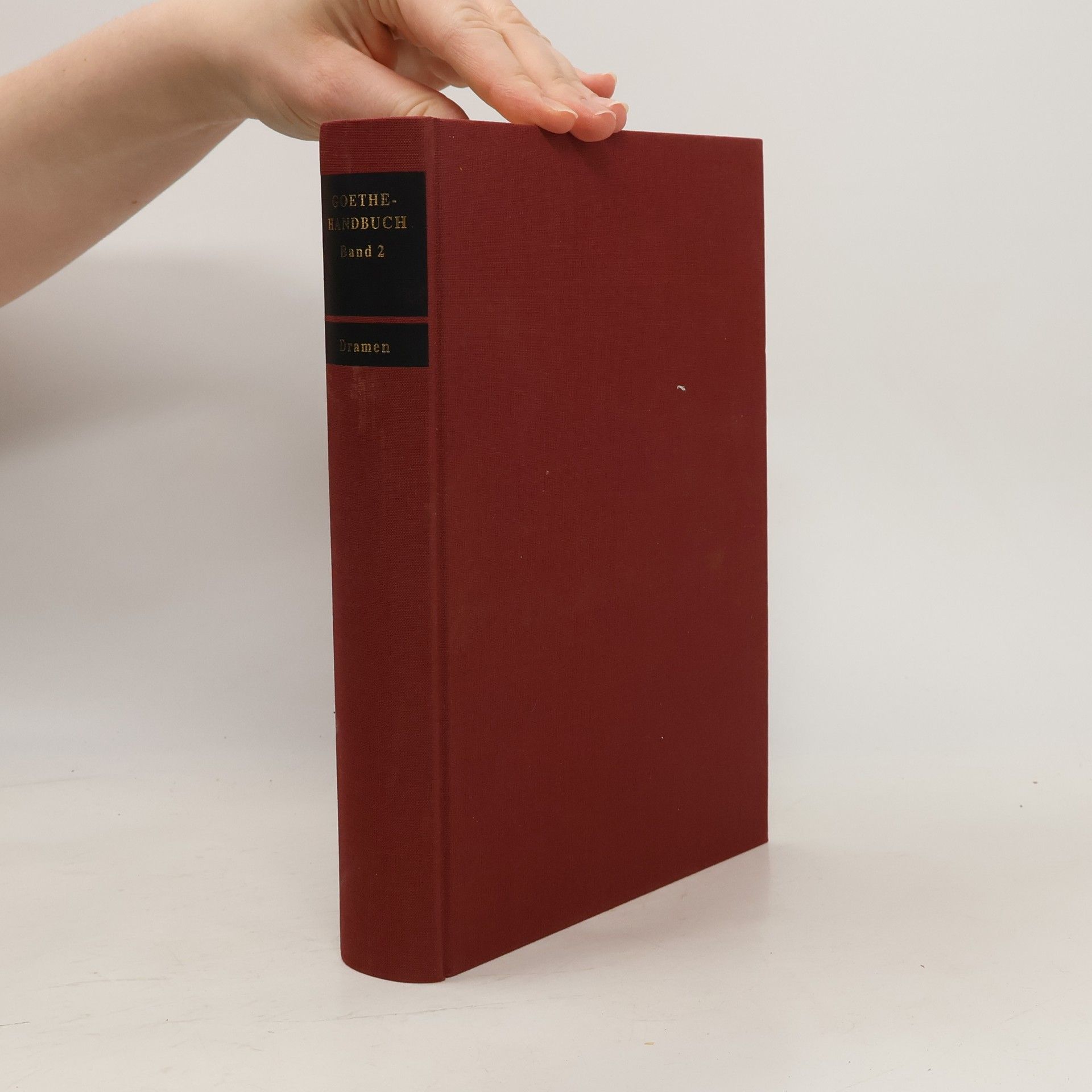
Paul Celan (1920-1970)
Ein jüdischer Dichter deutscher Sprache aus der Bukowina. Die Biographie
Im November 2020 jährt sich Paul Celans Geburt in Czernowitz zum hundertsten Mal, und im April dieses Jahres vor fünfzig Jahren nahm er sich in Paris das Leben. Diese Koinzidenz bietet Anlass, Celans Leben und Schaffen zu reflektieren. Trotz bereits vorhandener biographischer Darstellungen und Interpretationen seiner Gedichte fehlt eine umfassende Werkbiographie, die die verschiedenen Aspekte seines Lebens und Schaffens miteinander verbindet, ohne dabei zu indiskret zu sein. Viele von Celans Gedichten bleiben unverständlich, wenn man die Lebensumstände, aus denen sie hervorgegangen sind, nicht kennt. Theo Buck (1930–2019) war ein versierter Kenner und Interpret von Celans Werken. In seiner posthum veröffentlichten Monographie untersucht er das enge Verhältnis von Dichtung und Leben eines der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker der Moderne. Celan, ein deutschsprachiger Jude aus der Bukowina, wollte nie in Deutschland leben, obwohl ihm daran gelegen war, in seiner Muttersprache gehört und verstanden zu werden. In Zeiten zunehmenden Antisemitismus ist es wichtig, Celans leise Stimme zu hören. Bucks sensible Annäherung an Celans Leben und Werk ermöglicht eine neue Perspektive im Jubiläums- und Erinnerungsjahr und darüber hinaus.
In dem 1992 entstandenen Gedicht „Mommsens Block“ macht Heiner Müller die überraschende Entdeckung seiner Wahlverwandtschaft mit dem Althistoriker Theodor Mommsen. Wie der in der römischen und wilhelminischen Kaiserzeit sah er in der Zeit der verschwindenden DDR und der deutschen Wiedervereinigung ebenfalls die „Adler im Sumpf“. Was er dabei beobachten konnte, ist ungemein spannend und herausfordernd für den heutigen Leser. Theo Buck, 1930 in Tübingen geboren, war bis zu seiner Emeritierung Universitätsprofessor zunächst an der Georg-August-Universität Göttingen, dann an der RWTH Aachen. Er arbeitet vor allem über Goethe, Büchner, Brecht sowie Celan, Johnson, Schädlich – und natürlich Heiner Müller.
Vorschein der Apokalypse
Das Thema des Ersten Weltkriegs bei Georg Trakl, Robert Musil und Karl Kraus
Drei Namen drängen sich unter den österreichischen Schriftstellern der Generation des Ersten Weltkriegs auf: Georg Trakl, Robert Musil und Karl Kraus. Zwar sind sie in ihrer künstlerischen Arbeit sehr verschieden voneinander. Auch ihre Einstellung zum Kriegsgeschehen ist jeweils anders; Trakl als „Medikamentenakzessist“, der den wüsten Katarakt von Schrecken, Gewalt und Tod nicht aushielt und darum an der Welt irre wurde. Musil als Offizier, der den ganzen Krieg mitmachte, dabei aber bemerken mußte, „wie schlecht die Menschheit noch aufrecht gehen kann“. Kraus als überzeugter Pazifist, der mit der Fackel journalistisch gegen den Wahnsinn seiner Zeit anging und mit dem Drama Die letzten Tage der Menschheit das unmenschliche Geschehen entlarvend ins Bewußtsein hob. Drei Textbeispiele belegen, jedes auf seine Weise, einen übereinstimmenden literarischen Reflex humaner Entrüstung. Insofern erweisen sich die Texte als Denkanstöße für eine notwendige Umorientierung: Apokalypse als Warnbild.
Beck'sche schwarze Reihe - 163: Positionen des Dramas
Analysen u. Theorien zur dt. Gegenwartsliteratur
- 286pages
- 11 heures de lecture
German
Geschichte der deutschen Literatur - 6: Von 1945 bis zur Gegenwart
- 392pages
- 14 heures de lecture