Hamburg im Sommer 1977. Während die Bundesrepublik von der RAF mürbe terrorisiert wird, zieht Günter Märtens seine erste Line Heroin durch die Nase. Deprimiert vom Split seiner hoffnungsvollen Band versucht der Achtzehnjährige seine gescheiterten Träume vom Rockstarleben zu vergessen. Es folgen sieben wahnwitzige Jahre zwischen Himmel und Hölle bis zu dem Punkt seiner Rettung. In seinem autobiographischen Roman „Die Graupensuppe“ beschreibt Günter Märtens seine jugendliche Achterbahnfahrt zwischen Sehnsucht, Freundschaft, Verrat, überbordender Lust und seiner beinahe tödlichen Drogensucht. Umrahmt vom sozialen und musikalischen Zeitkolorit dieser Zeit erzählt er in witzig-ironischem, ureigenem Ton von absurden Abgründen, tieftraurigen sowie hochkomischen Momenten. Eine fulminante Zeitreise durch ein Deutschland, das seine Jugend nicht mehr verstand.
Gunter Martens Livres
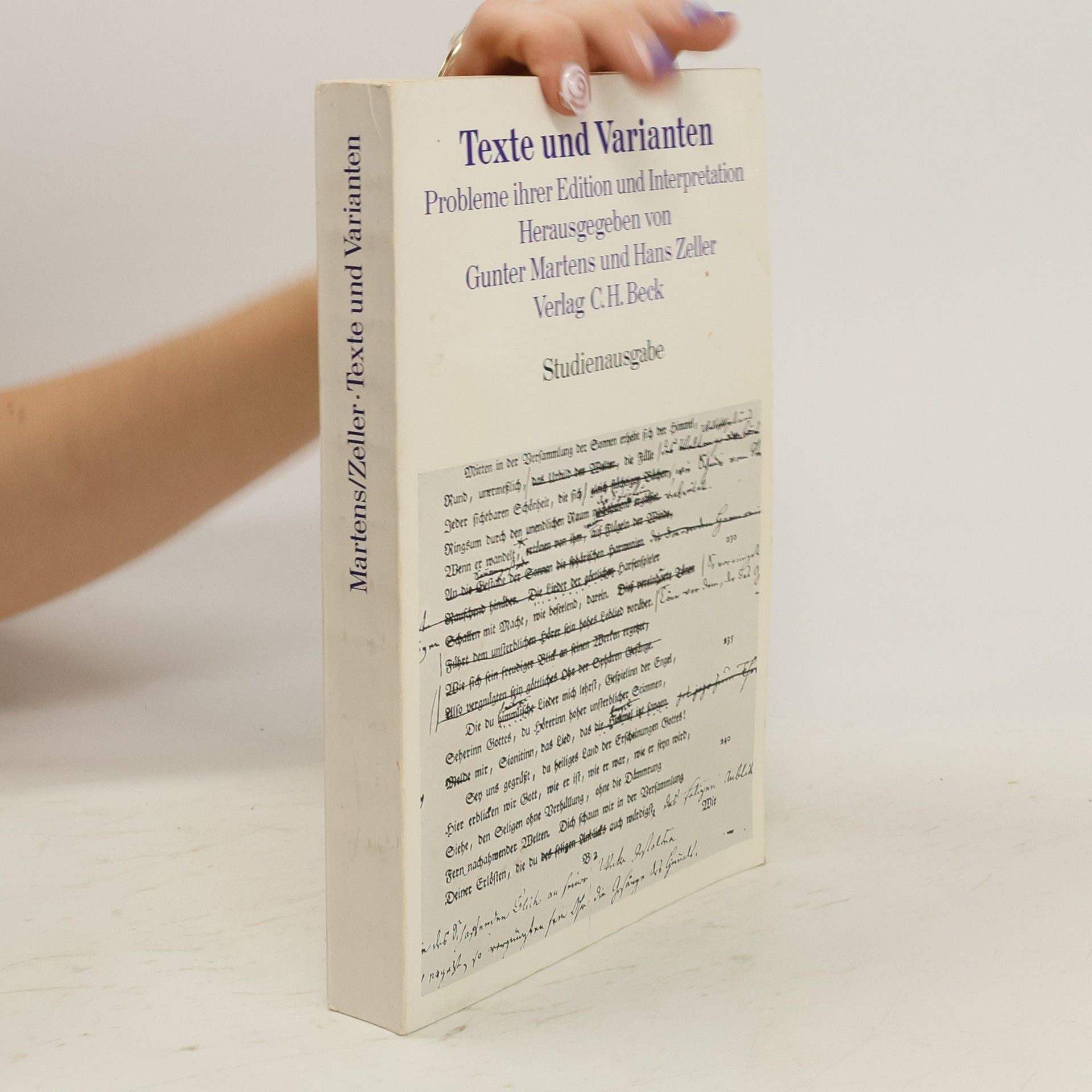
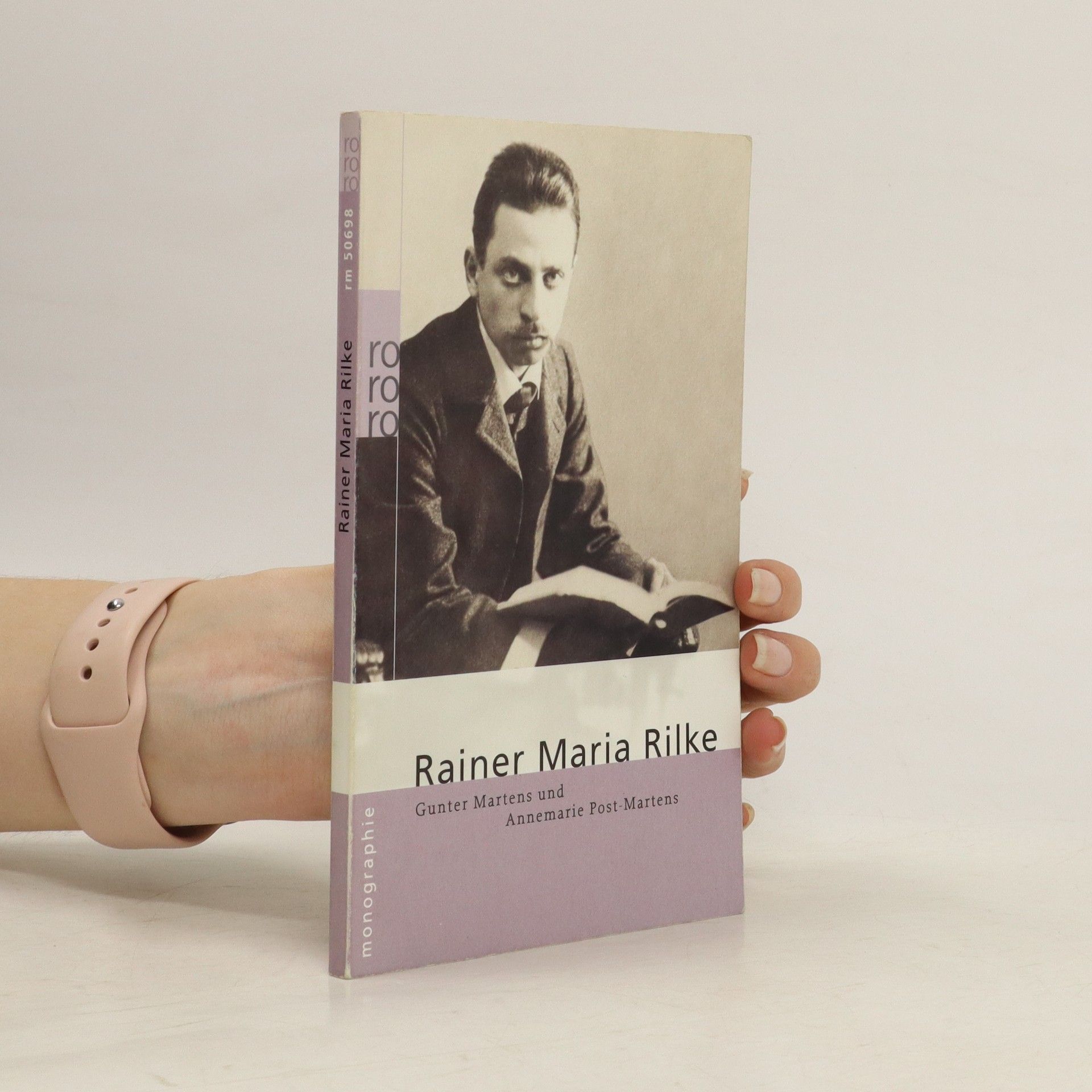
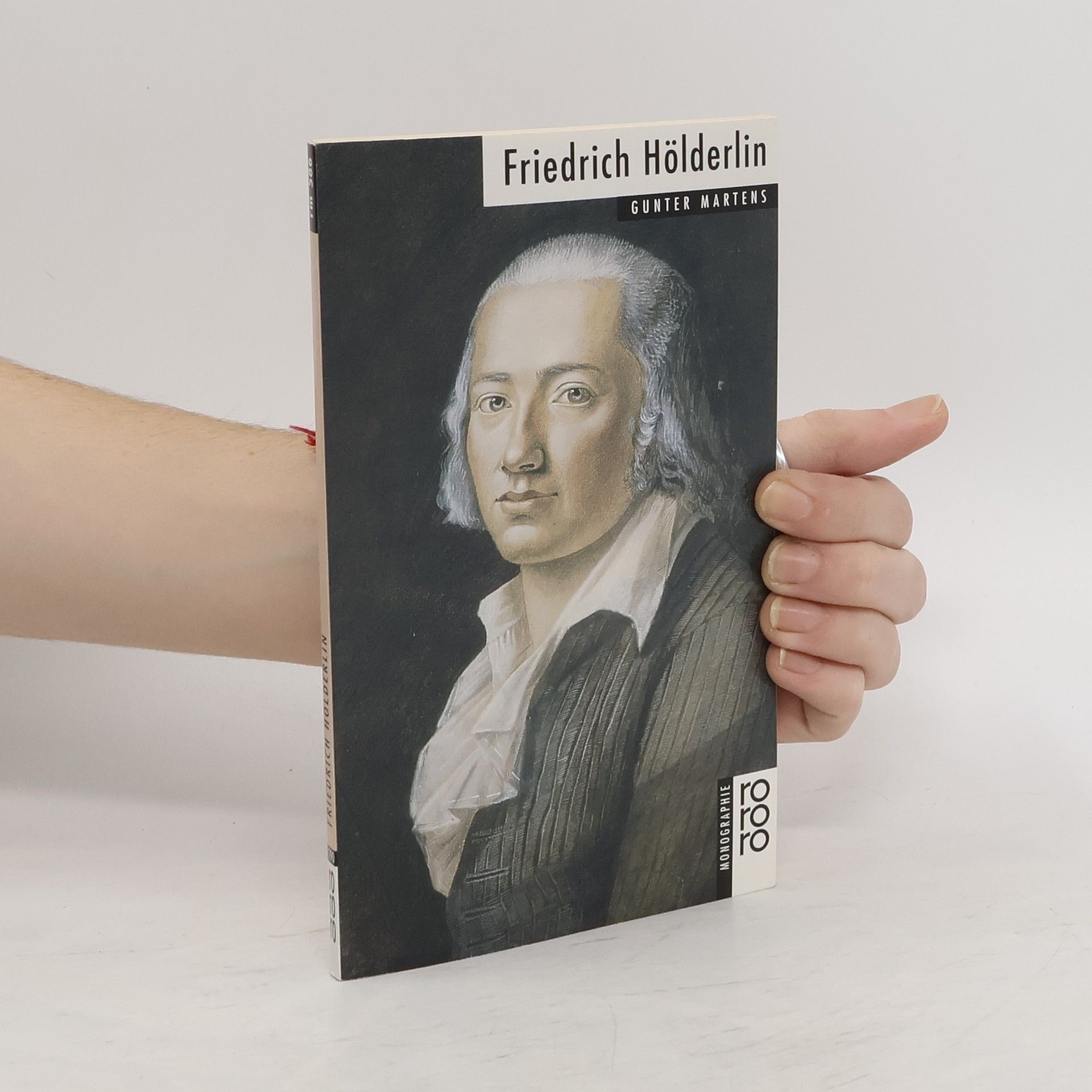

Friedrich Hölderlin war Dichten «in dürftiger Zeit» Schicksal und Beruf. Sein Ringen um eine dichterische Sprache, die kompromissloser Ausdruck einer «künftigen Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten» sein wollte, wurde nur von wenigen seiner Zeitgenossen verstanden. Bis zur letzten Erschöpfung seiner Kräfte arbeitete er an Texten, die überkommene Denk- und Schreibmuster radikal aufbrachen. Die neuen Dimensionen dieses Dichtens haben sich in ihrer weitreichenden Konsequent recht eigentlich erst in der jüngsten Moderne erschlossen.
Rainer Maria Rilke
- 160pages
- 6 heures de lecture
Rainer Maria Rilke wurde zu dem Lyriker, der "das deutsche Gedicht zum ersten Mal vollkommen gemacht hat", urteilte Robert Musil. Dieses Buch geht den Voraussetzungen und Bedingungen von Rilkes Entwicklung zum außerordentlichen Dichter nach und spürt in Biographie und Zeitgeschichte die Faktoren auf, die den Autor geprägt haben.