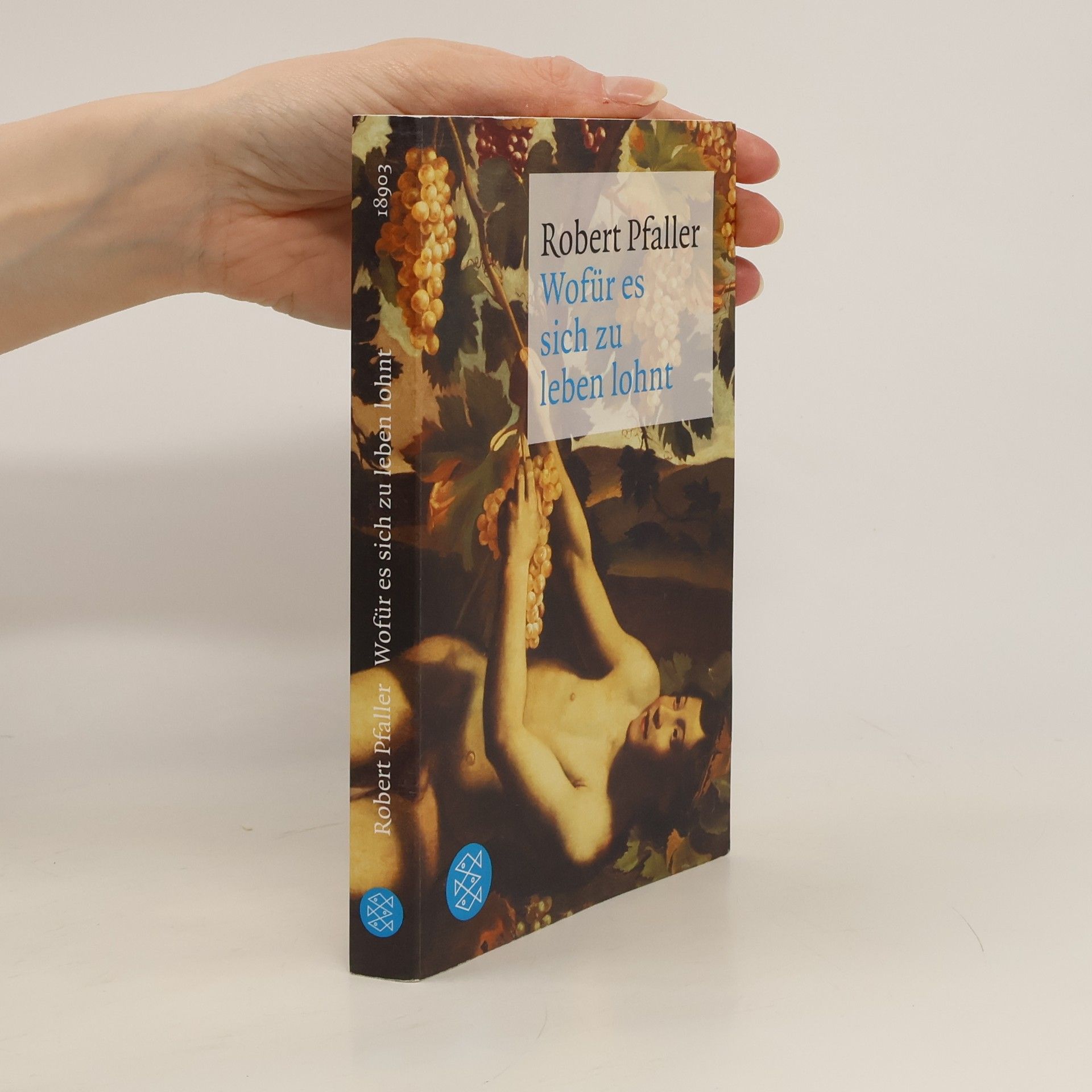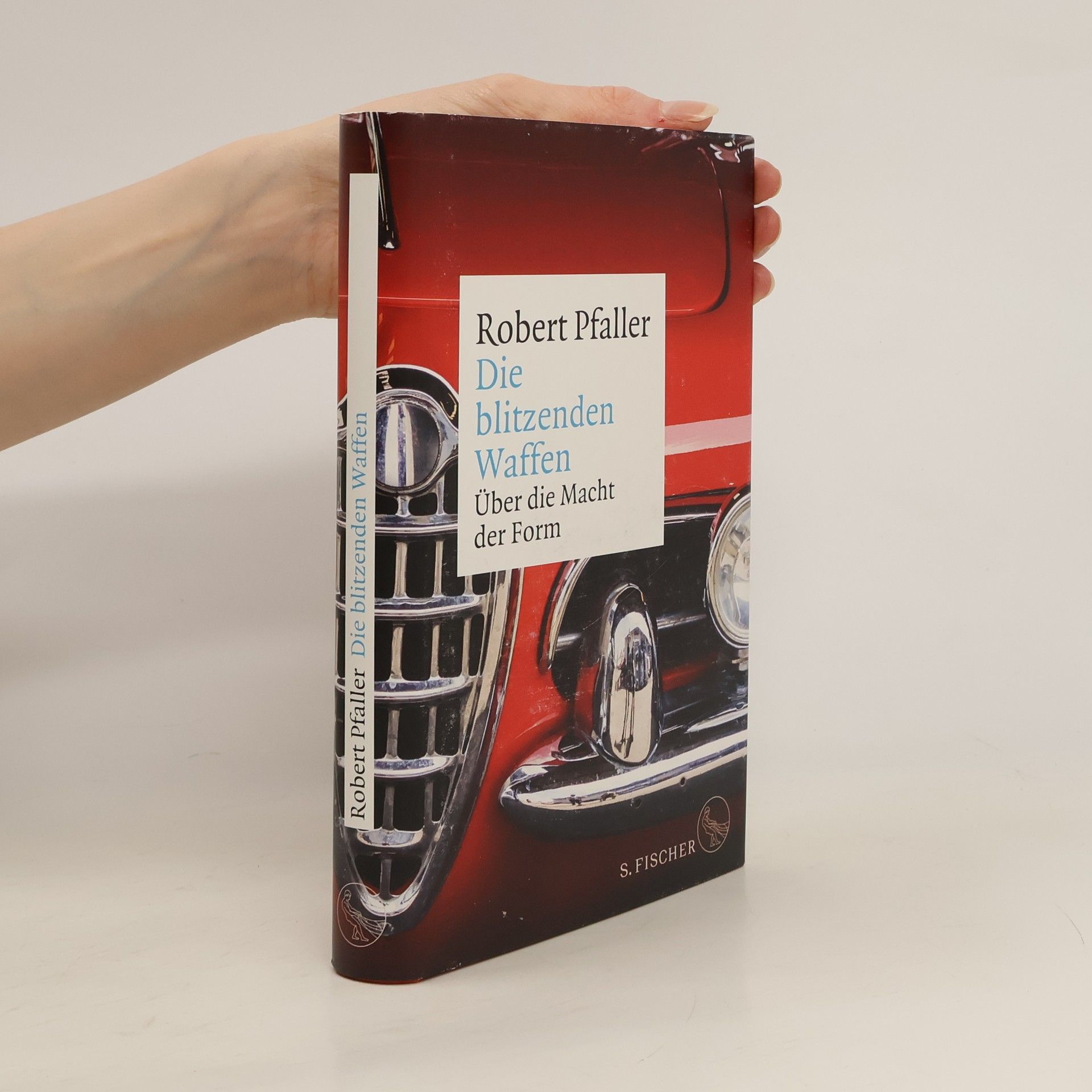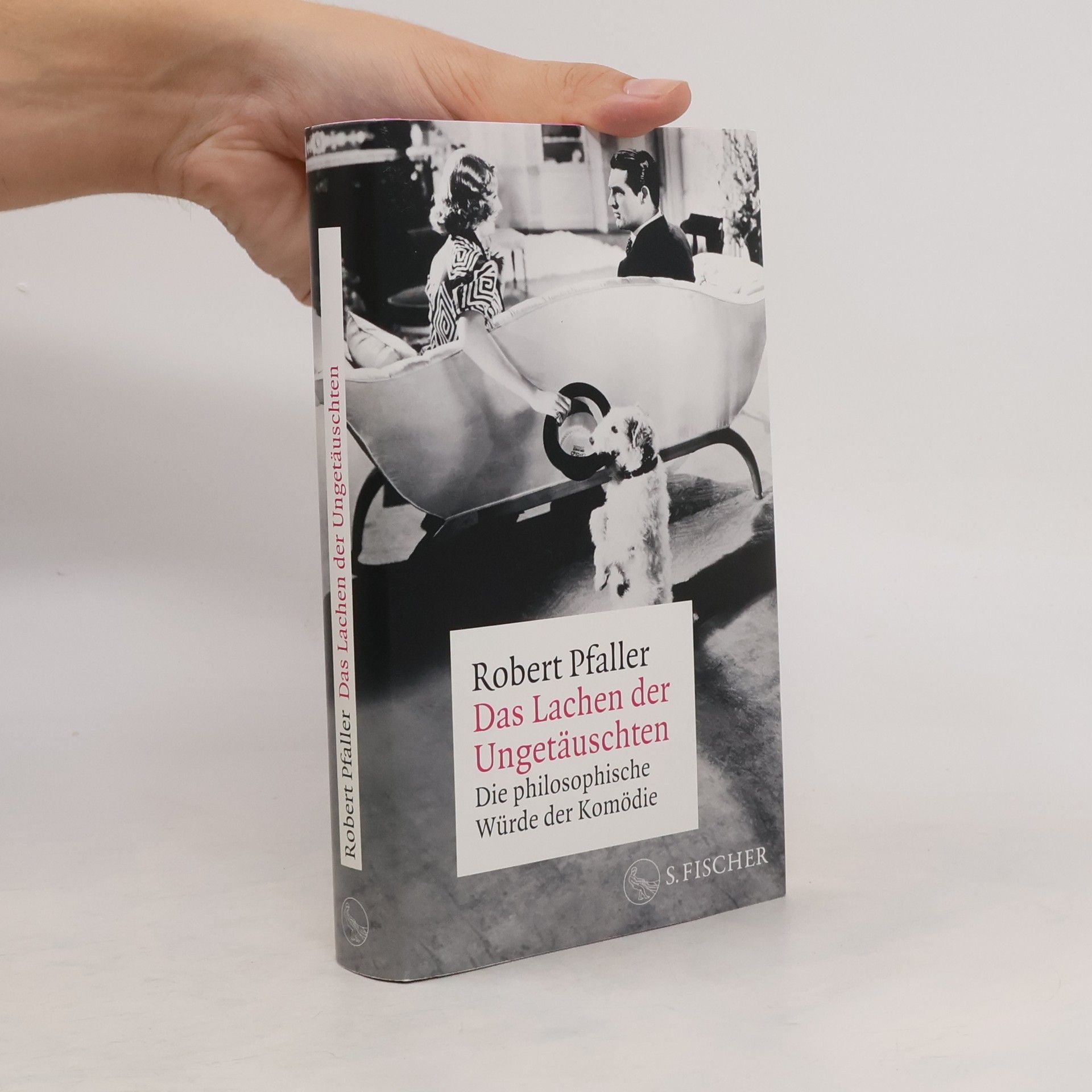Robert Pfaller Livres
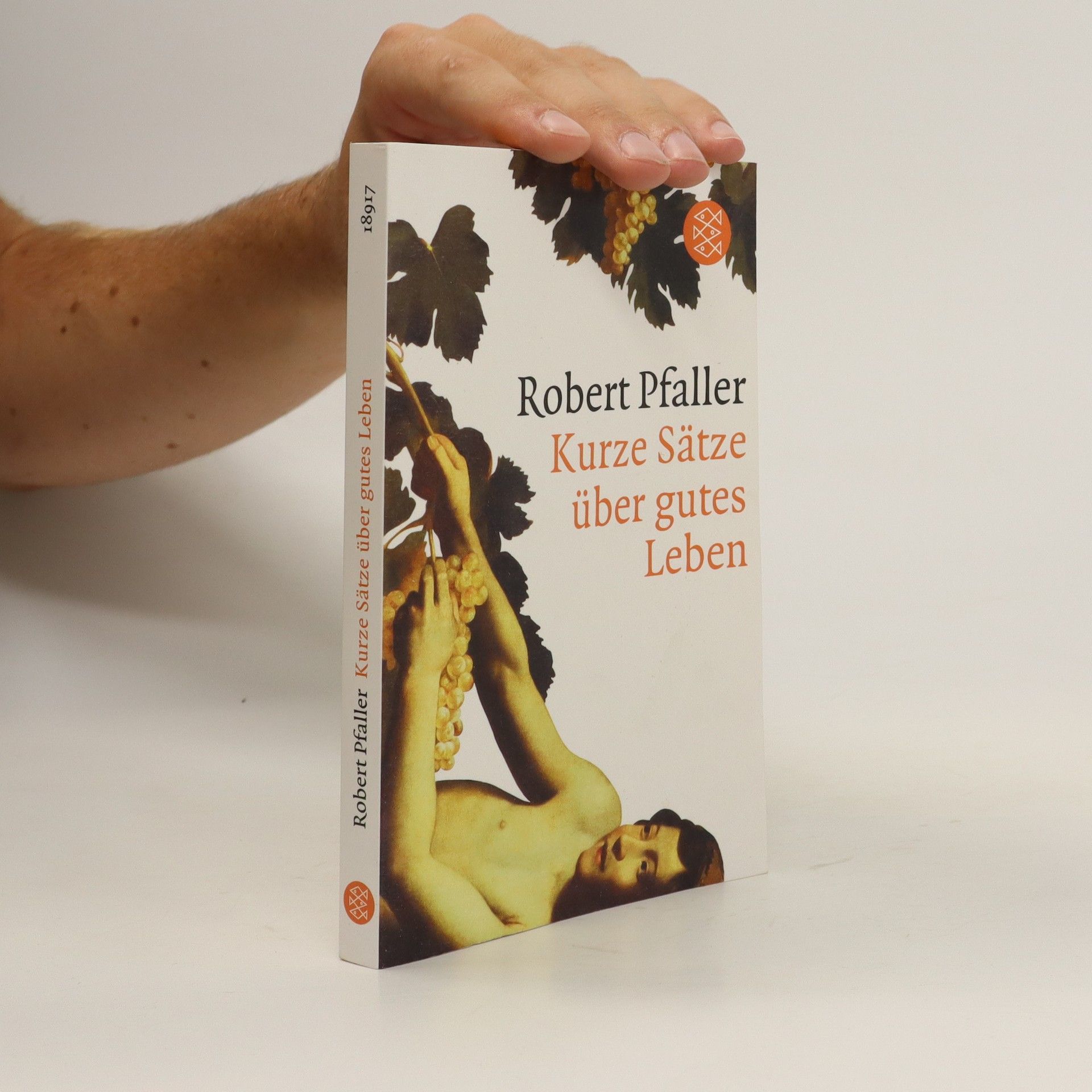

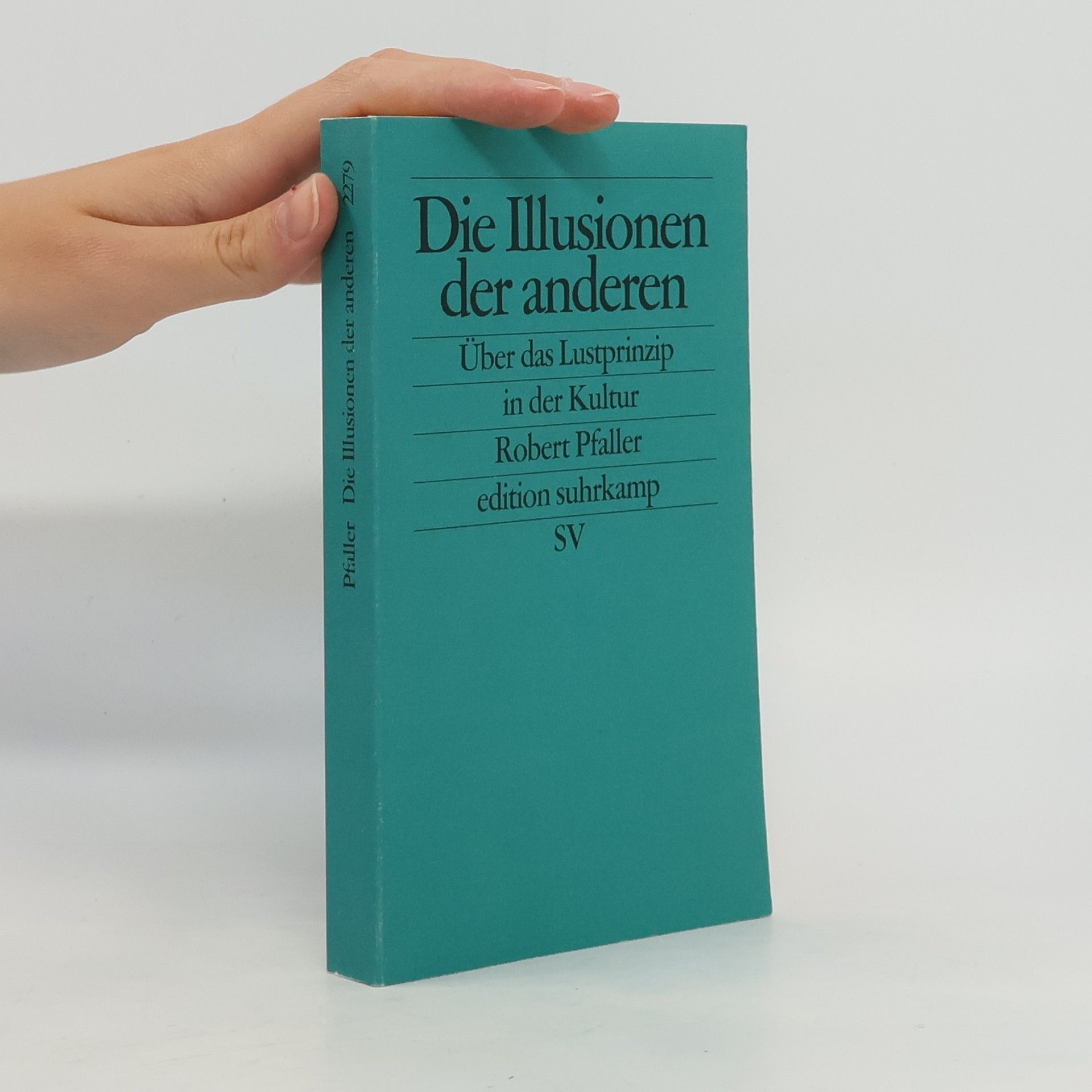

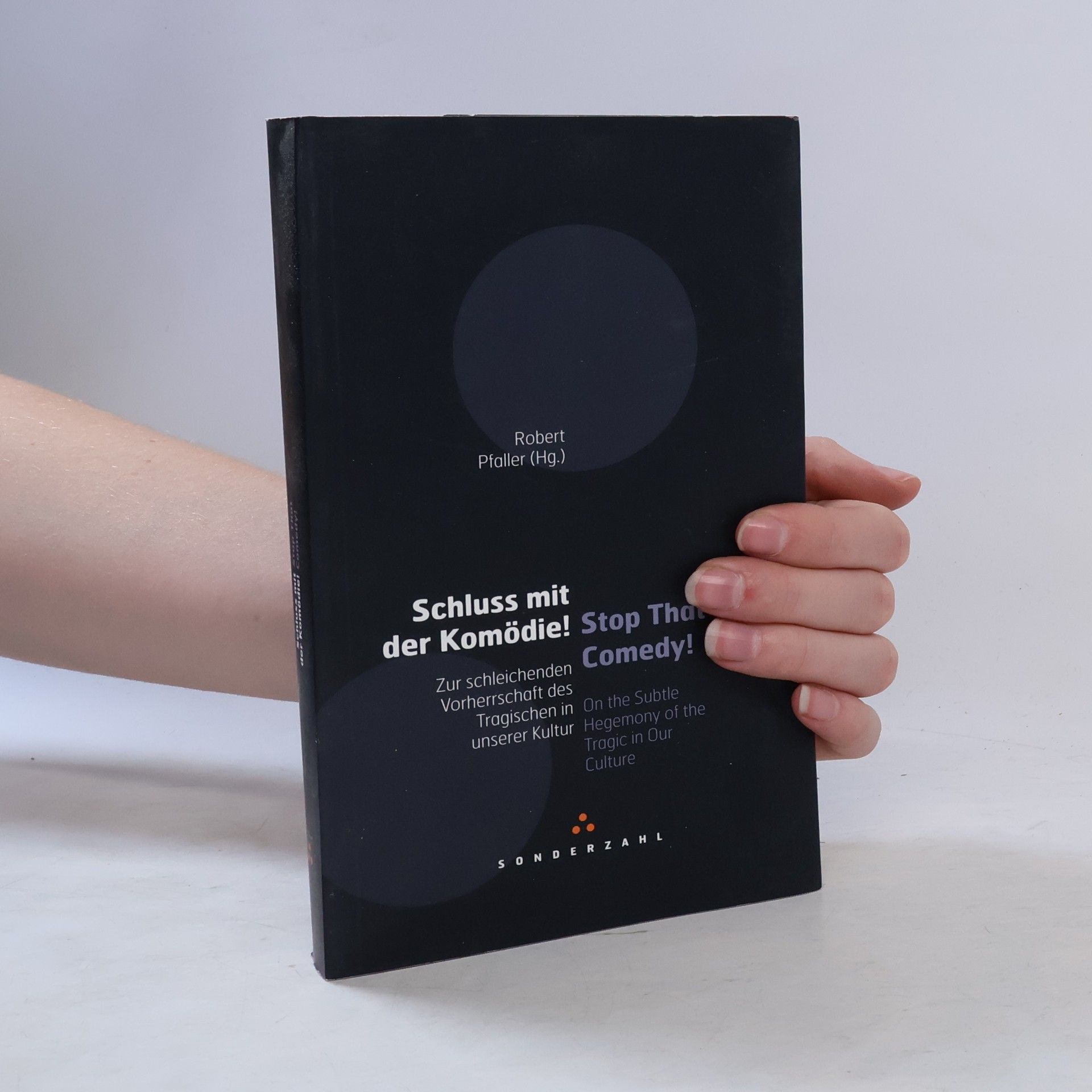

Das schmutzige Heilige und die reine Vernunft
Symptome der Gegenwartskultur
- 333pages
- 12 heures de lecture
Vieles, was noch vor wenigen Jahren als mondän galt wie z. B. das Rauchen, wird in unserer heutigen Kultur als schmutziges, gesundheitsgefährdendes Ärgernis thematisiert. Früher wurden solche Praktiken kulturell aufgehoben, indem man sie in einen Rahmen des »Heiligen« stellte. Gegen dieses »Heilige« macht nun eine Vernunft Front, die sich als »rein« versteht und die Welt entzaubern möchte.
Es gibt zwei Typen von Einbildungen: den vertrauten Typ, den Menschen stolz als ihre Überzeugungen reklamieren, und den weniger beachteten Typ, der oft anderen zugeschrieben wird. Letztere werden nie von jemandem selbst anerkannt, etwa wenn jemand nicht sagt: „Ich glaube an den Weihnachtsmann“. Diese Einbildungen existieren ohne Eigentümer und erscheinen als „Illusionen der anderen“. In dieser Studie werden sie als das allgemeine Lustprinzip in der Kultur identifiziert. Sie sind in der Kunst, Alltagskultur, Spielen, Sport, Erotik und therapeutischen Glückstechniken präsent. Überall dort, wo große Mengen an Lust entstehen, sind diese anonymen Illusionen am Werk. Die Analyse ihrer Faszinationskraft erklärt, warum sie besonders auf jene Menschen eine extreme Macht ausüben, die nicht an sie glauben. Zudem wird die kulturelle Tendenz untersucht, durch die diese eigentumslosen Einbildungen zunehmend von bekenntnishaften Überzeugungen überlagert und verdeckt werden.
Eine scharfsinnige und provokante philosophische Analyse der aktuellen gesellschaftlichen Debatte um das Thema »Shaming« von SPIEGEL-Bestseller-Autor Robert Pfaller. In der Kultur der sozialen Medien wird oft gefordert, dass sich andere schämen sollten: Großkonzerne, Steuerhinterzieher, weiße, männliche Heterosexuelle, Dicke, Hässliche, Gegner. Früher suchte man den Dialog mit Andersdenkenden; heute versucht man, sie zum Schweigen zu bringen. Scham ist ein zentrales Element, denn sie impliziert immer das Verlangen, sich zu verstecken oder zu verschwinden. Pfaller untersucht die Hintergründe dieses Phänomens und widerlegt die beiden Hauptirrtümer über Scham: Erstens die Annahme der Kulturanthropologen, dass Menschen in Schamkulturen ihr Verhalten nach den Meinungen anderer ausrichten. Zweitens die psychoanalytische These, dass Scham aus einem »Idealungenügen« resultiert, also aus Minderwertigkeitsgefühlen. Beide Auffassungen werden widerlegt. Pfaller entwickelt zudem effektivere Strategien, um aus den leidvollen Zuständen der Scham zu entkommen. Es genügt nicht, Barbiepuppen zu modifizieren oder dickere Models auf Laufstege zu schicken. Ein besseres Verständnis der Scham eröffnet neue Perspektiven und Auswege aus der Pseudo-Schamkultur. Pfallers Stärke liegt in seiner Fähigkeit, paradoxe Entwicklungen unserer Zeit prägnant zu erfassen.
Das Vademecum der Lebenskunst Nach dem großen Erfolg von Robert Pfallers Studie ›Wofür es sich zu leben lohnt‹ sind in dem vorliegenden Band alle Interviews in Originalfassung versammelt, die rund um die Themen dieses philosophischen Bestsellers kreisen: Genuss und Verbot, Rauchen und Neoliberalismus, Glück, Neid und – natürlich – die Liebe. Eine Vertiefung und Weiterentwicklung seiner Ideen, aber auch eine Einführung in Robert Pfallers Gedankenwelt.
Wofür es sich zu leben lohnt
Elemente materialistischer Philosophie
Ein Leben, welches das Leben nicht riskieren will, beginnt unweigerlich, dem Tod zu gleichen. Unsere Kultur hat sich den Zugang zu Glamour, Großzügigkeit und Genuss versperrt – wir vermeintlich abgebrühten Hedonisten rufen schnell nach Verbot und Polizei, beim Rauchen, Sex, schwarzen Humor oder Fluchen. Alles Befreiende oder Mondäne dieser Praktiken geht dabei verloren. Robert Pfaller untersucht in seinem Buch, warum es so gekommen ist und was sich dahinter verbirgt. In Analysen u. a. zum pornographischen Pop, zum schmutzigen Frühling, zu Tischmanieren, zu »meinem« Geschmack und zum Scheitern entlarvt er die aktuellen Tendenzen der Kultur und benennt ihren politischen Preis. »die feinste philosophische Waffe für Hedonisten gegen die Puritaner«Helmut A. Gansterer »Pfallers Analyse ist so klug wie witzig… Ein überraschendes Lese- und Denkvergnügen.«Eva Menasse, Die Welt
Erwachsenensprache
Über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur
Überall wird im öffentlichen Diskurs heute auf Befindlichkeiten Rücksicht genommen: Es werden vor Gefahren wie »expliziter Sprache« gewarnt, Schreibweisen mit Binnen-I empfohlen, dritte Klotüren installiert. Es scheint, als habe der Kampf um die korrekte Bezeichnung und die Rücksicht auf Fragen der Identität alle anderen Kämpfe überlagert. Robert Pfaller, Autor des Bestsellers »Wofür es sich zu leben lohnt«, fragt sich in »Erwachsenensprache. Über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur«, wie es gekommen ist, dass wir nicht mehr als Erwachsene angesprochen, sondern von der Politik wie Kinder behandelt werden wollen. Steckt gar ein Ablenkungsmanöver dahinter? Eine politische Strategie? Es geht darum, als mündige Bürger wieder ernst genommen zu werden – doch dann sollten wir uns auch als solche ansprechen lassen.
Die blitzenden Waffen
Über die Macht der Form
Ein ebenso glänzender wie scharfsinniger Beitrag zur jahrtausendealten Debatte über Wesen und Form, Essenz und Oberfläche, Argument und Rhetorik Warum lieben wir bestimmte Autos – und oft nicht die nützlichsten? Warum berührt uns ein bestimmtes Kunstwerk, während andere uns kalt lassen? In welchen Worten muss ein guter Ratschlag formuliert sein, damit er beim Gegenüber Wirkung zeigt? In seinem neuen Buch untersucht der Philosoph Robert Pfaller Funktion, Bedingung und Wirkungsweise der Form, um ihrem Geheimnis auf die Spur zur kommen – ihrer Macht. Schon Quintilian wusste: »Ein Redner muss nicht nur mit scharfen Waffen kämpfen, sondern auch mit blitzenden.« Robert Pfaller geht einen Schritt weiter: Er erklärt, warum überhaupt nur blitzende Waffen scharf sein können. Der Bestseller-Autor von »Erwachsenensprache« und »Wofür es sich zu leben lohnt« räumt auf mit unserer Vorstellung, wir würden uns von Oberflächen nicht täuschen lassen und direkt in die Tiefe der Dinge blicken. Stattdessen postuliert Robert Pfaller ein sehr viel komplexeres Beziehungsgefüge: die Dialektik von Form und Inhalt.
»Die Komödie handelt vom Gelingen des Großartigen.« Robert Pfaller Lachen, Humor, Komik : Das scheint nur dem Menschen eigen. So eigen, dass er daraus eine Kunstform machte – die Komödie. Doch was bringt uns zum Lachen und warum? Welche Rolle spielen das Politische, Gesellschaftliche, Anständige und Unanständige dabei? Was sagen Freud und Lacan dazu? In den hier versammelten Texten geht der Philosoph Robert Pfaller der Würde der Komödie nach und fragt nach dem Lachen der Ungetäuschten. Mit Hilfe von Filmen wie denen von Ernst Lubitsch oder Serien wie » Sex and the City « untersucht er den Zusammenhang zwischen Komödie und dem Unheimlichen , dem Materialismus , der Sexualität und Polygamie , erklärt, was das Unter-Ich damit zu tun haben könnte und wo das Genießen zu finden ist. Eine so überraschende wie unterhaltsame Theorie der Komödie.