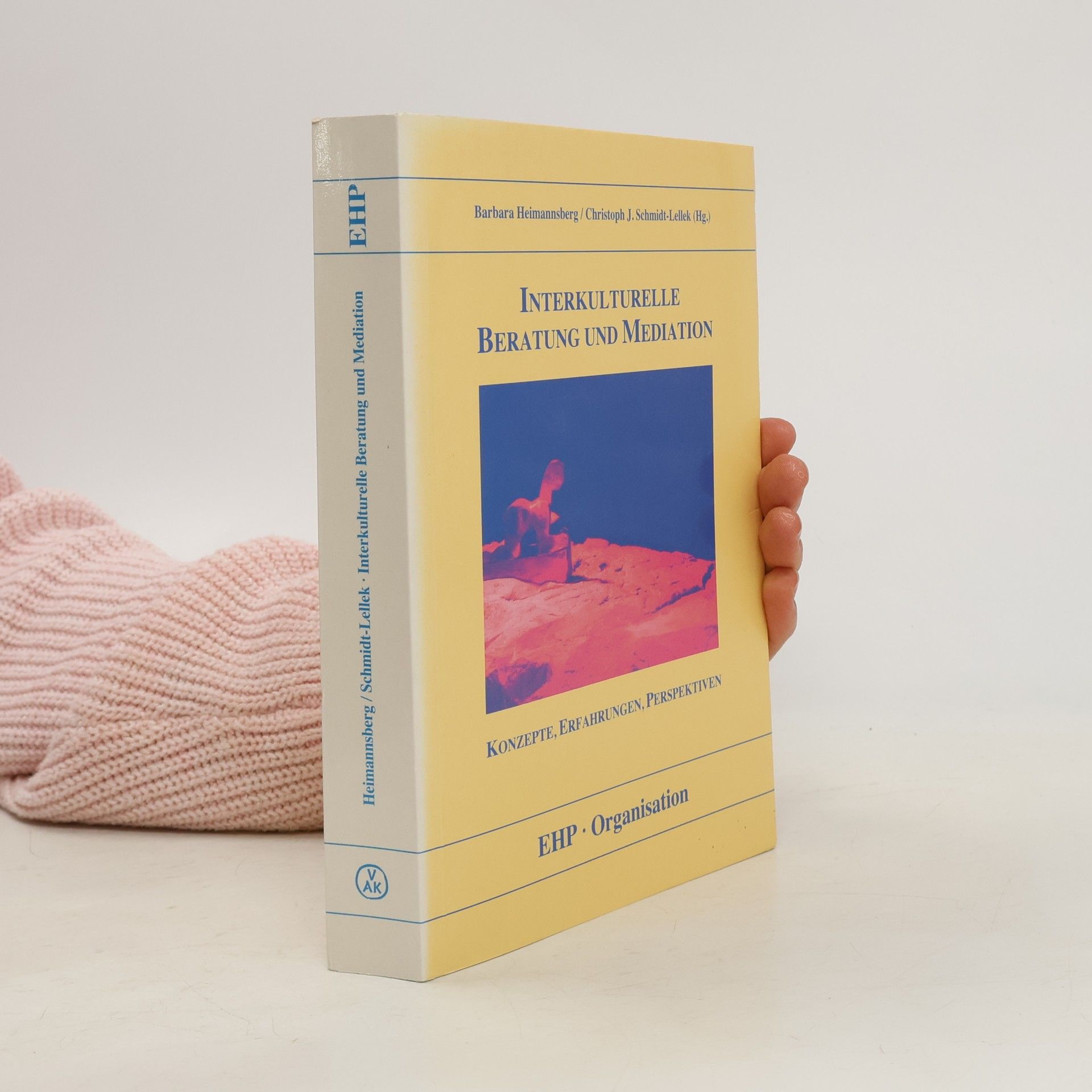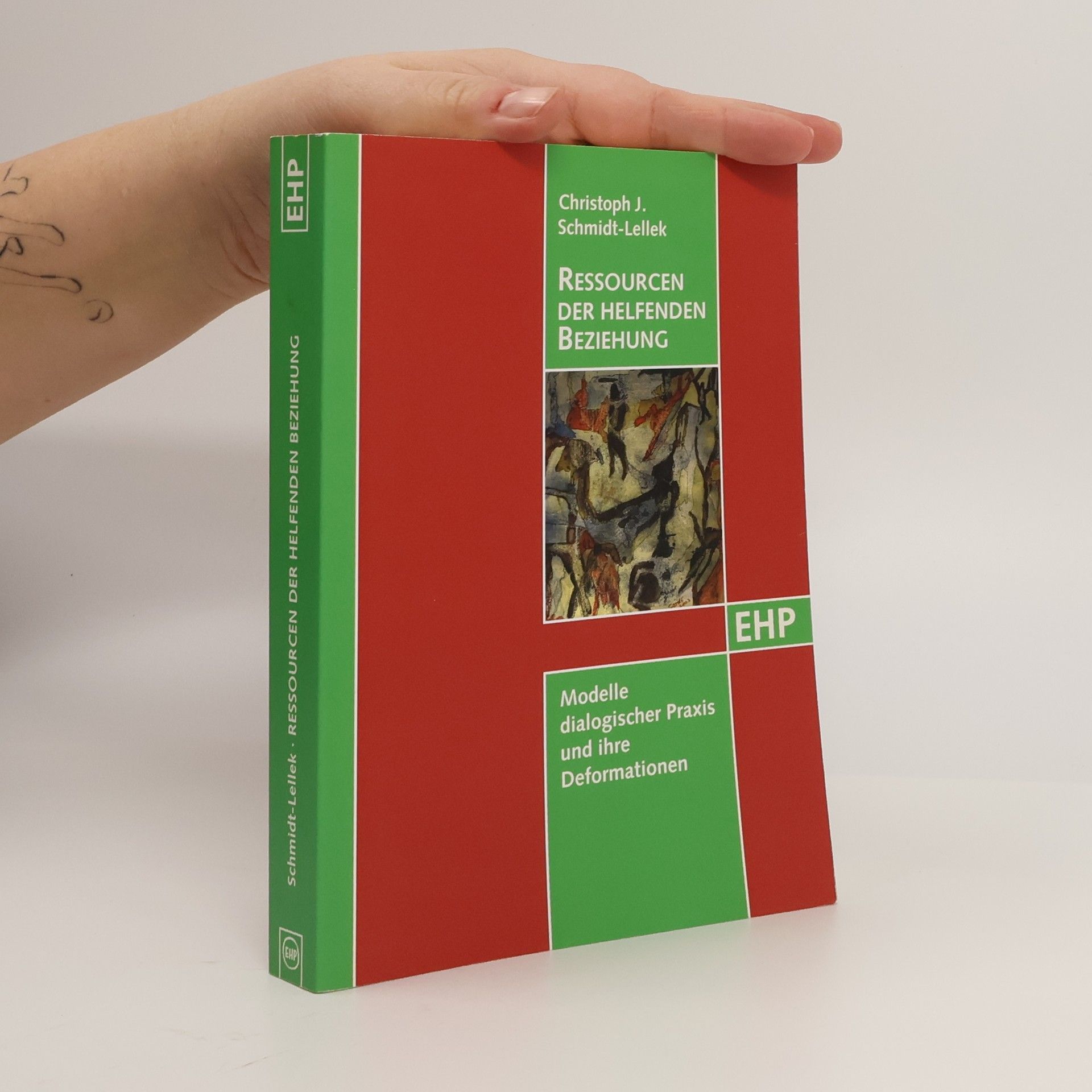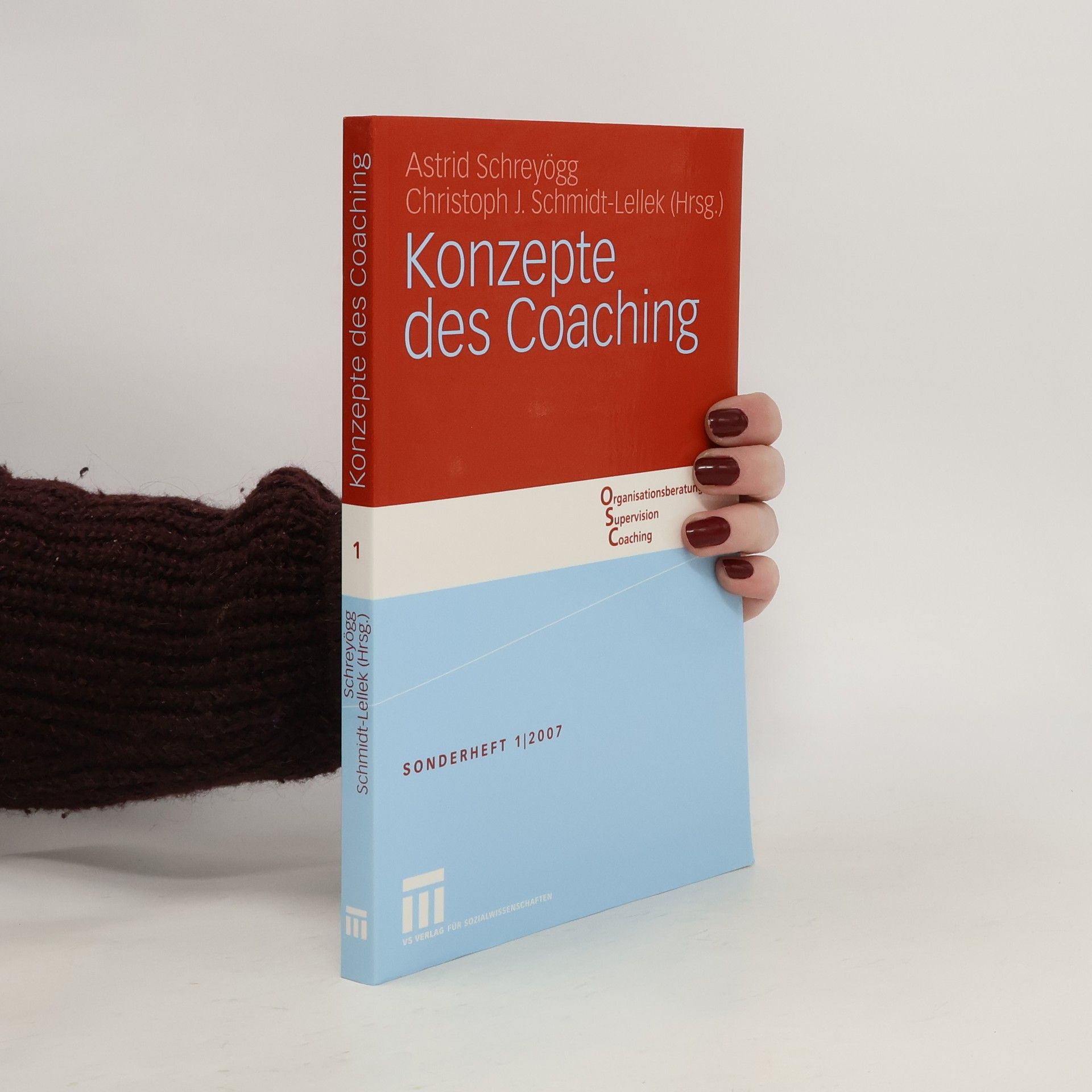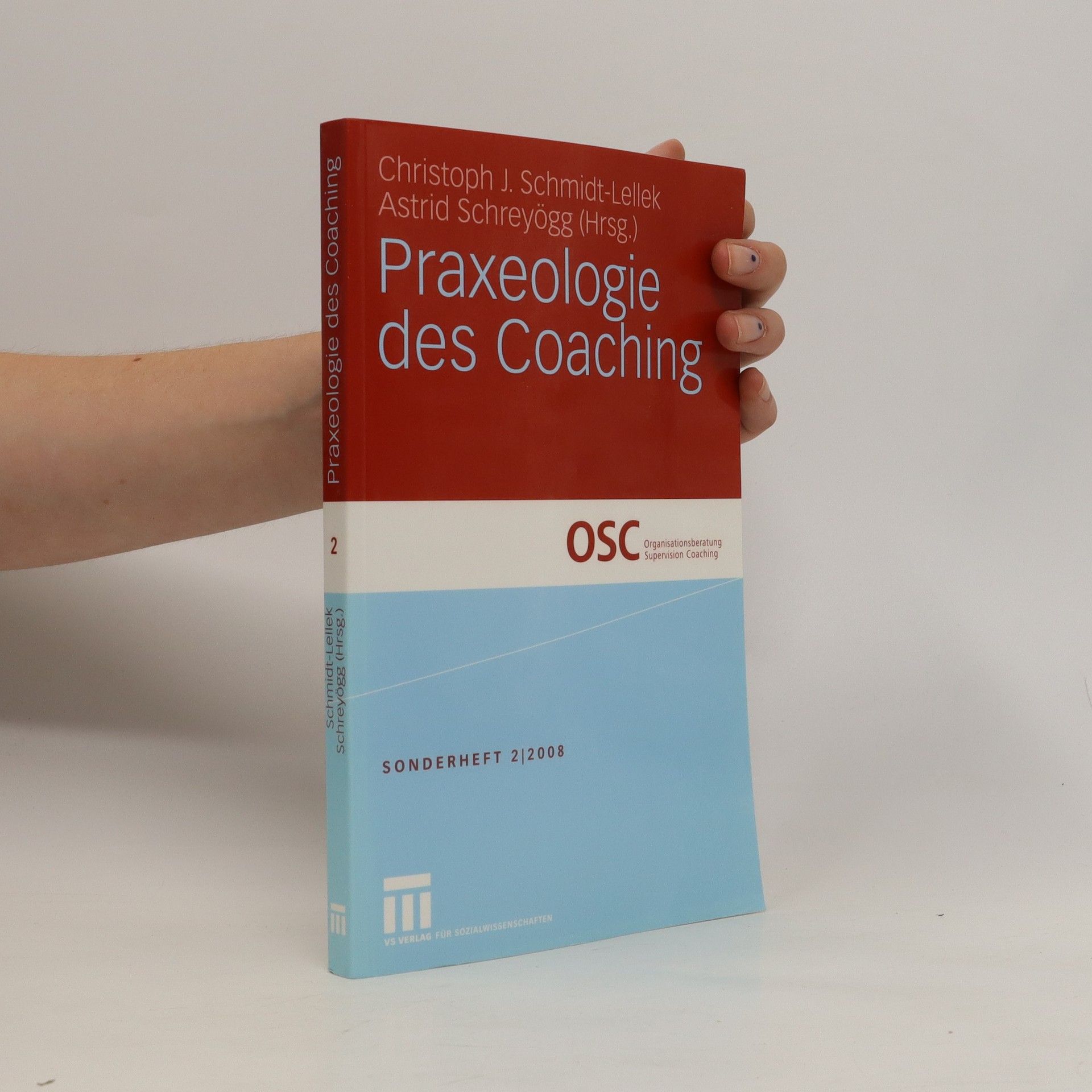Praxeologie des Coaching
- 258pages
- 10 heures de lecture
Dieses Buch präsentiert Aufsätze zur Coaching-Praxis. Im Sinne einer Praxeologie wird ein konzeptioneller Rahmen für unterschiedliche diagnostische Ansätze und unterschiedliche methodische Maßnahmen umrissen. Im ersten Teil werden zunächst Eckpfeiler für eine Praxeologie des Coaching dargestellt. Das Fazit lautet: Coaching sollte sich nicht auf einen einzigen Methodenansatz gründen, sondern auf eine Vielzahl von Diagnose- und Methodenkonzepten, die allerdings zu konzeptionell fundierten „Integrationsansätzen“ zu verschmelzen sind. Nach diesen programmatischen Aufsätzen finden sich im zweiten Teil etliche Diagnosekonzepte als Basis für die Methodenanwendung im Coaching. Der dritte Teil enthält Beiträge von Autoren, die ihrer Arbeit spezifische Verfahren, meistens aus dem Bereich der Psychotherapie, unterlegen. In den Beiträgen des letzten Abschnitts wird von Coaching aus Milieus berichtet, in denen diese Arbeitsform noch ein Novum darstellt, wie z. B. Coaching im Journalismus, in der Hochschule oder in Anwaltskanzleien.