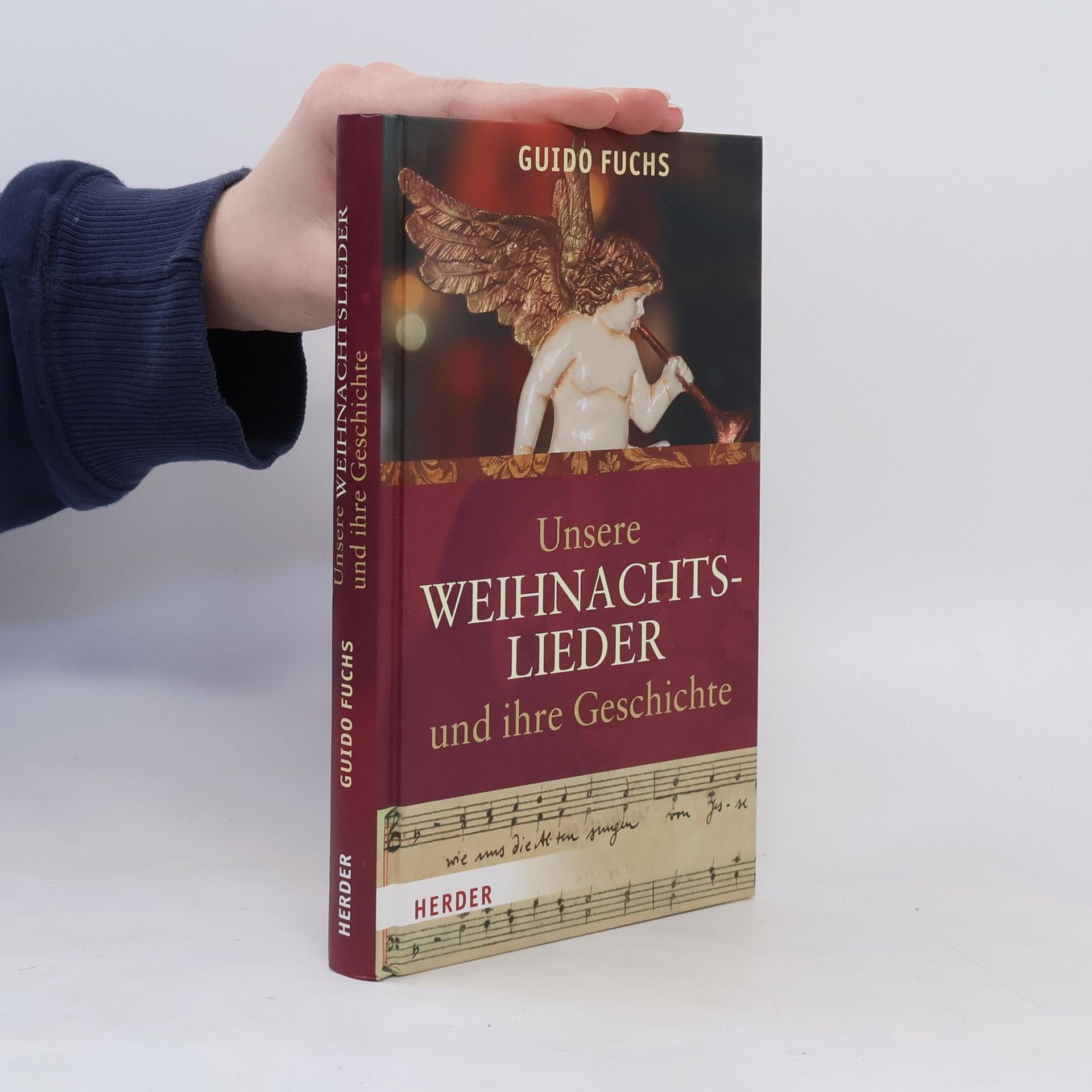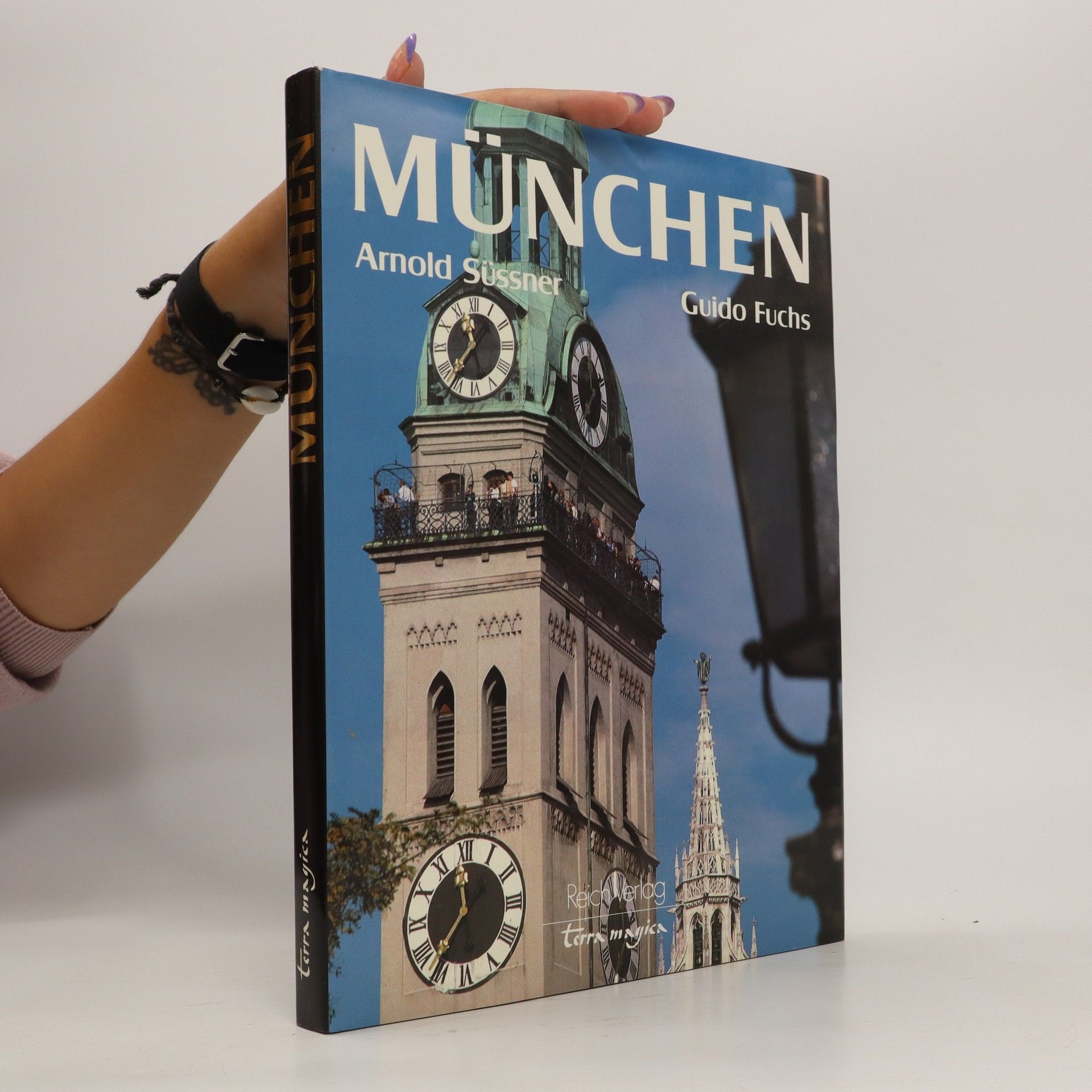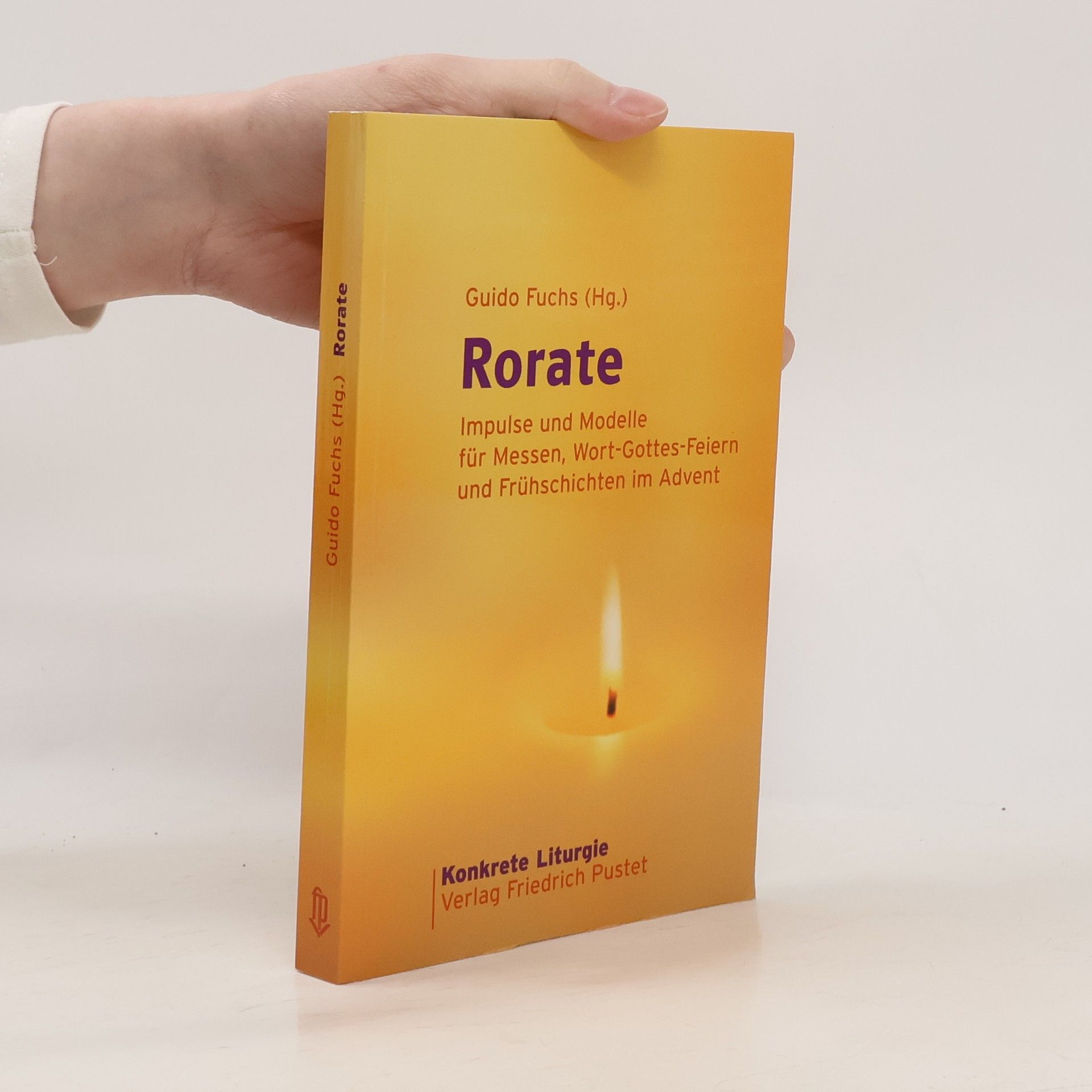Von »Attrappenonkel« über »Die Bierschaumgeborene« und »Tschick« bis »Ziegen-Böck«: In der Literatur finden sich zahlreiche Spitznamen. Sie bringen oft auf den Punkt, was die Leute von einer Person halten oder wie sie wirkt – ähnlich einer Karikatur, die das Charakteristische eines Menschen zugespitzt zeigt. Sie können liebenswürdig-heiter sein, aber auch boshaft und verletzend. Guido Fuchs hat literarische Beispiele gesammelt und beleuchtet sie in diesem Buch in verschiedenen Zusammenhängen: Wie entsteht ein Spitzname, wer kommt auf ihn und spricht ihn erstmals aus? Wie geht jemand damit um? Wen darf man mit Spitznamen versehen und was geht wann gar nicht? Eine amüsante Zusammenschau von fast 300 Spitznamen in einem längst überfälligen Buch. Warnung: Dieses Buch enthält Spuren inkorrekter Sprache und kann zu herzhaftem Gelächter führen.
Guido Fuchs Livres


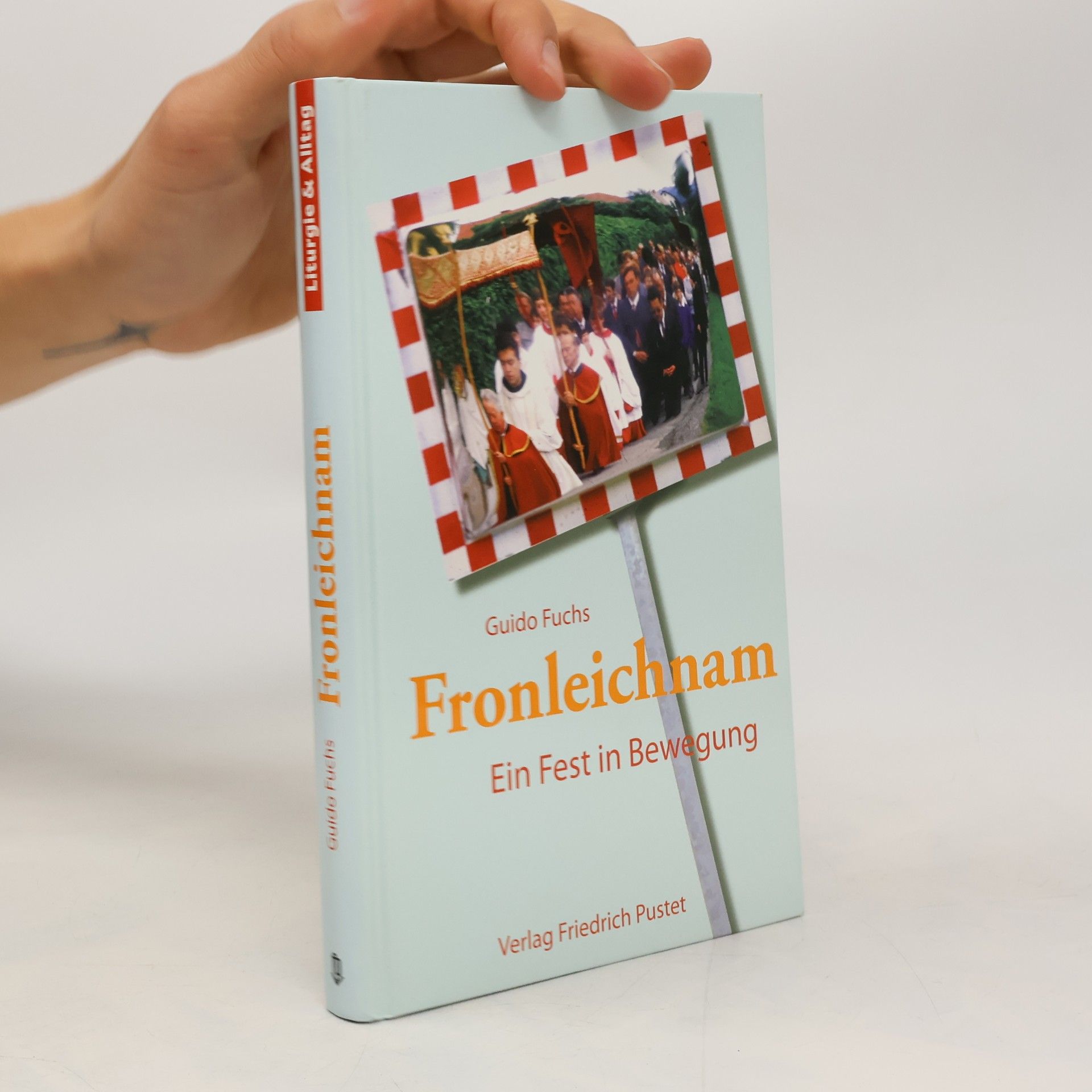
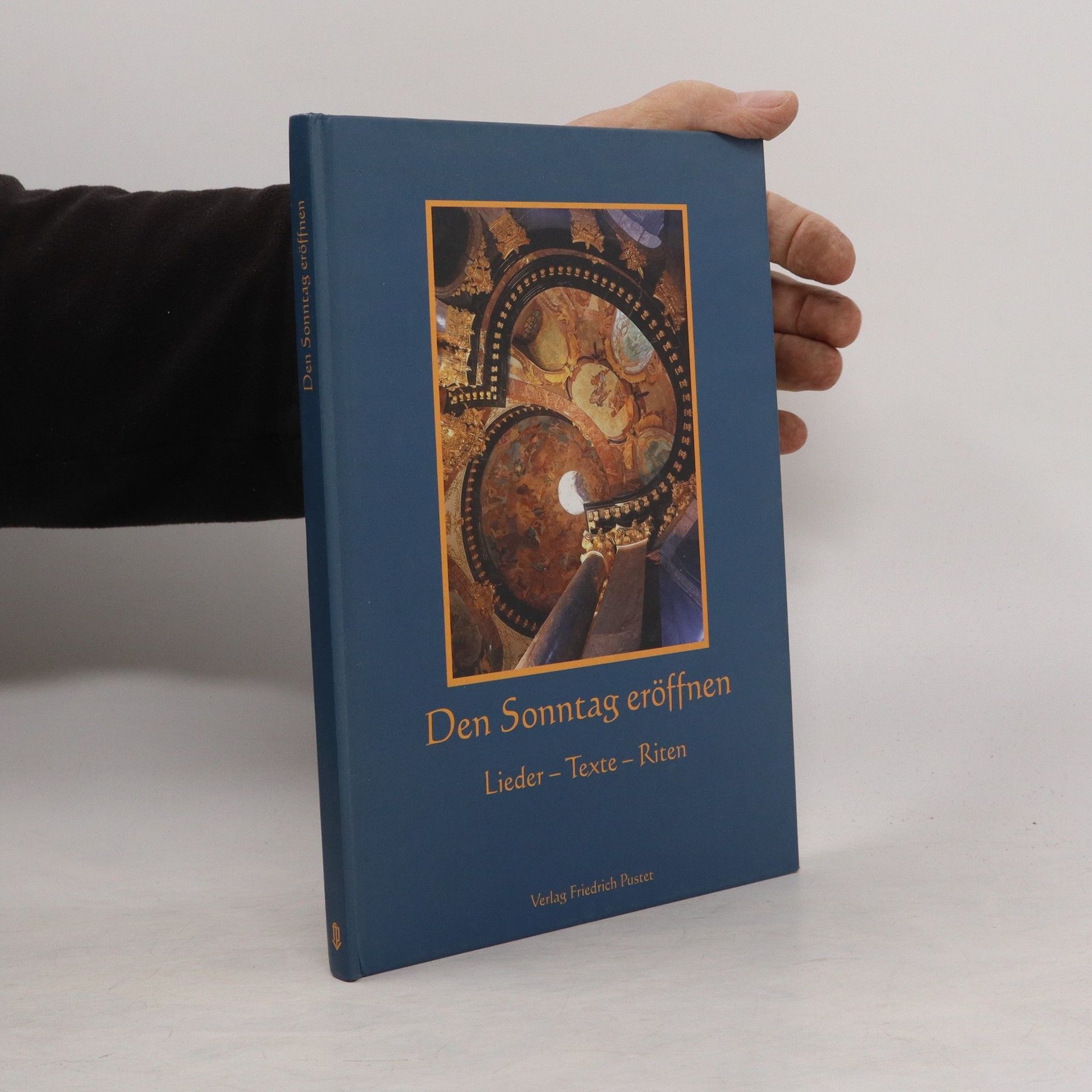
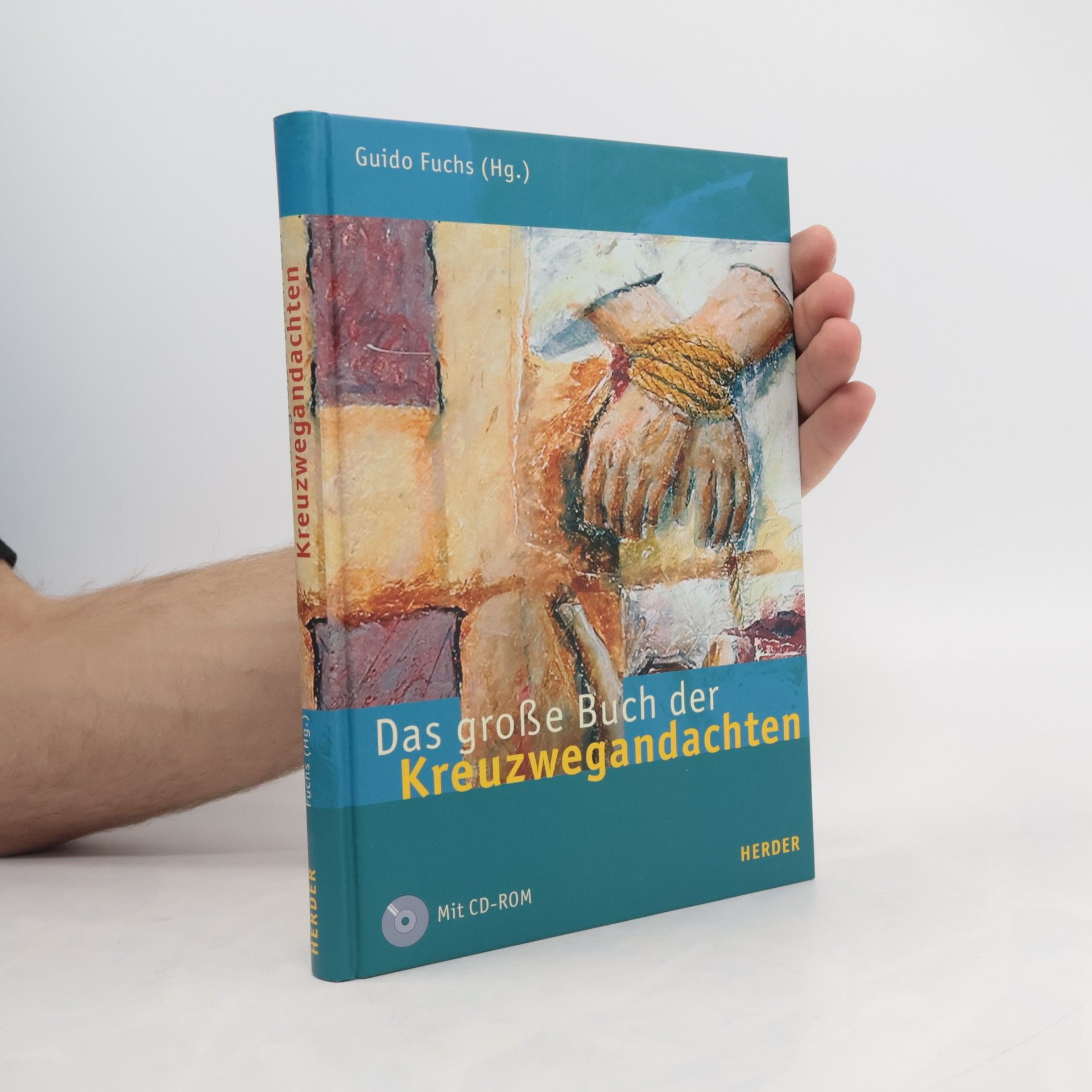

Das grosse Buch der Kreuzwegandachten
- 192pages
- 7 heures de lecture
Der Sonntag fängt am Samstag an ... Dieser auf die jüdische Ordnung des Tages zurückreichende Brauch hat zu verschiedenen liturgischen Feierformen geführt. In jüngster Zeit wird vielfach eine "Eröffnung des Sonntags" vorgeschlagen: Wie die "Begrüßung des Sabbat" wird der Beginn dieses besonderen Tages der Woche am Vorabend mit Liedern und Gebeten, mit Psalmen und Lesungen, mit Licht- und Weihrauchriten gefeiert, die so den Samstagabend als "Sonnabend" erfahrbar machen. Die "Eröffnung des Sonntags" kann sowohl als Eröffnungsteil der Vorabendmesse oder eines Wortgottesdienstes, in Verbindung mit der Ersten Vesper oder als eigenständige Feier gestaltet werden. Die zwölf neueren Sonntagslieder des Buches lassen sich auch in der Liturgie am Sonntag verwenden und bringen dessen verschiedene Bedeutungen zum Ausdruck. Die beigefügte CD-ROM enthält alle Materialien für die Eröffnung des Sonntags: Lieder mit Noten und Texten, Psalmen, Gebete u. a.; Ablaufpläne und Gestaltungsvorschläge für die einfache und schnelle Gestaltung von Liedblättern für die Gemeinde. Klangdateien sind bei der Auswahl hilfreich.
Eine kritische und praxisnahe Auseinandersetzung mit dem Hochfest Fronleichnam. Der Autor bündelt Argumente für und gegen das Fest, beleuchtet seine Entstehung und die veränderten Gegebenheiten. Er bietet Gemeinden wertvolle Impulse, um das Fest zukunftsfähig zu gestalten.
„Einen sah ich sterbend in das Leben gehen …“ – der Theologe und Dichter Lothar Zenetti hat die Mitte des christlichen Glaubens in dieses paradoxe Bild geft. Die Feiern der Tage, die den Weg Jesu in den Tod und in das Leben alljährlich vergegenwärtigen, gehören zu den ältesten Gottesdiensten der Kirche. In ihnen haben sich viele Texte, Riten und Gebräuche erhalten, die sie einzigartig und unverwechselbar machen, die aber nicht immer einfach nachzuvollziehen und zu verstehen sind.Dieses Buch bietet eine kurze geschichtliche Darstellung dieser Feiern und eine Beschreibung ihrer liturgischen Abläufe. Es erschließt aber auch ihre Theologie, die nicht nur an den historischen Geschehnissen in Jerusalem orientiert ist, sondern die unmittelbar daran Beteiligten mit in den Blick uns selbst.
In der Kirche benimmt man sich anders als im Wirtshaus oder auf dem Markt. Aber was ist angemessenes Verhalten in einem Gotteshaus? Die Frage stellt sich nicht erst, seit Kirchen mehr wegen ihrer Kunstschätze als zum Gottesdienst besucht werden. Durch die Jahrhunderte hindurch wird schlechtes Benehmen in der Kirche lautes Schwätzen, Schlafen während der Predigt, freizügige Kleidung, Rauchen, Schnupfen, Tabak kauen, das Mitbringen von Tieren … Was sind die Hintergründe solchen Unwissenheit oder religiöses Desinteresse? Auflehnung gegen die (kirchliche) Obrigkeit bzw. gesellschaftliche Normen oder einfach nur menschliche Schwäche? Findet man das nur "im Volk" oder auch bei den liturgischen Diensten? Wer klärt über angemessenes Benehmen auf und wie geschieht das? Inwieweit trägt die Liturgie selbst dazu bei, dass Menschen sich nicht immer der Feier gemäß verhalten?
Guido Fuchs erzählt in journalistisch unterhaltsamem Stil Geschichten, Hintergründe und Anekdoten zu Weihnachtsliedern von den ersten Jahrhunderten des Christentums bis heute. Dabei geht er mit viel Tiefgang auf die Suche nach der je eigenen Botschaft der Lieder in ihrer Zeit - und bringt dabei immer wieder ganz neue und unerwartete Zusammenhänge ans Licht.
Rorate
Impulse und Modelle für Messen, Wort-Gottes-Feiern und Frühschichten im Advent