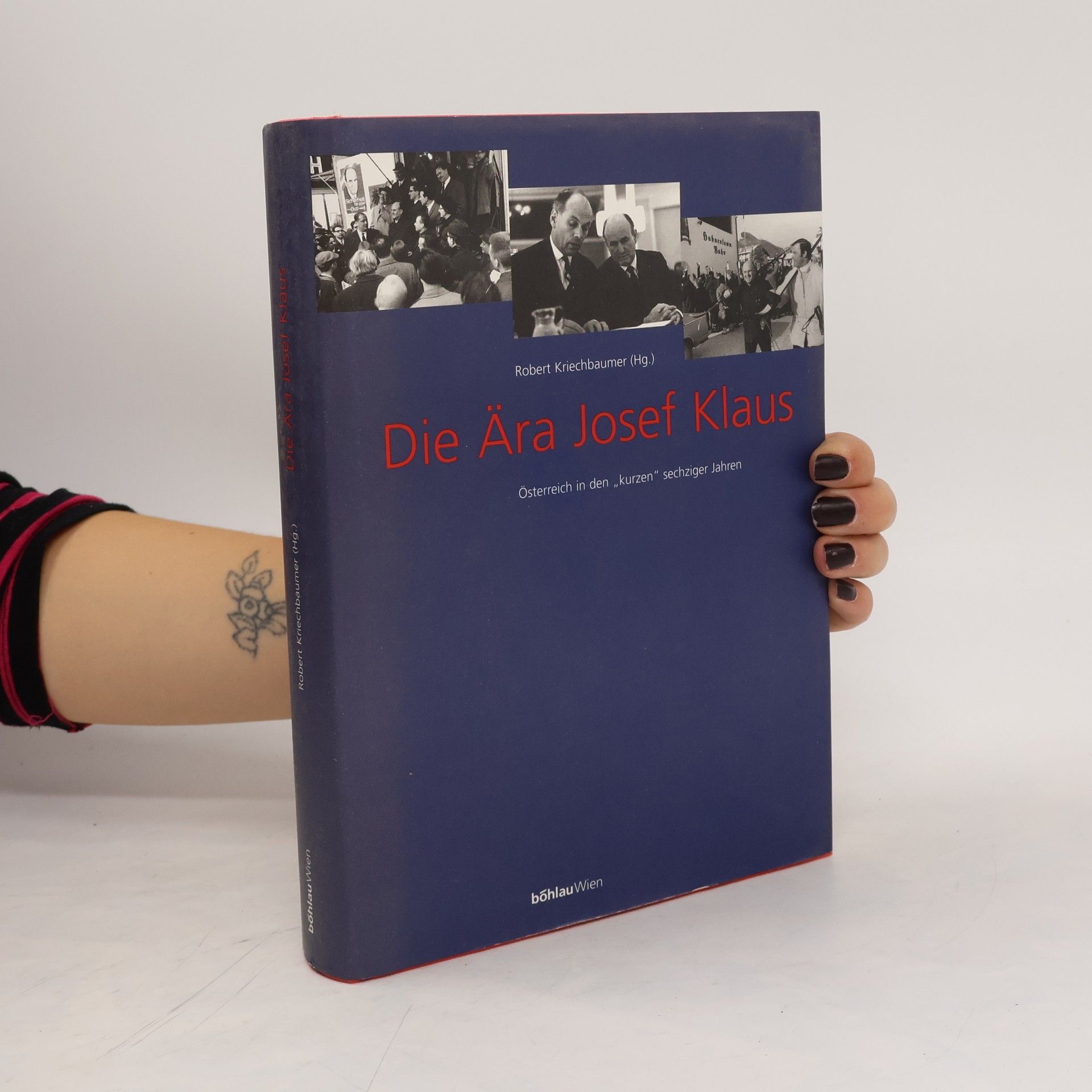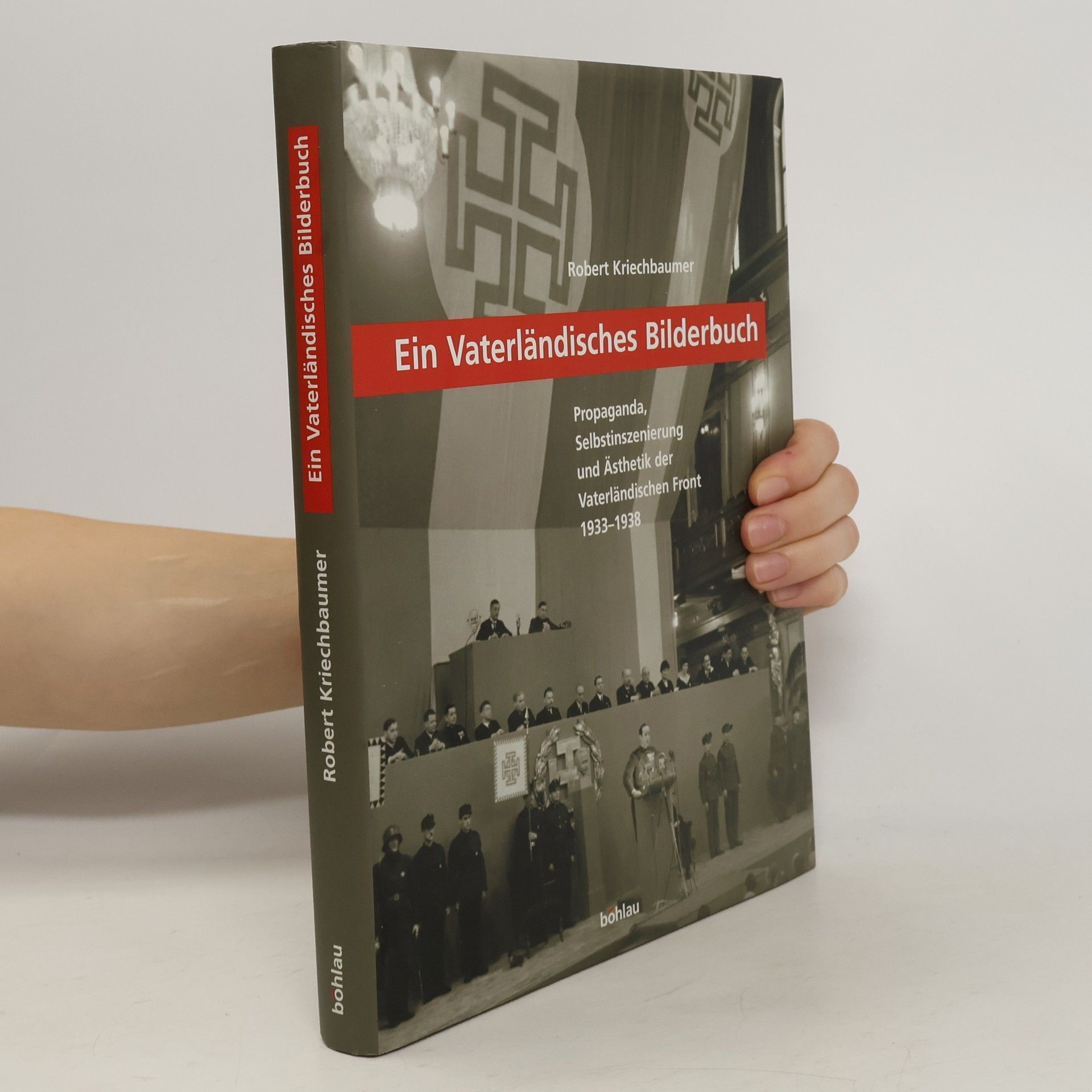Robert Kriechbaumer Livres





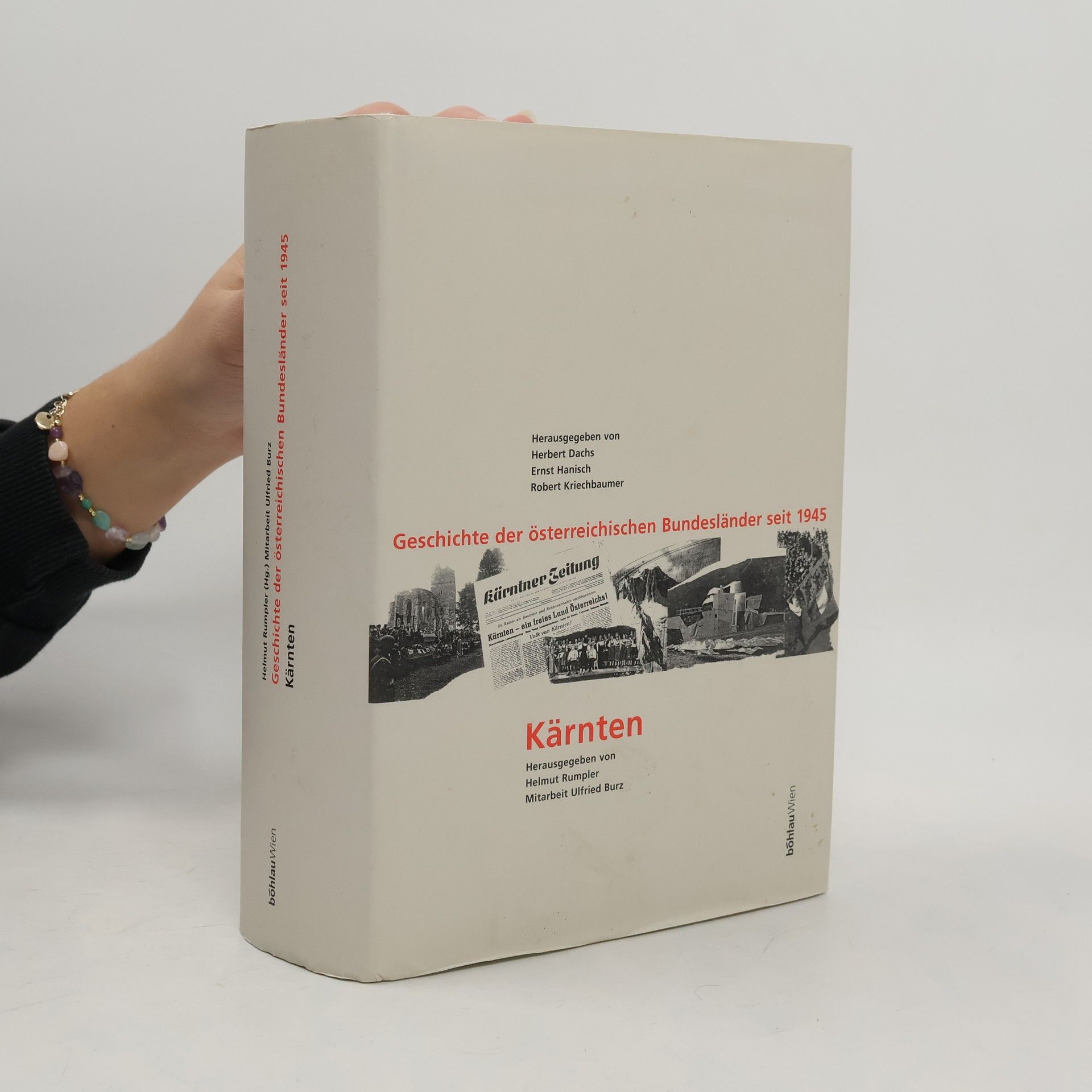
Parteiprogramme im Widerstreit der Interessen. Sonderband 3
Die Programmdiskussion und die Programme von ÖVP und SPÖ 1945-1986
Der Versuch einer umfassenden Gesamtdarstellung der Geschichte der Zweiten Republik mit Beitragen von: Hannes Androsch, Dieter Binder, Emil Brix, Ernst Bruckmuller, Erhard Busek, Felix Butschek, Heinz Fassmann, Fritz Fellner, Jorg Haider, Hubert Feichtlbauer, Heinz Fischer, Hans Katschthaler, Andreas Khol, Heinz Kienzl, Thomas Klestil, Katharina Krawagna-Pfeifer, Herbert Krejci, Robert Kriechbaumer, Ferdinand Lacina, Freda Meisner-Blau, Alois Mock, Franz Muhri, Wolfgang C. Muller, Hermann Nitsch, Rudolf Palme, Oswald Panagl, Gustav Peichl, Peter Pelinka, Friedrich Peter, Peter Pilz, Karl Pisa, Manfred Prisching, Claus Raitan, Josef Riegler, Franz Schausberger, Bernd Schilcher, Helmut Schreiner, Fred Sinowatz, Josef Taus, Jens Tschebull, Franz Vranitzky, Manfried Welan und Alfred Worm. In Zusammenarbeit zwischen dem Forschungsinstitut fur politische und historische Studien in Salzburg und der Stiftung Bruno-Kreisky-Archiv, Wien wurde anlasslich des funfzigjahrigen Bestehens der Zweiten Republik der Plan entwickelt, eine Darstellung ihrer Geschichte unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten vorzunehmen: der "Sicht von innen" als Geschichte der handelnden, kommentierenden und analysierenden Zeitgenossen und der "Sicht von aussen" als Geschichte des distanzierten Blickes von jenseits des "Gartenzauns".
Die Ära Faymann bietet eine umfassende Analyse der österreichischen Politik zwischen 2008 und 2016, wobei sie sich nicht nur auf die Biografie von Werner Faymann konzentriert, sondern auch auf die politischen Entwicklungen und Herausforderungen dieser Zeit eingeht. Das Buch beleuchtet zentrale Ereignisse, politische Entscheidungen und deren Auswirkungen auf das Land, wodurch es ein tiefes Verständnis für die politischen Strömungen und den Einfluss Faymanns auf die österreichische Gesellschaft vermittelt.
Zwischen Krisenbewältigung und Stillstand. Die Ära Faymann
Österreich 2008 bis 2016. Band 1: 2008 bis 2013
- 981pages
- 35 heures de lecture
Die Regierungszeit von Werner Faymann wird als komplexes Geflecht österreichischer Politik zwischen 2008 und 2016 dargestellt, geprägt von externen Krisen wie der Finanzkrise, der Krim-Besetzung und der Flüchtlingskrise. Die Spannungen innerhalb der SPÖ und die Differenzen mit Koalitionspartnern führten zu einer einzigartigen Situation, in der Faymann beim Mai-Aufmarsch öffentlichem Unmut ausgesetzt war. Dies mündete in seinen Rücktritt als Parteivorsitzender und Bundeskanzler, was die innerparteilichen Konflikte der SPÖ eindrucksvoll verdeutlicht.
Zwischen Krisenbewältigung und Stillstand. Die Ära Faymann
Österreich 2008 bis 2016. Band 2: 2013 bis 2016
- 547pages
- 20 heures de lecture
Die Analyse der Regierungszeit von Werner Faymann beleuchtet die komplexen politischen Rahmenbedingungen in Österreich zwischen 2008 und 2016. Die Auswirkungen globaler Krisen, wie der Finanzkrise und der Flüchtlingskrise, sowie interne Konflikte innerhalb der SPÖ prägen die Darstellung. Faymanns Koalition war geprägt von wechselnden Vizekanzlern und politischen Spannungen, die letztlich zu seinem Rücktritt führten. Besonders markant ist der Moment, als er beim Mai-Aufmarsch mit offenem Unmut der Parteibasis konfrontiert wurde, was einen historischen Wendepunkt darstellt.
In der Periodisierung der Zweiten Republik nehmen die sechziger Jahre eine zentrale Position ein, da in ihnen der Ubergang von den "langen" funfziger Jahren zu den "kurzen" sechziger Jahren erfolgte. 1963/64 trat die Grundergeneration der Zweiten Republik von der Buhne der Politik und "des Lebens ab. Josef Klaus, Bundeskanzler der Jahre 1964-1970, ist durch die von ihm "formulierte" Politik der Sachlichkeit", durch den umfassenden Modernisierungsanspruch die"politische Personlichkeit der sechziger Jahre, die durch die Fuhrung der ersten monokoloren" Regierung der Zweiten Republik nicht nur die Ara der Grossen Koalition beendete, sondern durch "zahlreiche Modernisierungsmassnahmen uber die Tagespolitik hinaus historische Relevanz erhielt.
\"Salzburg hat seine Cosima\"
Lilli Lehmann und die Salzburger Musikfeste
Der Wiener Kritikerpapst Julius Korngold nannte Lilli Lehmann in Anspielung auf die dominante Rolle der Witwe Richard Wagners in Bayreuth die „Cosima Salzburgs". Eine durchaus zutreffende Charakterisierung mit Blick auf die dominante Rolle der Sängerin im Musikleben der Stadt in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Auf Grund ihrer Verdienste um den Bau des Mozarteums, die Salzburger Musikfeste und den Erwerb von Mozarts Geburtshaus durch die Internationale Stiftung Mozarteum wurde Lilli Lehmann von den Salzburger Zeitgenossen als die Sonne gefeiert, „um die sich die Planeten gruppieren."
Ein vaterländisches Bilderbuch
- 272pages
- 10 heures de lecture
Vergangenheit und Gegenwart sind kulturelle Schöpfungen, die durch Bilder erzählt werden, die erst entschlüsselt werden müssen. Der sinnstiftende Kontext der Interpretation ermöglicht es uns, den „Bildersaal der Geschichte“ zu durchschreiten, der seit der Französischen Revolution tiefgreifende Veränderungen erfahren hat. Das 20. Jahrhundert wurde zum Jahrhundert der Bilder, in dem Fotografie und Film als „Zeugen der Zeit“ fungierten. Während die Presse um 1900 oft Wochen hinter den Ereignissen zurückblieb, verkürzte sich diese Differenz nach dem Ersten Weltkrieg auf Tage und Stunden. Die kollektive Wahrnehmung wurde zunehmend durch die Linse des Fotografen geprägt, und das Pressefoto wurde zum Inbegriff der Wirklichkeit. Die enthaltenen Fotografien illustrieren die Selbstinszenierung der Vaterländischen Front und blenden die Geschichte „von unten“ aus. Themen wie Armut, Arbeitslosigkeit und Hunger bleiben unberücksichtigt, da es sich nicht um eine Sozialreportage handelt. Als Dokumente der defensiven Selbstinszenierung gegenüber dem Nationalsozialismus legen sie jedoch die Strukturen und den imitativen Charakter der propagandistischen Bemühungen offen. In diesem Kontext verlieren sie ihren musealen Charakter und bieten dem Betrachter eine lesbare Schrift.