§B§Der Mensch im "Zeitalter der Extreme"§§S§Das Leben des Menschen in der Moderne ist geprägt von Innovationen, Veränderungen und Brüchen. Nie zuvor sind Lebensläufe und Grunderfahrungen innerhalb kurzer Zeit so fundamental revolutioniert und umgekrempelt worden wie im 20. Jahrhundert.§§Neben der immer rasanter werdenden technologischen Entwicklung haben unter anderem zwei Weltkriege, Völkermord, Massenarbeitslosigkeit, Inflation und nukleare Bedrohung sowie die Veränderung von Familien- und Gesellschaftsstrukturen den modernen Menschen geprägt. Handlungsmuster und Wertmaßstäbe differenzieren sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts mehr und mehr aus - die Individualisierung von Lebensläufen nimmt fortschreitend zu.§Aus der Beschreibung und Charakterisierung von verschiedenen Sozialtypen, die für dieses Jahrhundert kennzeichnend sind, entsteht ein Gesamtbild unserer Epoche mit all ihren Widersprüchen. Renommierte Historiker wie Richard Bessel, Christoph Conrad, Peter Gay u.v.a. portr ätieren in ihren Beiträgen Sozialtypen, deren Bedeutung, Rolle und gesellschaftliche Funktion sich im 20. Jahrhundert enorm verändert haben, oder die in dieser Zeit erst "erfunden" wurden.
Heinz Gerhard Haupt Livres


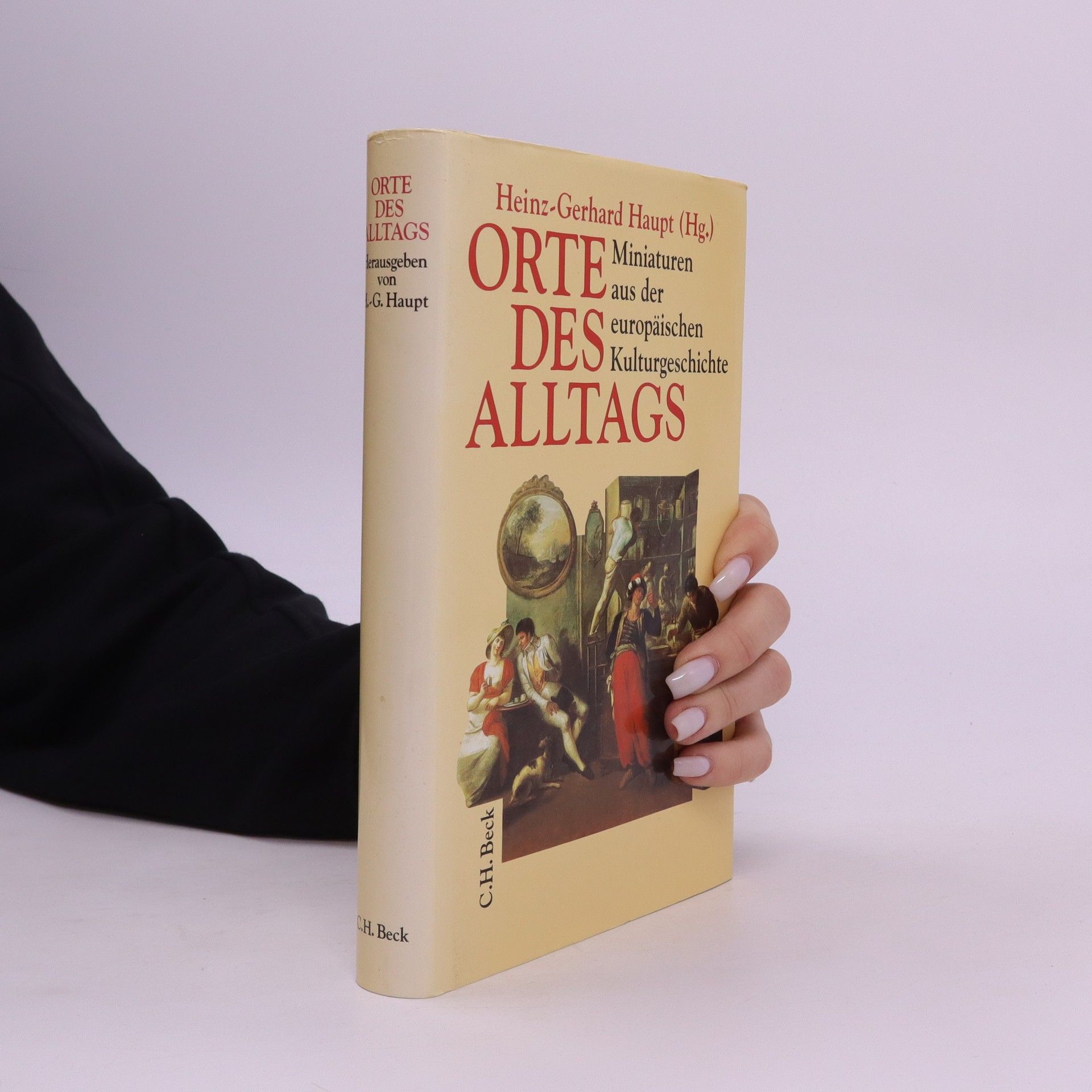



Kleine Geschichte Frankreichs
- 507pages
- 18 heures de lecture
Vom Vertrag von Verdun im Jahr 843, der das Reich Karls des Großen in drei Reiche aufteilte, deren westliches - das westfränkische Reich - allmählich zu Frankreich wurde, bis zum französischen „non“ zur EU-Verfassung im Sommer 2005: Die 'Kleine Geschichte Frankreichs' reicht bis in die allerjüngste Zeitgeschichte. Sie bietet den vollständigen, zuverlässigen und zugleich handlichen Überblick über die großen nationalgeschichtlichen Linien, den man von Reclams Nationalgeschichten erwartet.
13 Beiträge von Historikerinnen und Historikern zur Übergangszeit von der Romantik zur Moderne: die Gesellschaft muss sich rasch auf die fundamentalen Neuerungen der Industrialisierung einstellen. Thema der Beiträge sind die Menschen hinter diesen Entwicklungen: das Dienstmädchen, die Grossstadtmenschen, der Migrant, der Arzt, die Arbeiterin, der Unternehmer, der Künstler, der Ingenieur, die Gläubige.
"Bourgeois und Volk zugleich"?
Zur Geschichte d. Kleinbürgertums im 19. u. 20. Jh (Campus Sozialgeschichte)
- 184pages
- 7 heures de lecture