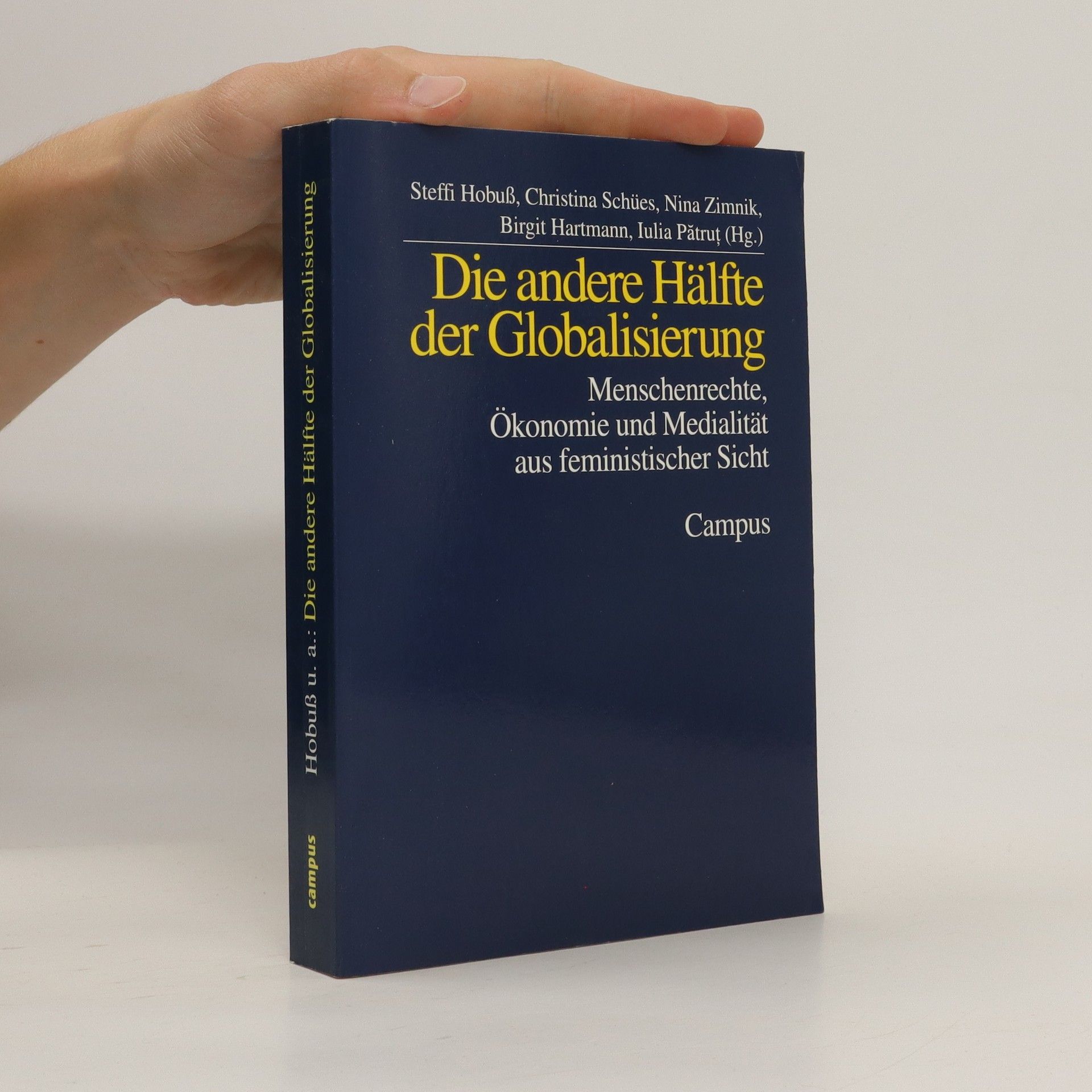Visuelle Wahrnehmung bei Platon und Aristoteles
Eine Kritik an Repräsentationstheorien des Sehens
- 232pages
- 9 heures de lecture
Die Studie untersucht Platons und Aristoteles' Theorien des Sehens und kritisiert die Dichotomie zwischen passivem Empfangen und aktivem Konstruieren. Sie beleuchtet Platons Fokus auf Erkenntnistheorie und Aristoteles' Typologie der Wahrnehmungen, gestützt auf sprachphilosophische und texttheoretische Ansätze der Autorin.