Während die Grenzen einzelner Wissenschaften immer undeutlicher werden, gewinnt eine noch junge »Disziplin« gerade dadurch zunehmend an Kontur: die von den anglo-amerikanischen cultural studies beeinflußte Kulturwissenschaft, die sich nun auch mehr und mehr an deutschen Universitäten etabliert. Das Kompendium Kulturgeschichte trägt dieser Entwicklung Rechnung, indem es das die aktuellen Debatten der Geschichtswissenschaft prägende Themenfeld der Kulturgeschichte im interdisziplinären Kontext von Literaturwissenschaft, Ethnologie, Soziologie und Philosophie einführend darstellt. Das Buch gibt einen überblick über die maßgeblichen Theorien, illustriert diese mit Fallbeispielen und erläutert die wesentlichen Schlüsselworte.
Ute Daniel Livres
3 mai 1953

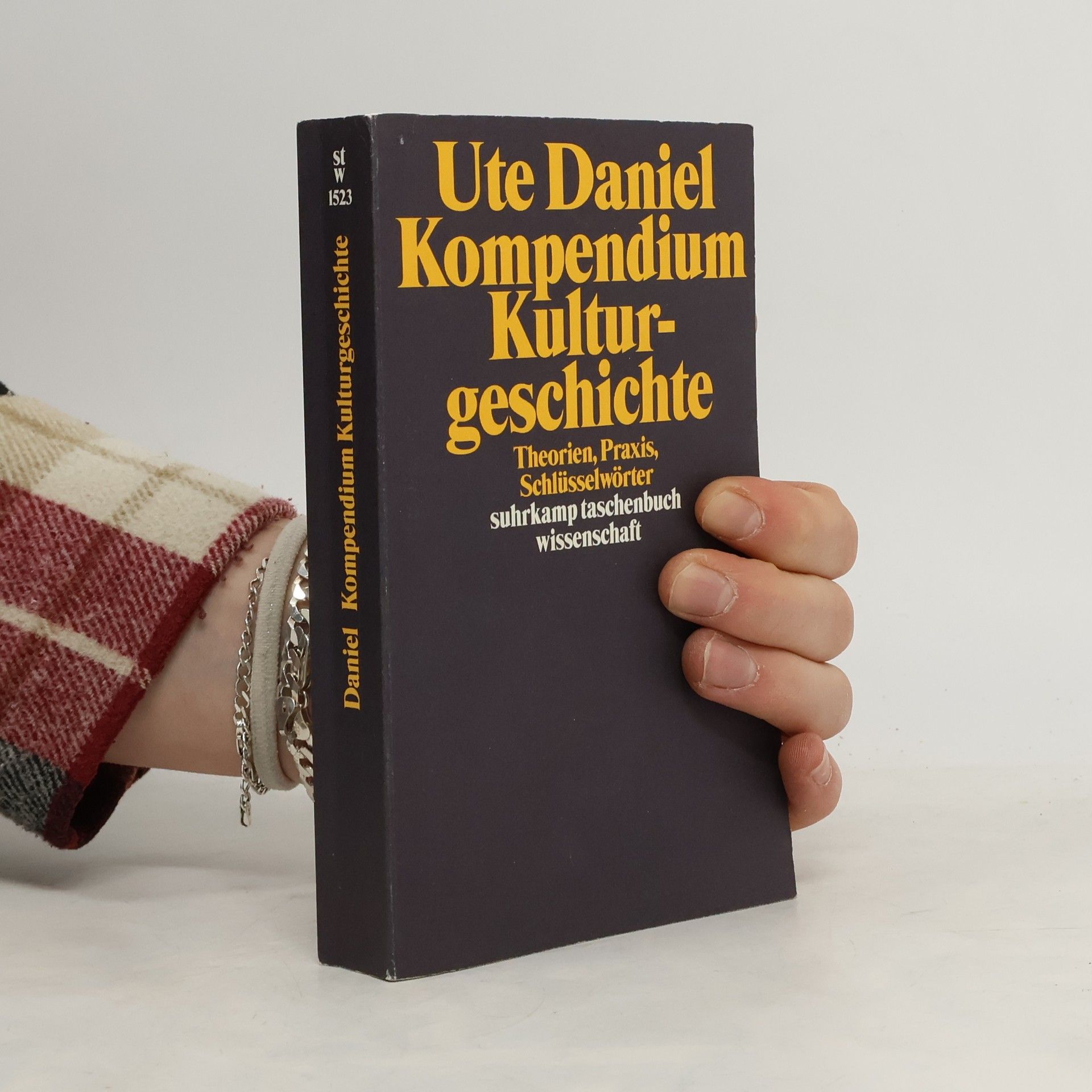
Ute Daniel untersucht den Widerspruch zwischen Anspruch und Realität der parlamentarischen Demokratie und fragt, wie diese reformiert werden kann. Sie hinterfragt die heroische Erzählung über den Ursprung der Demokratie und zeigt, dass der Einfluss früherer Protestbewegungen auf die Politik des 19. Jahrhunderts marginal war.