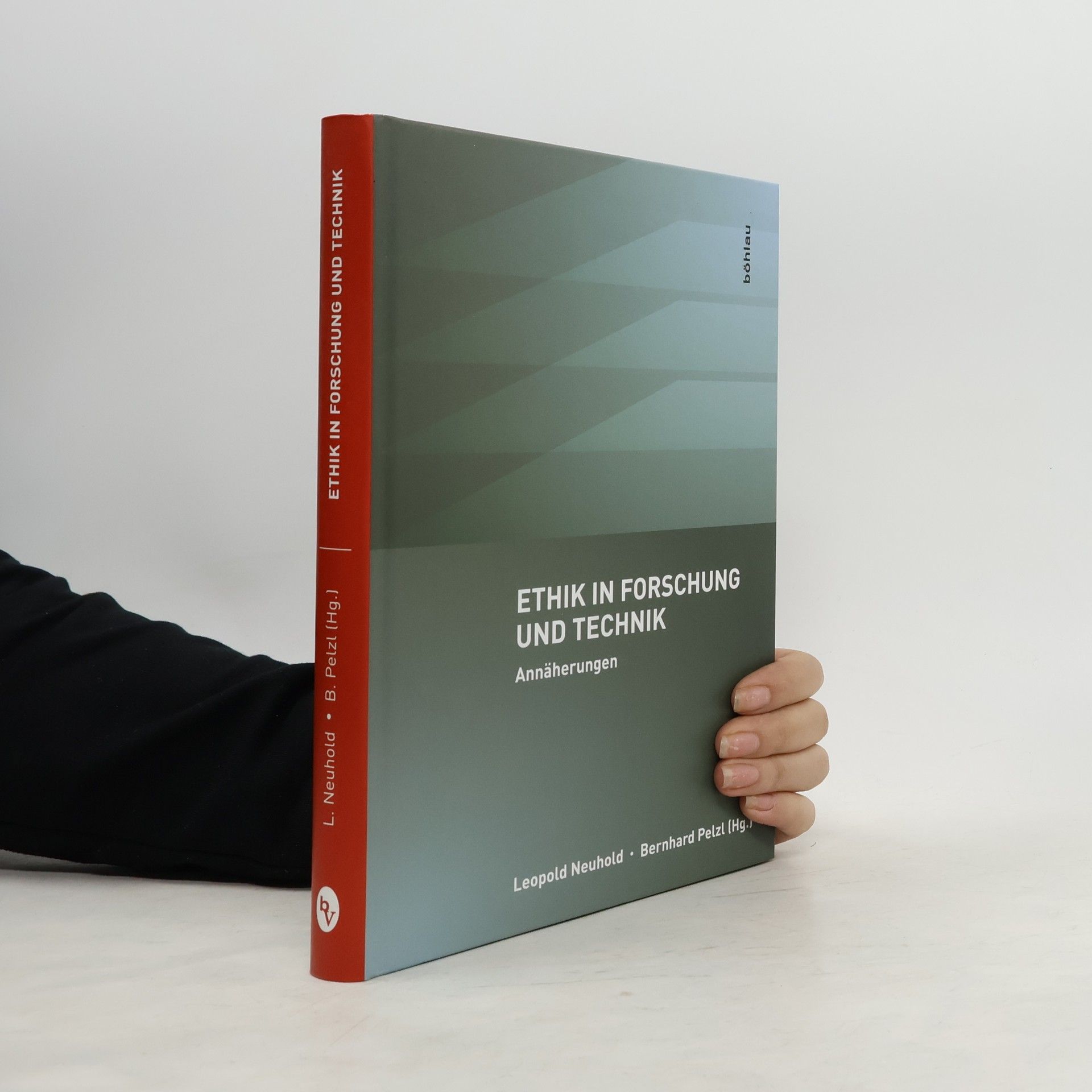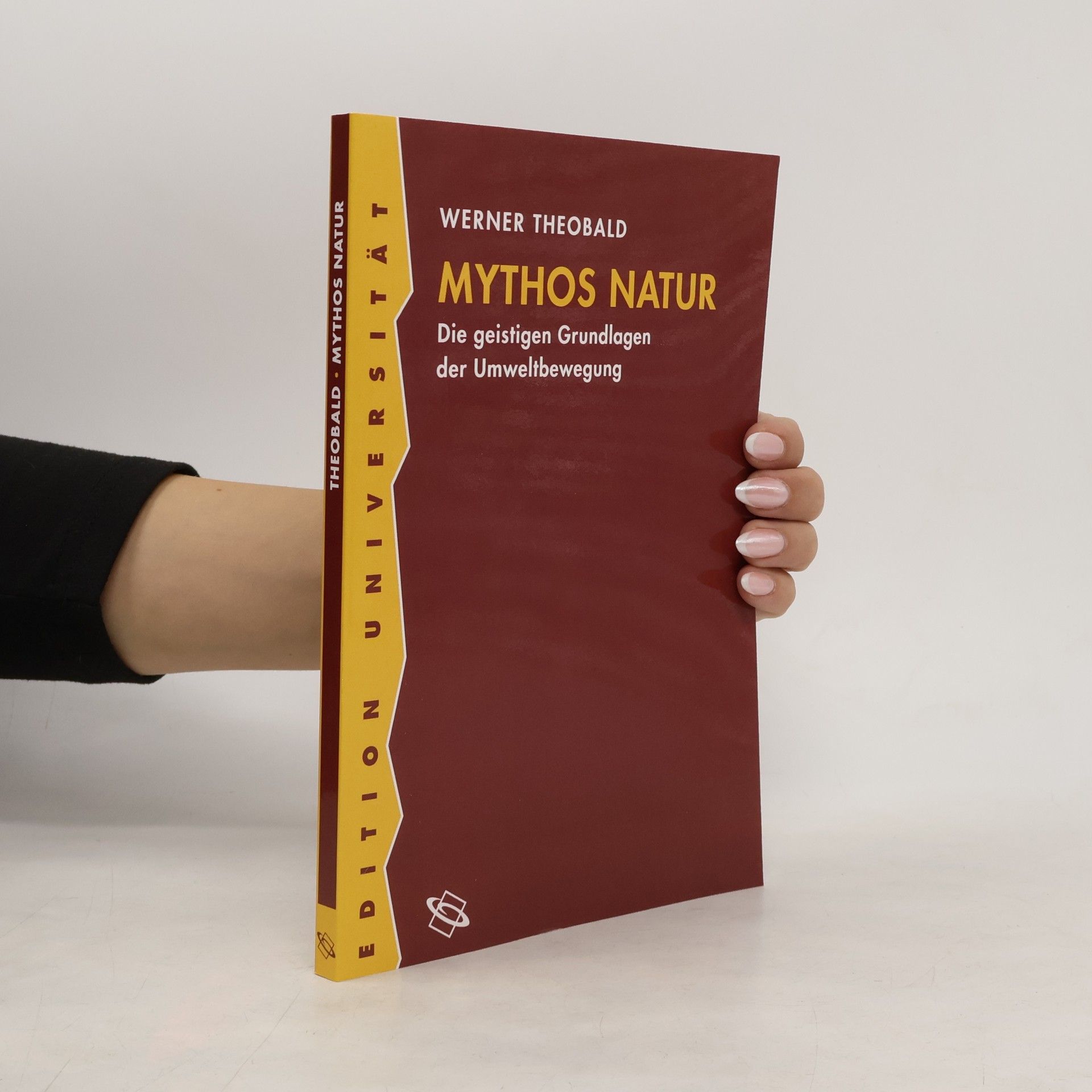Das verletzbare Selbst
Trauma und Ethik
Ein Trauma ist eine Extremerfahrung – und gehört doch fast schon zum Alltag. Immer häufiger, so scheint es, wird der Begriff zu einer zentralen politisch-moralischen Kategorie. Was aber ist ein Trauma überhaupt, und was genau bedeutet es in ethischer Hinsicht? Werner Theobald verknüpft Trauma und Ethik in bislang einzigartiger Weise und erweitert damit entscheidend die philosophisch-ethische Diskussion. Er entwirft ein neues Verständnis einer existenziellen Ethik, das er anhand aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen bespricht. Dabei werden auch Grundpositionen der modernen Philosophiegeschichte behandelt (von Descartes und Kierkegaard über Wittgenstein und Camus zu Sartre, Levinas und vielen weiteren), die zeigen, wie sich die Destruktivität erlittener Traumatisierungen auf das Selbst-, Sinn- und Weltverständnis auswirken kann.