Thomas Althaus Livres
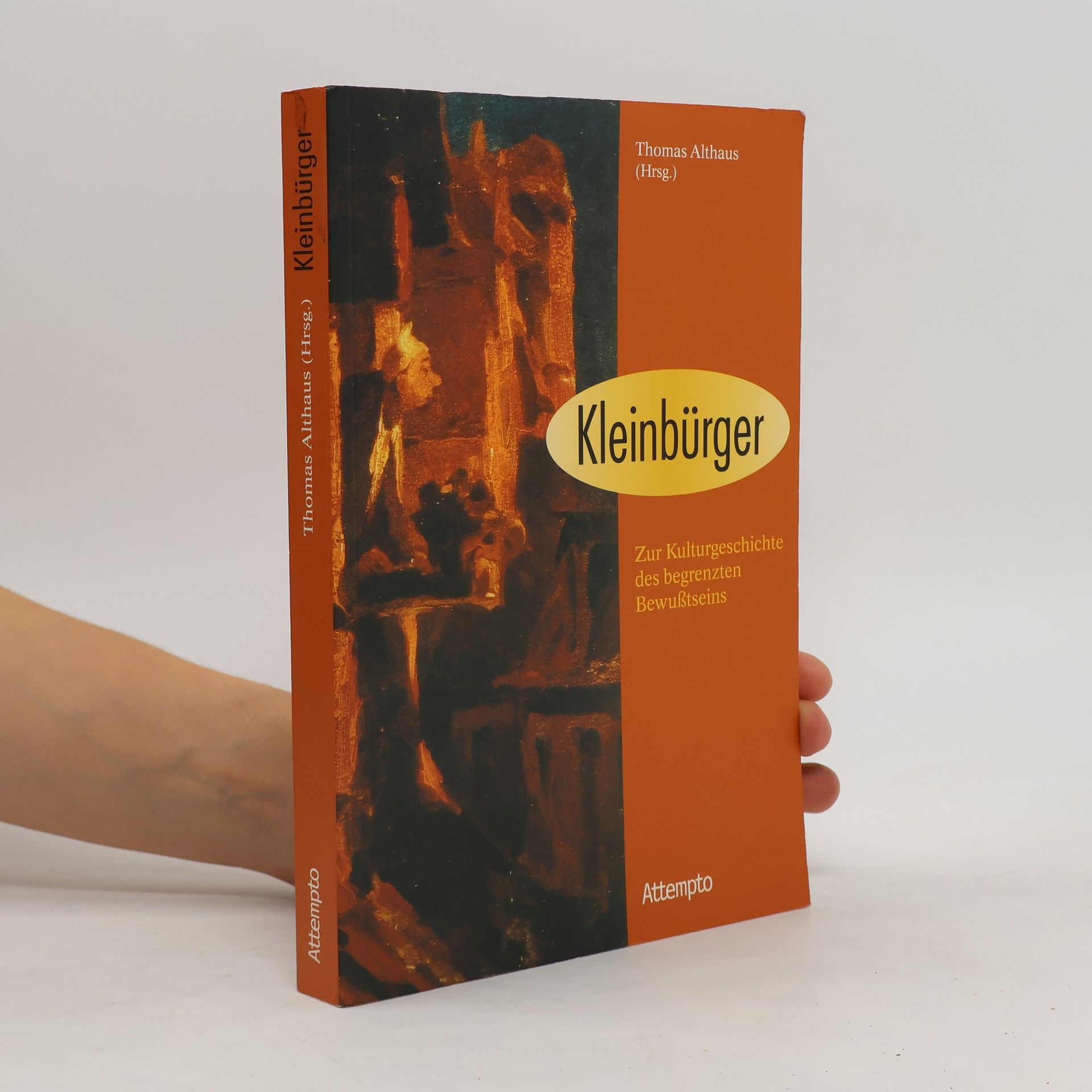
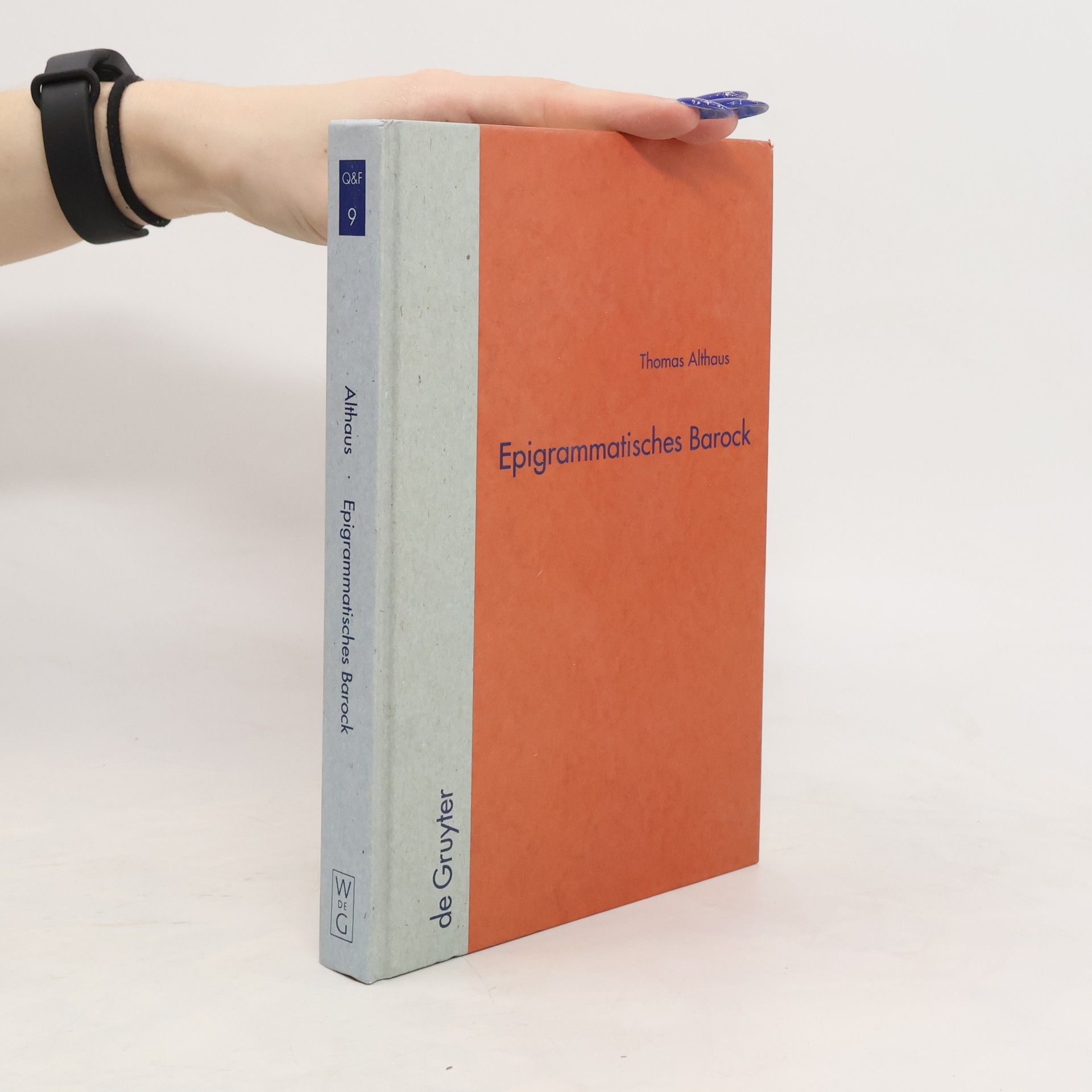
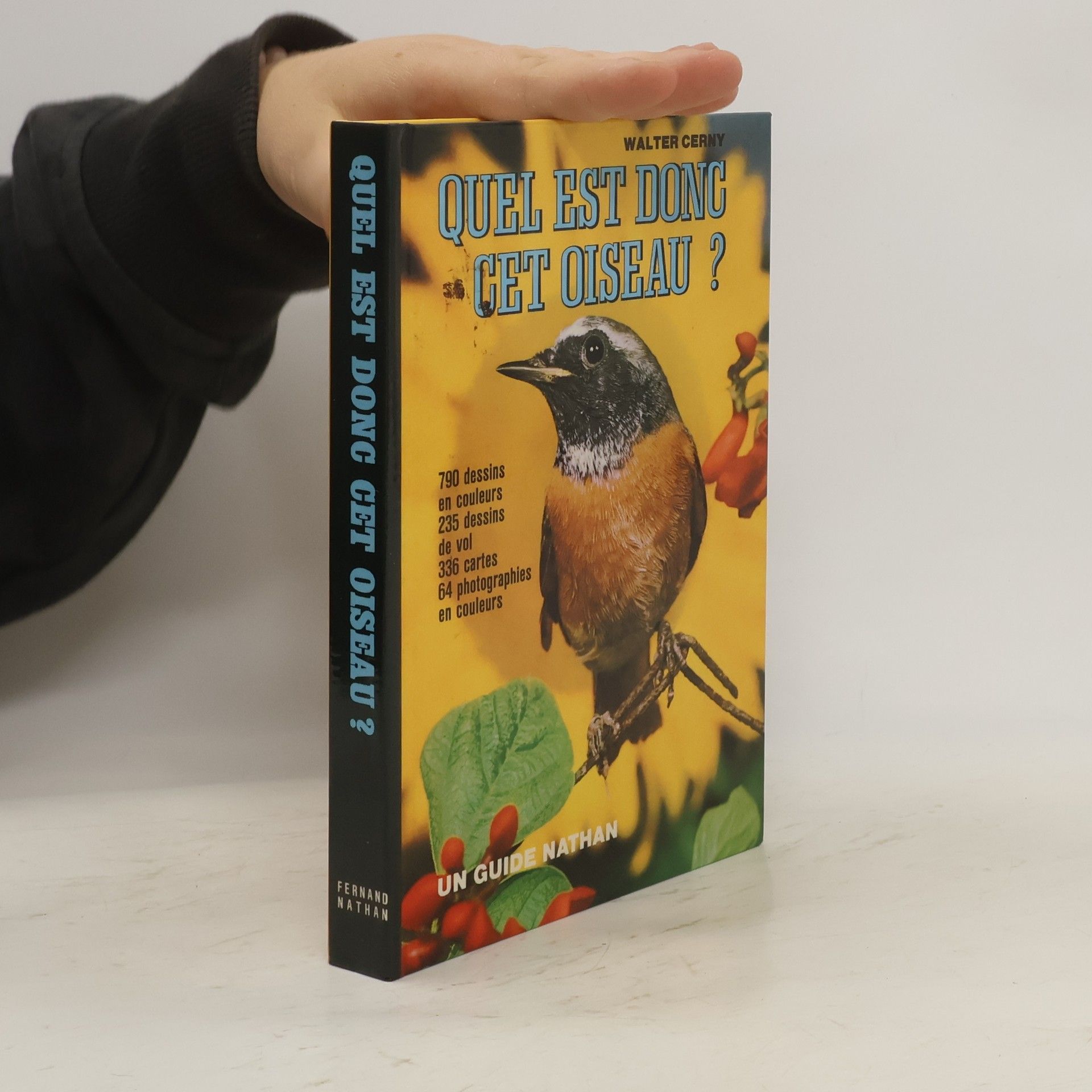
Die traditionsreiche Reihe QUELLEN UND FORSCHUNGEN ZUR LITERATUR- UND KULTURGESCHICHTE, deren Ursprung auf das Jahr 1874 zurückgeht, gehört zum festen Bestand renommierter Publikationsforen der Deutschen Literaturwissenschaft. Von Mark-Georg Dehrmann und Christiane Witthöft herausgegeben, präsentieren die QUELLEN UND FORSCHUNGEN hochwertige wissenschaftliche Arbeiten, die literarische Texte im Zusammenhang mit kulturhistorischen Phänomenen, besonders auch mit den anderen Künsten, untersuchen. Philologische Studien mit transdisziplinärem Ansatz sind ausdrücklich erwünscht. Der Schwerpunkt der Serie liegt auf der deutschen Literatur vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Da die kulturgeschichtliche Ausrichtung der Reihe Aspekte interkultureller Erfahrung und nationaler Fremdwahrnehmung einbegreift, stehen die QUELLEN UND FORSCHUNGEN im Einzelfall aber auch komparatistischen Arbeiten offen. Veröffentlicht werden Monographien, Dissertationen und Habilitationsschriften. Die Maßstäbe für die Aufnahme in die Reihe bilden wissenschaftliche Relevanz und Exzellenz in Methode und Darstellung.