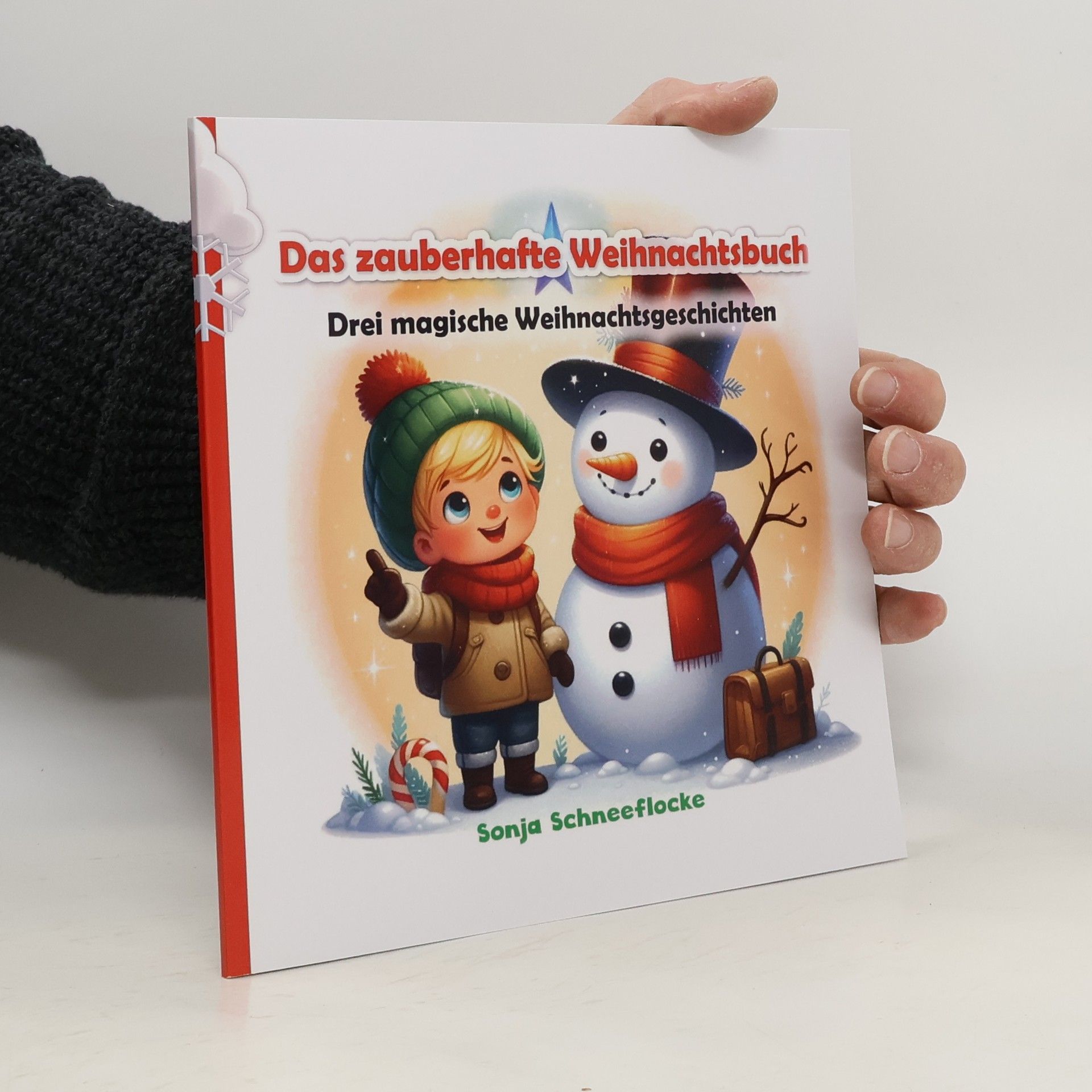Johanna Hoffmann Livres
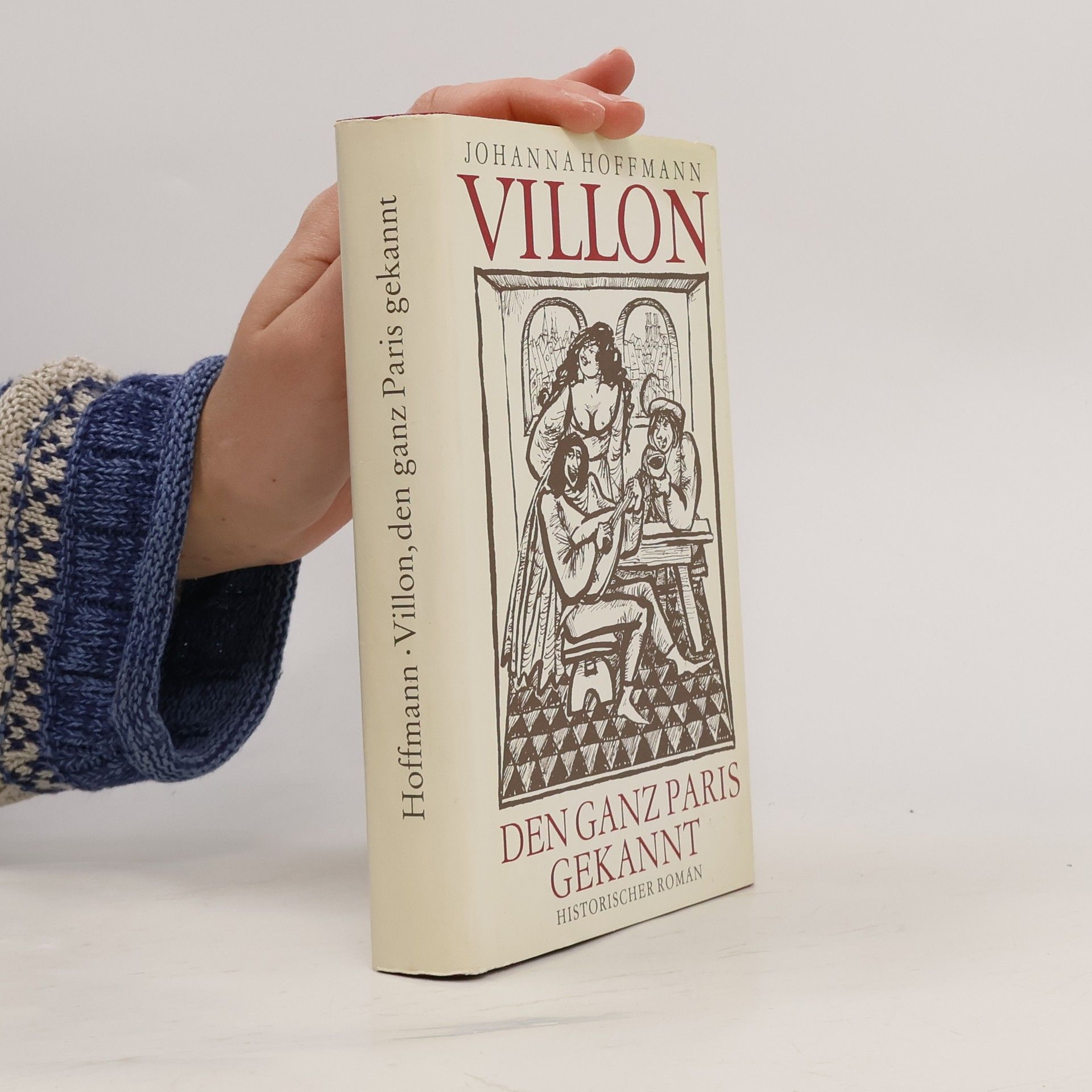

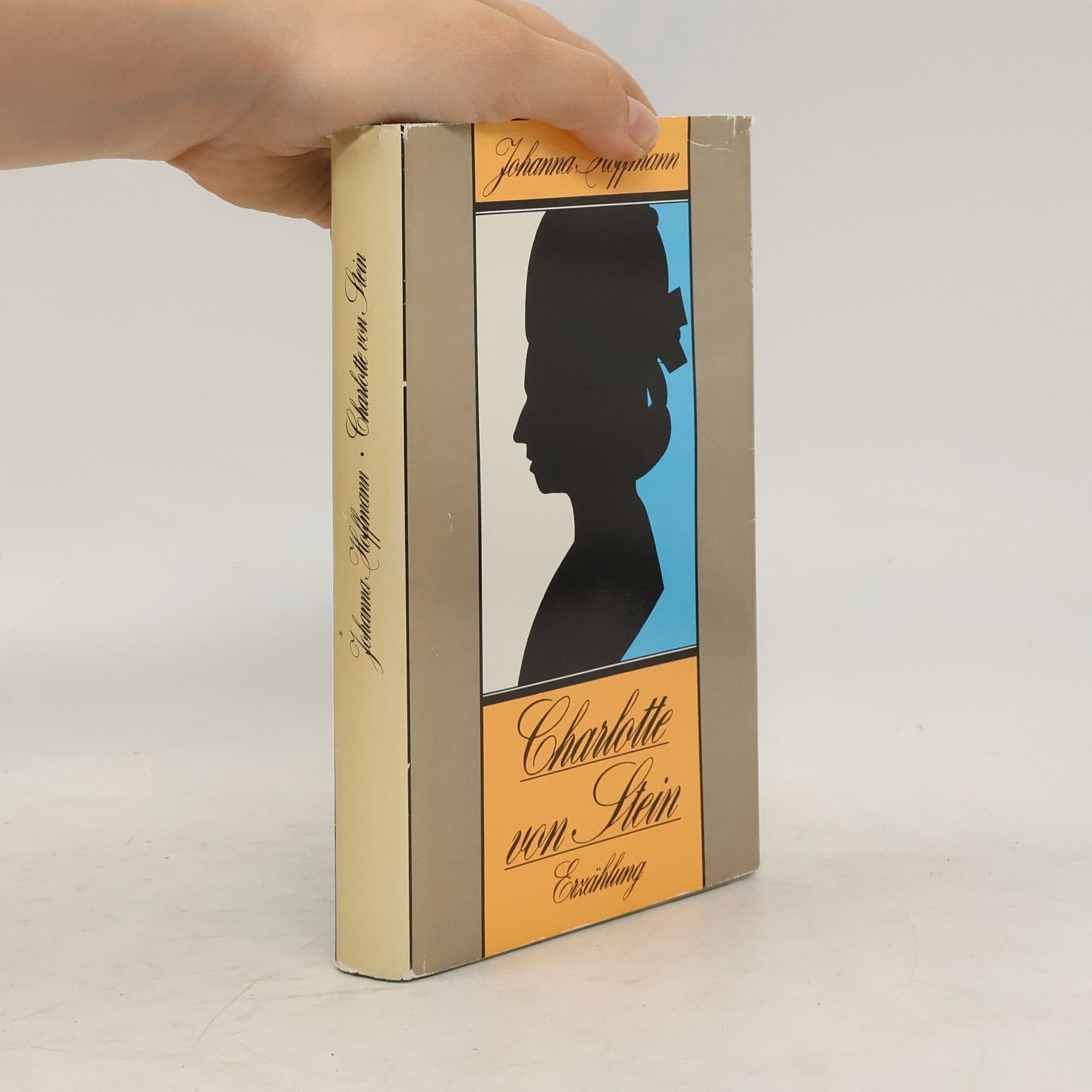

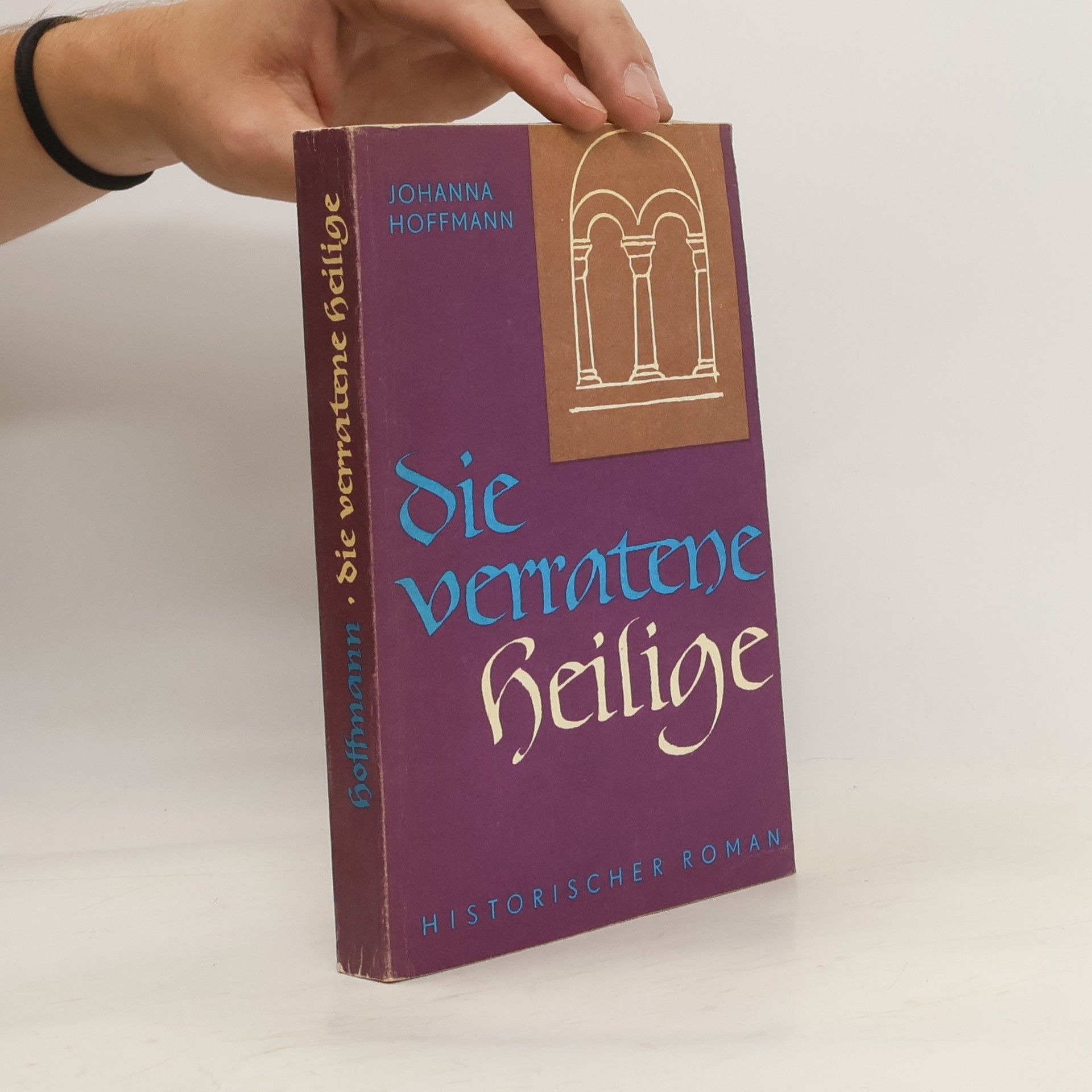
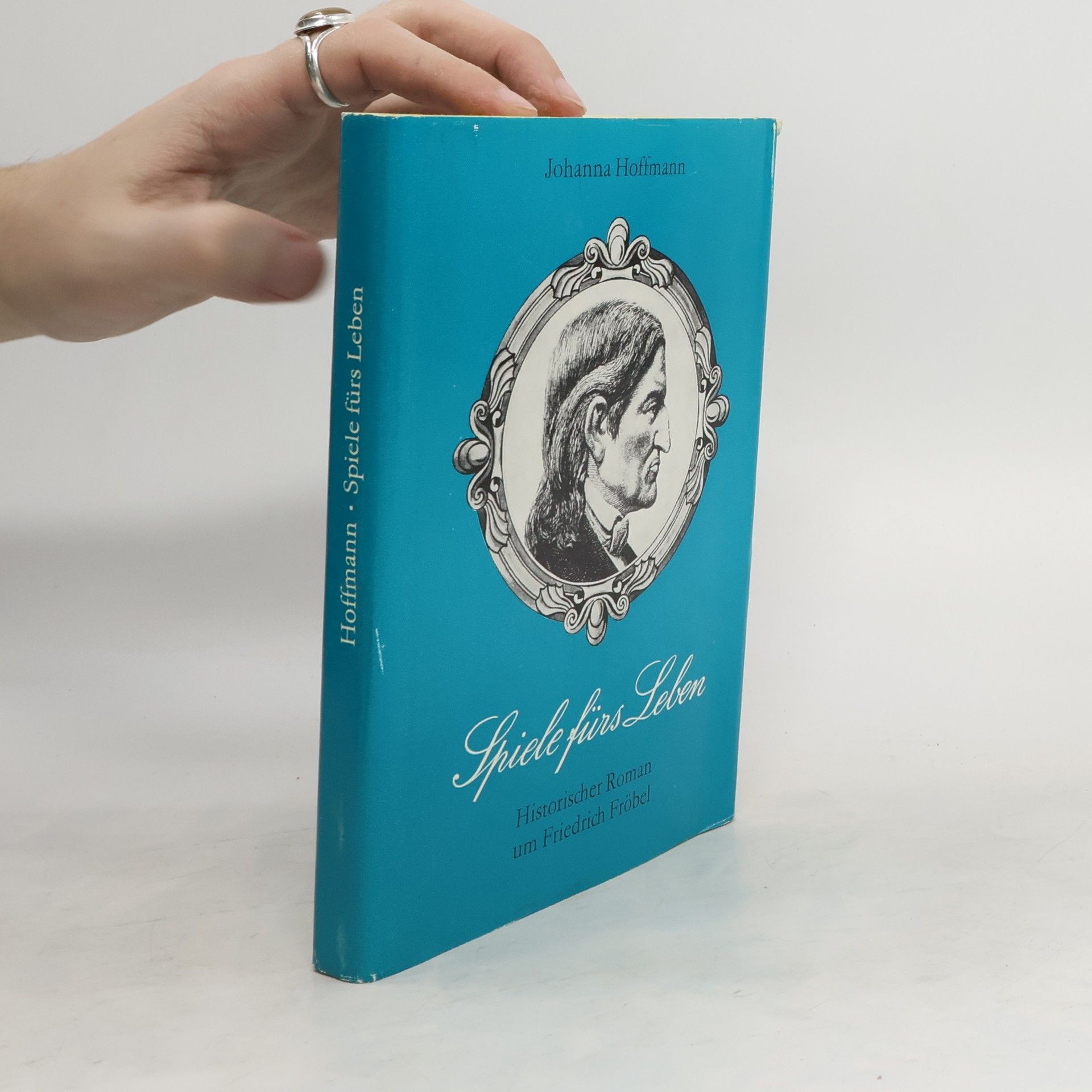
Das Leben der Landgräfin Elisabeth von Thüringen gestaltet diese handlungsstarke, konfliktreiche Erzählung. Weil man Elisabeth manches Wunder nachsagte und ihr exemplarisch frommes Leben weit über den Umkreis der Wartburg hinaus rühmte, wurde sie heilig gesprochen. Der Spannungsgehalt des Buches liegt in der wirklichkeitsnahen literarischen Darstellung nach den geschichtlichen Quellen begründet.
Charlotte von Stein
Goethe und ich werden niemals Freunde. Erzählung
Als sich Goethe und Charlotte von Stein 1775 zum ersten Mal am Weimarer Hof begegneten, war der Dichter sechsundzwanzig Jahre alt und hatte in der damaligen Literaturszene durch „Götz von Berlichingen“ und den Werther-Roman bereits Aufsehen erregt. Sie, die Frau Oberstallmeister und Hofdame, war dreiunddreißig, verheiratet und Mutter dreier Söhne. Nach dem Urteil der Zeitgenossen war sie eine feinsinnige, gebildete Frau von eher kühlem Temperament. Beide sahen sich zeitweilig jeden Tag, es gingen „Zettelgen“ zwischen Weimar und Schloss Kochberg, zwischen der Ackerwand und dem Frauenplan hin und her. Es wurden 1700 Briefe, die Goethe an Charlotte von Stein schrieb; sie hat die ihren nach der überraschenden Abreise des Dichters nach Italien zurückgefordert und verbrannt. Den Höhen und Tiefen in dieser Beziehung, der außergewöhnlichen Anziehungskraft, die zwischen beiden bestanden haben muss, geht Johanna Hoffmann in ihrer Erzählung nach. Sie versucht Charlotte von Stein als Vertraute Goethes, als seine „Frau und Schwester“ begreiflich zu machen und sie gleichzeitig in ihren Bindungen an die Hofgesellschaft und vor allem an ihre Familie zu zeigen.
Das außergewöhnliche Leben der Landgräfin Elisabeth von Thüringen (1207–1231) beschreibt dieser handlungsstarke Roman. Als ungarische Königstochter kam sie mit vier Jahren auf die Wartburg bei Eisenach, einem Mittelpunkt höfischen Lebens mit üppigen Festmahlen, Ritterspielen, Minnesängern und Lustbarkeiten. Sie wurde dort zur Landgräfin erzogen und mit 15 Jahren mit Ludwig von Thüringen verheiratet. Trotzdem war die Ehe von großer Zuneigung und Liebe geprägt. In dieser Umgebung lebte die junge Landgräfin ein ungewöhnlich christliches Leben, das die höfische Gesellschaft infrage stellte und Konflikte heraufbeschwor. Landgraf Ludwig tolerierte ihre Frömmigkeit. Sie pflegte Kranke, speiste Hungernde und kümmerte sich um das Elend des einfachen Volkes. Nachdem ihr Mann während des sechsten Kreuzzuges verstorben war, unterstellte die dreifache Mutter sich in gutgläubiger Frömmigkeit dem machtlüsternen Einfluss des Magisters Konrad von Marburg, der ihre Gottesliebe für seine Zwecke ausnutzte. Durch die Vermittlung eines falschen, strengen Gottesbildes trieb er sie fast zur religiösen Ekstase. Der wirklichkeitsnahen literarischen Darstellung liegen historische Quellenforschungen zugrunde.