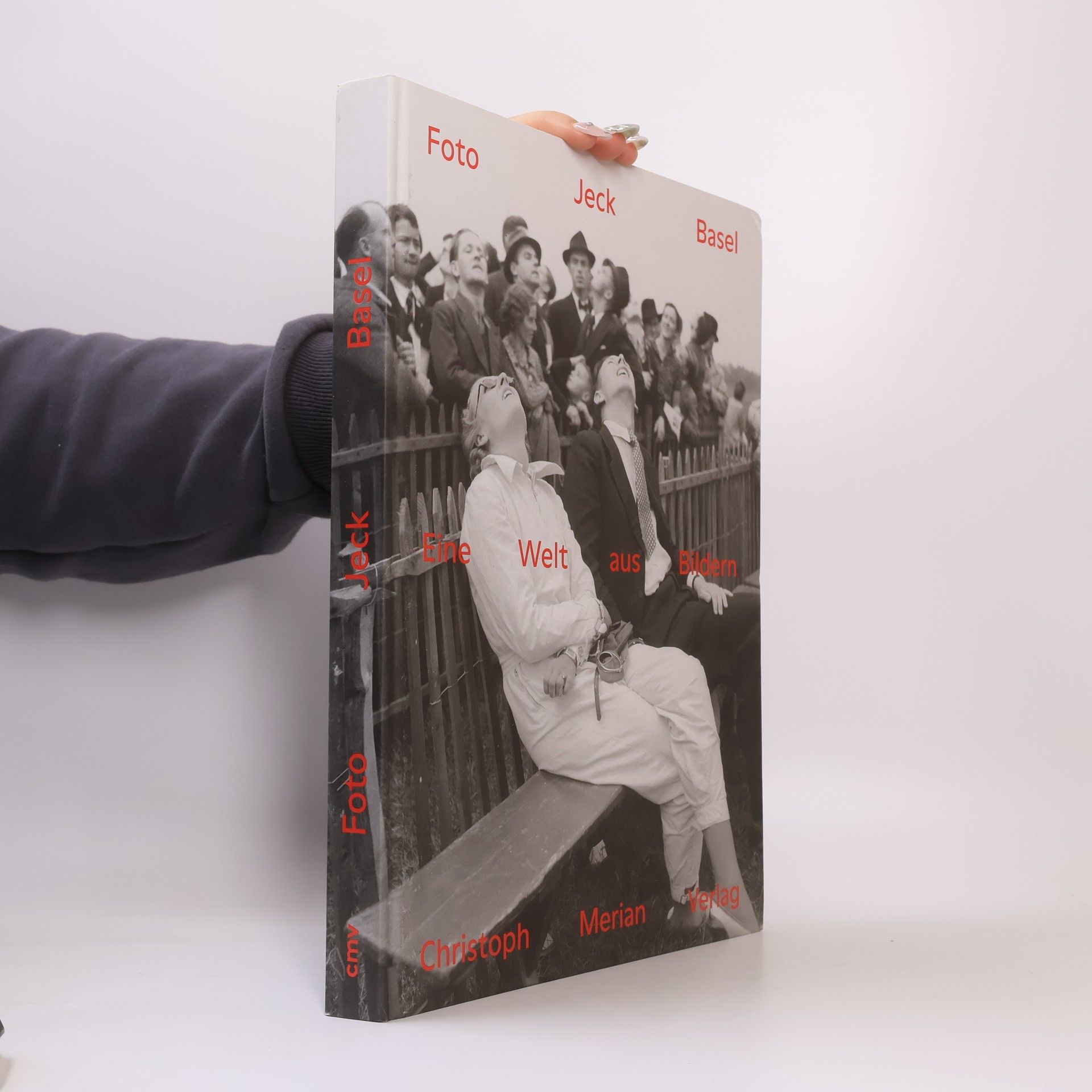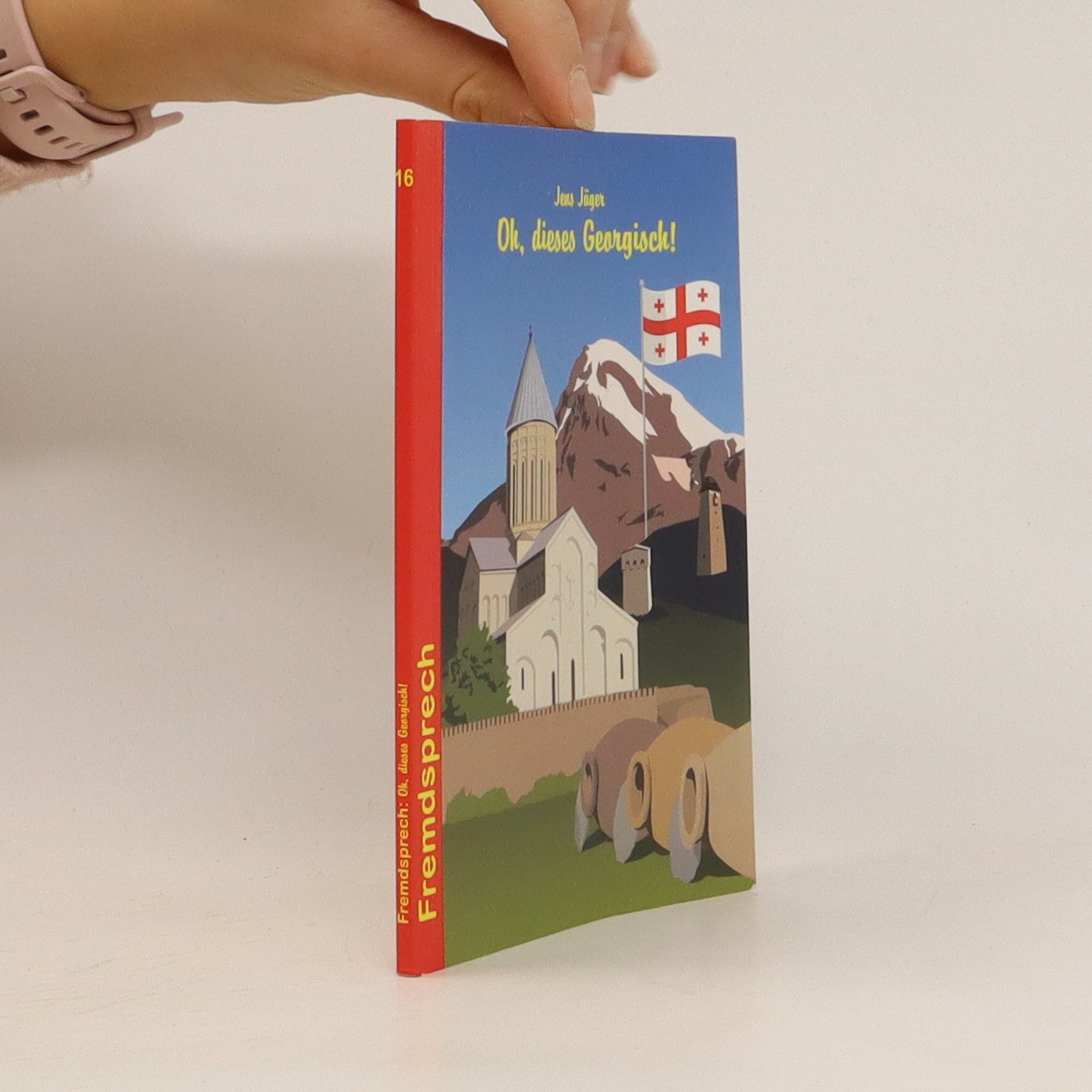Oh, dieses Georgisch!
- 76pages
- 3 heures de lecture
Georgien, weit entfernt vom deutschen Sprachraum, ist für viele Menschen unbekannt, insbesondere die georgische Sprache und Literatur. Während westliche Kulturen im deutschen Alltag präsent sind, hat die Mehrheit noch nie Georgisch gehört. Doch Georgien öffnet sich wie kein anderes Land der ehemaligen Sowjetunion und wird zunehmend als Reiseziel attraktiv. Die Sprache der 4,5 Millionen Georgier ist ebenso überraschend und einzigartig wie das Land selbst. Das Buch bietet keinen Lehrbuchansatz, sondern ist ein unterhaltsamer Einblick in die georgische Kultur für Interessierte, die mehr über die Schrift und Sprache erfahren möchten. Sprachanfänger finden hilfreiche Tipps für den Einstieg, und ein kleiner Sprachführer am Ende präsentiert wichtige Redewendungen sowie deren kulturellen Kontext für Reisende. Vor allem ist es ein unterhaltsames Werk, das zahlreiche Sprachkuriositäten versammelt und überraschende Antworten auf Fragen gibt, die man sich vielleicht nie gestellt hat: Wer war der letzte Sprecher des Ubychischen? Welche Konsonantenhäufung ist georgisch? Wer ist die georgische Katrin Fuchs? Und was ist als Vorname schlimmer: Gotthelf oder Arvelodi? Viel Spaß beim Entdecken!