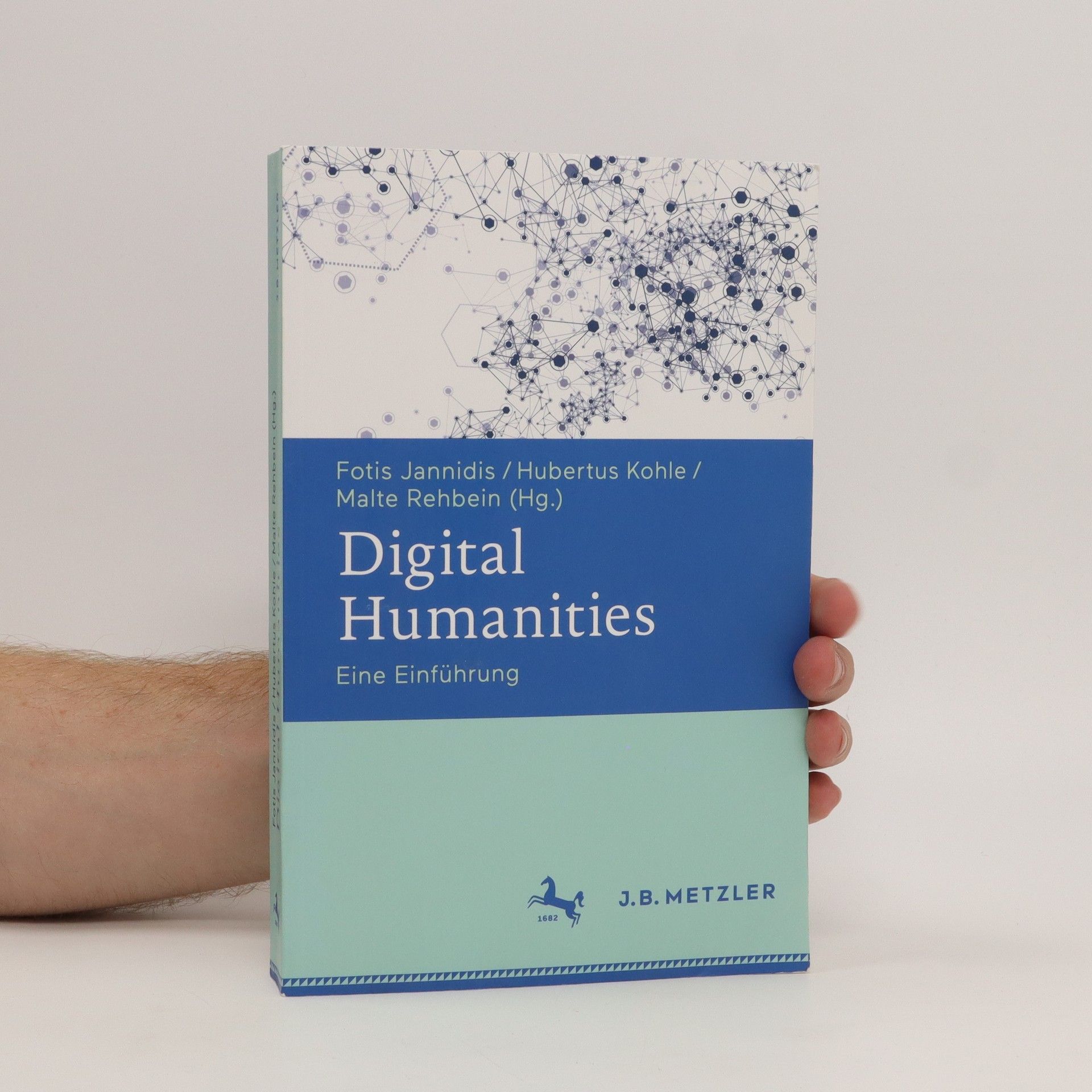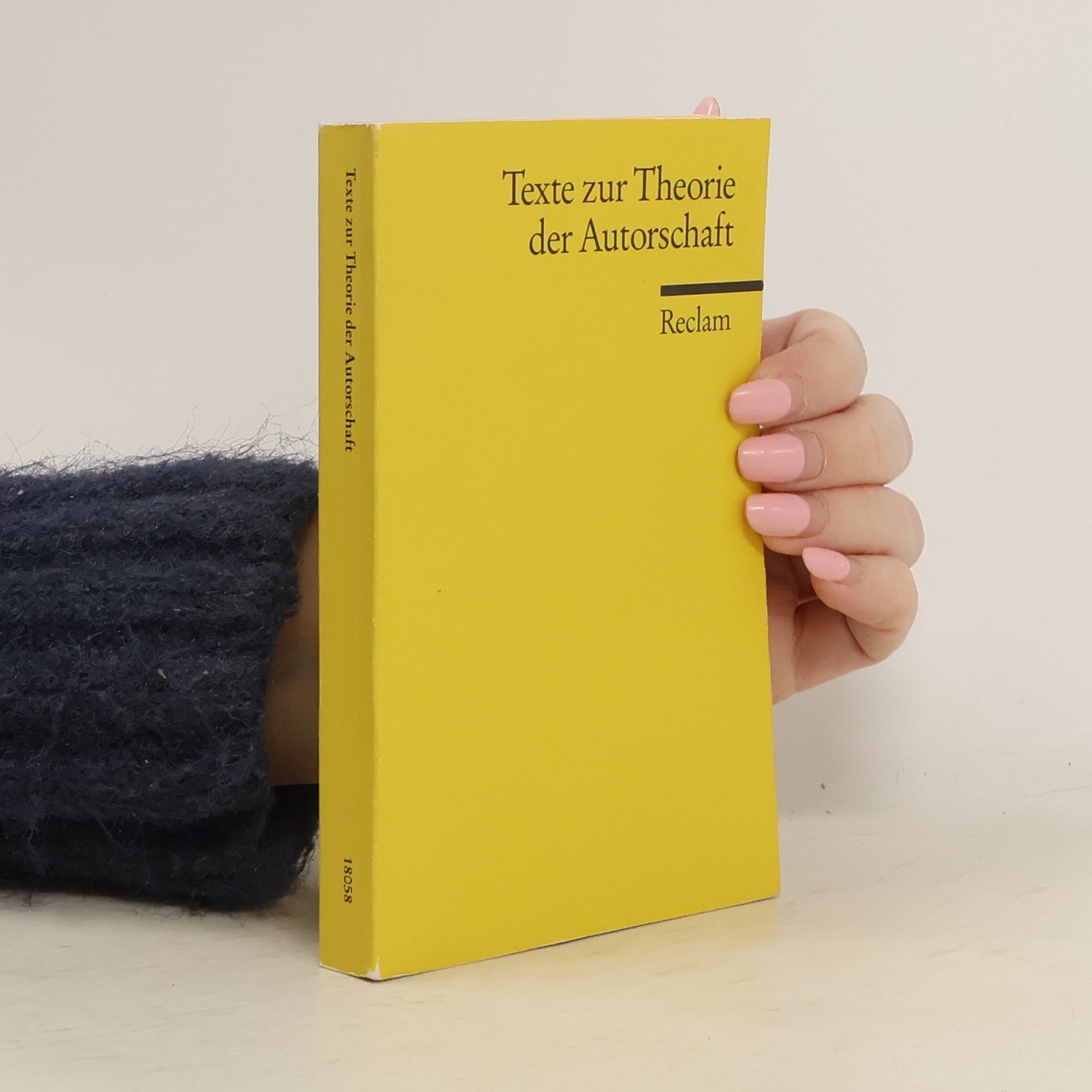Texte zur Theorie der Autorschaft
- 316pages
- 12 heures de lecture
Über den Autor wurde und wird in der Literaturwissenschaft viel diskutiert: ob (und wie) er in die Interpretation literarischer Texte einbezogen werden müsse, ob er gar eine überlebte Institution sei, die für das Textverständnis nichts Wesentliches leiste, und was dann an seine Stelle trete, der Text allein oder aber der Leser? Der vorliegende Band versammelt vierzehn Aufsätze (davon einige in Erstübersetzungen), die für die zeitgenössische Theoriedebatte von Bedeutung sind. Die Reihe ihrer Verfasser reicht von Roland Barthes über Michel Foucault und Umberto Eco bis zu Martha Woodmansee.