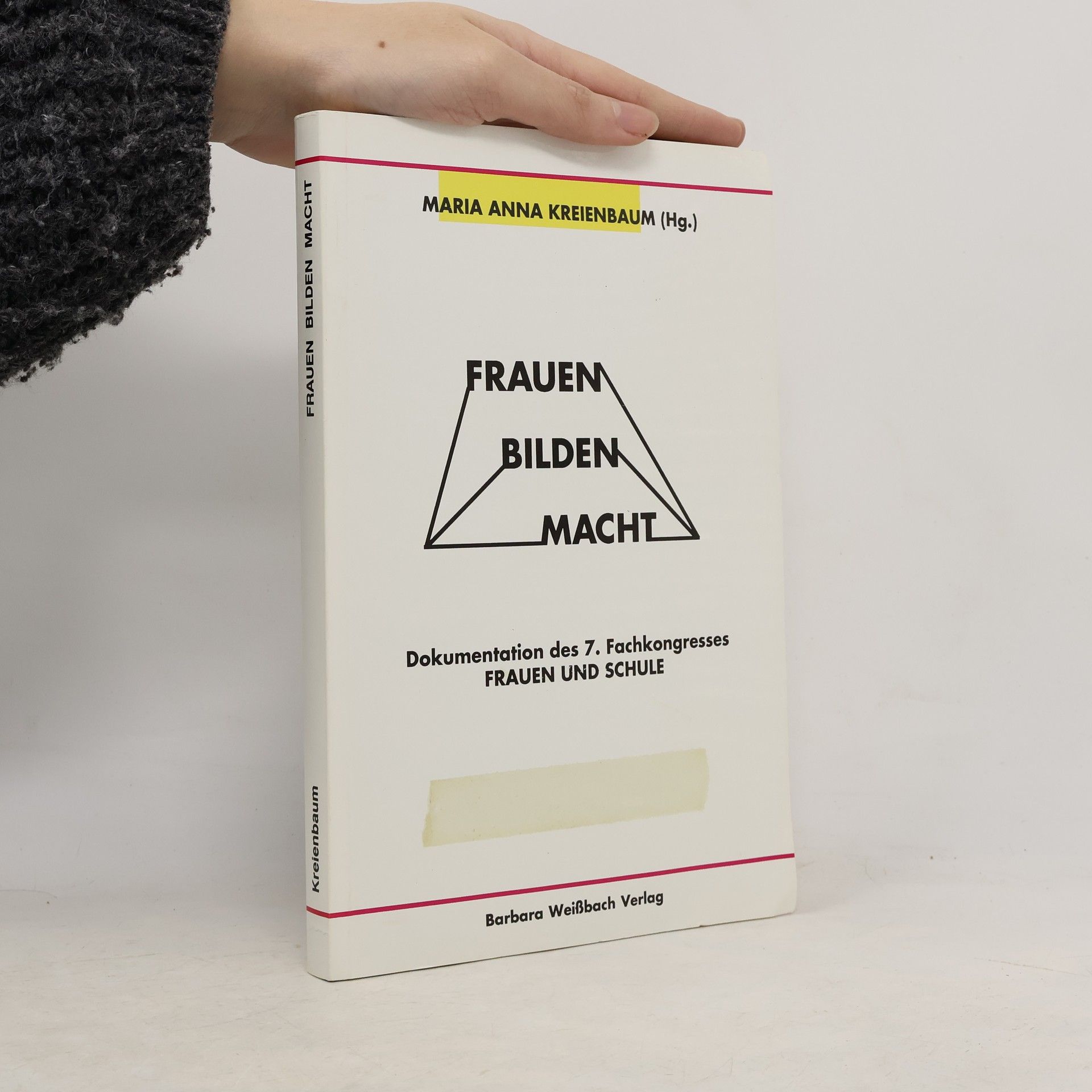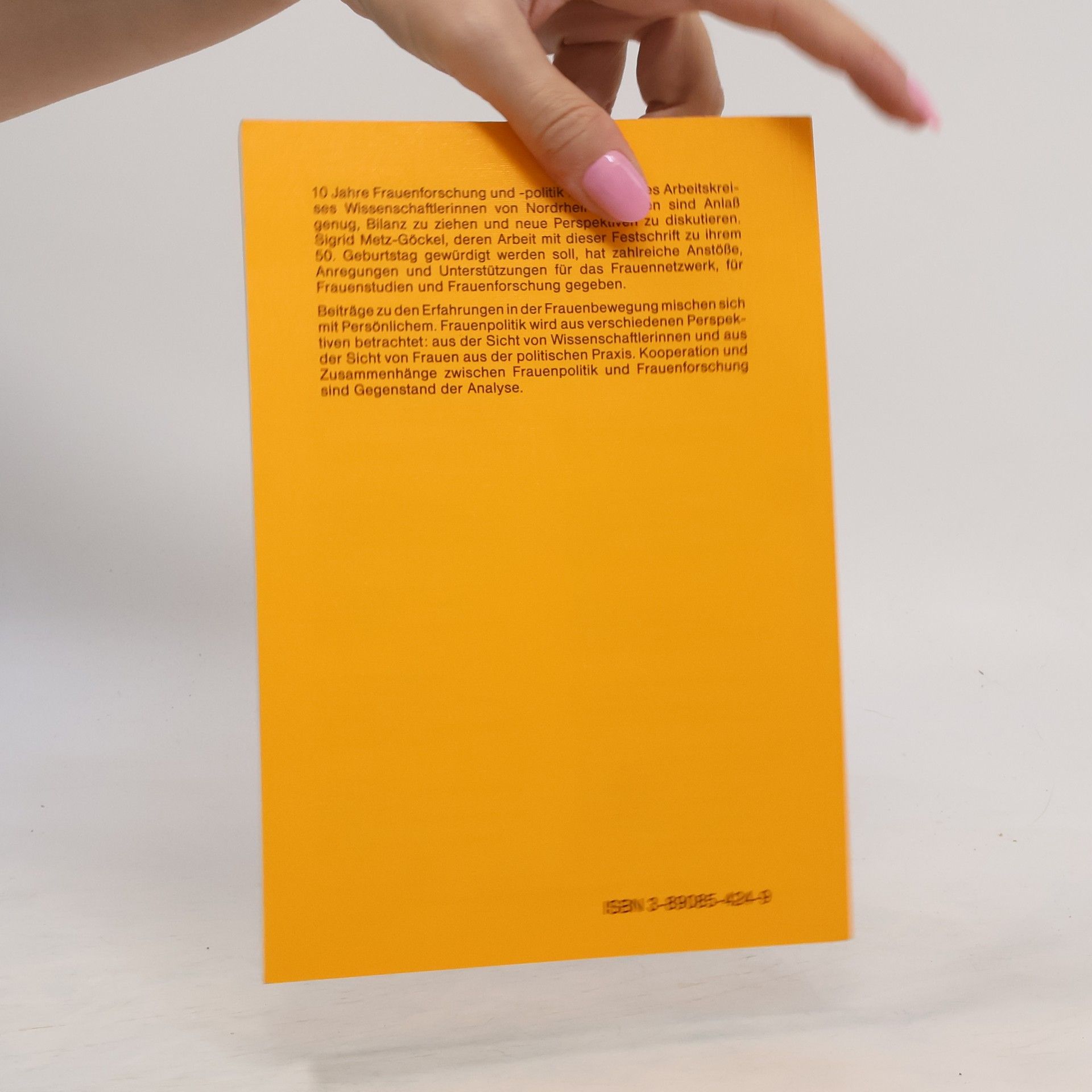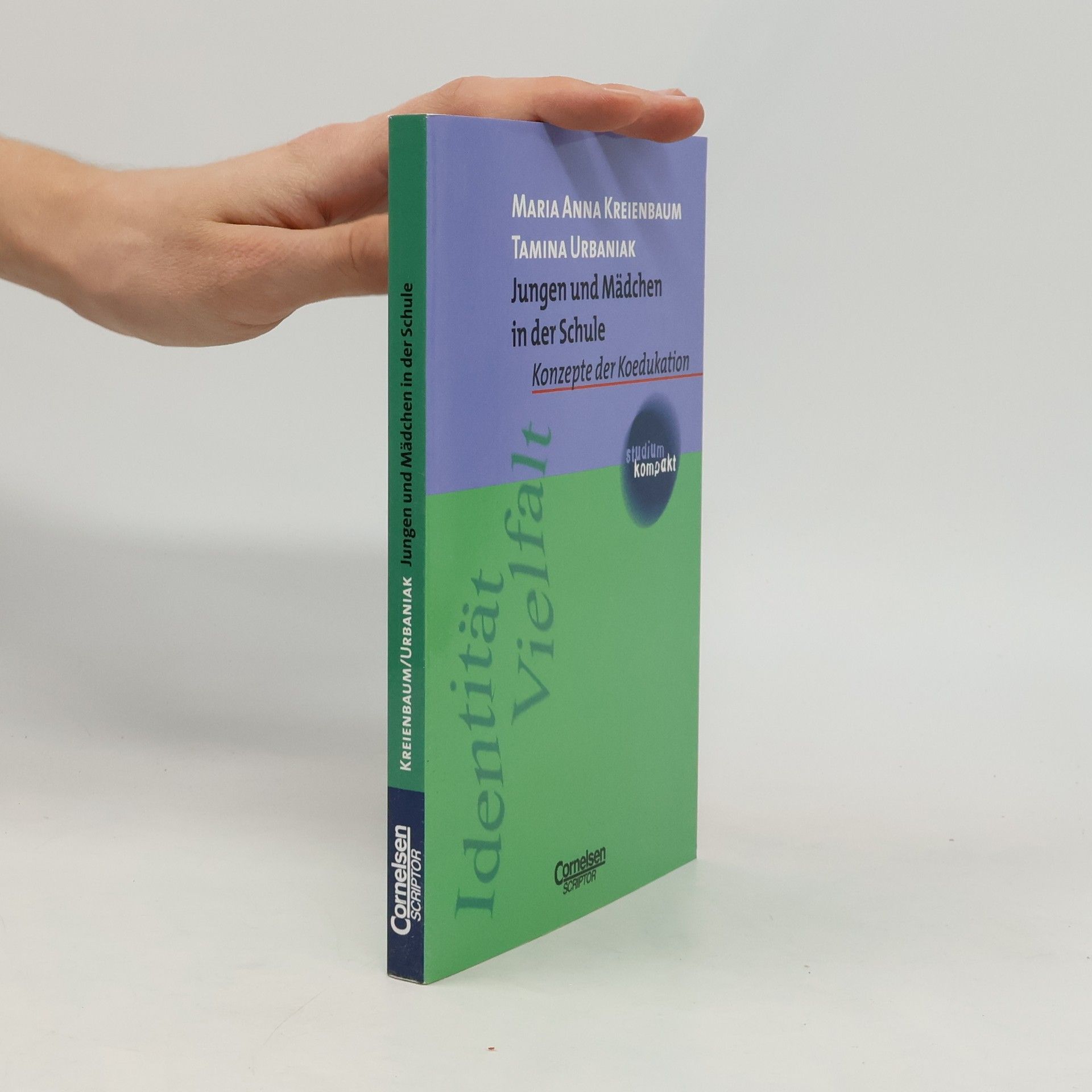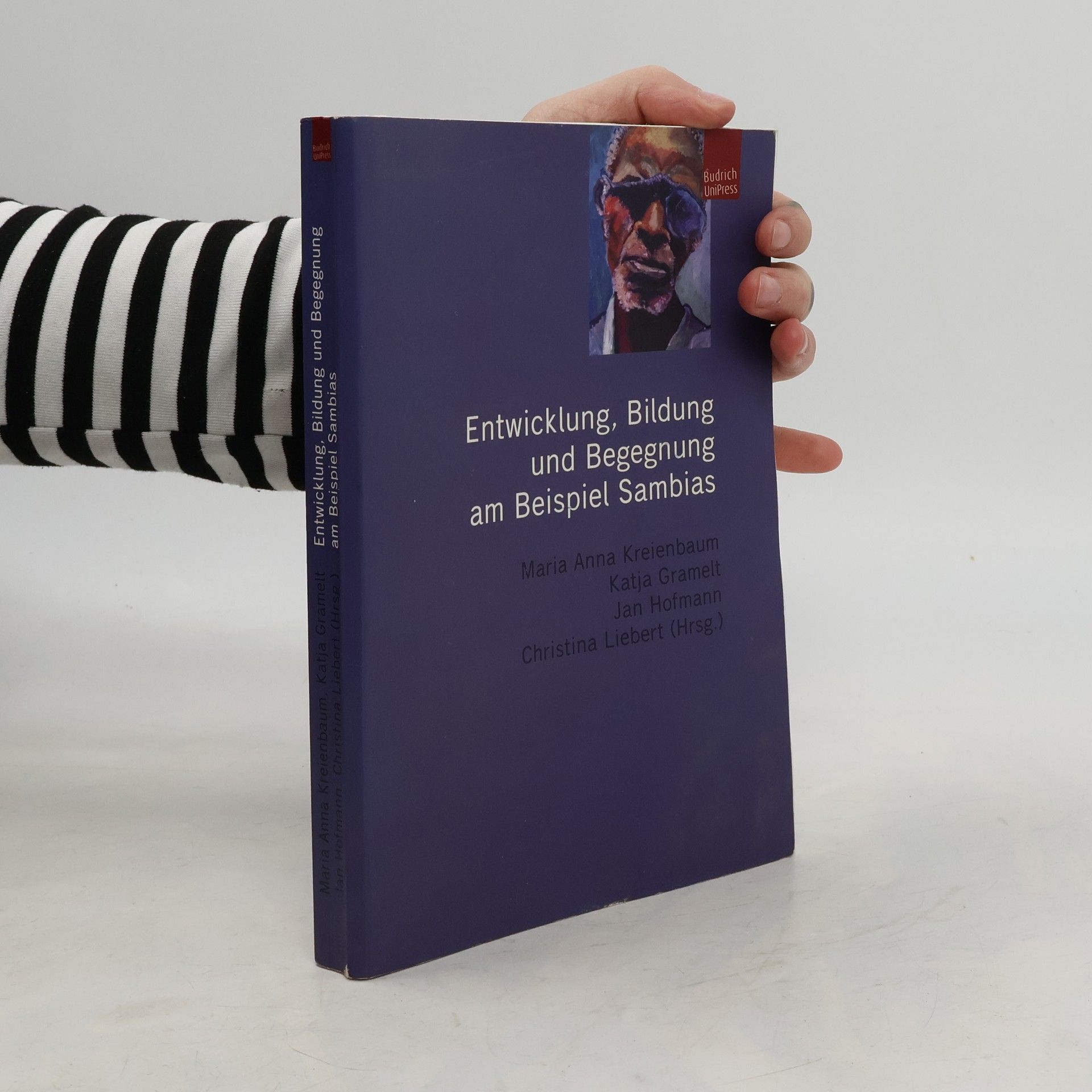Gilmore Girls – mehr als eine Fernsehserie?
Sozialwissenschaftliche Zugriffe
- 142pages
- 5 heures de lecture
Der Fernsehserien-Boom hat die Gilmore Girls auch in Deutschland populär gemacht. Die Serie behandelt Themen, die über die Suche nach dem idealen Partner hinausgehen: Lebensentwürfe, familiäre Verstrickungen, Begrenzungen und Befreiung, Selbstverwirklichung und Anpassung. Sie stellt jungen ZuschauerInnen die Frage: Wenn Rory das kann, kann ich das dann auch? Die in diesem Band versammelten Beiträge verbinden wissenschaftliche Sozialforschung mit den Unterhaltungsbedürfnissen der (vornehmlich weiblichen) Zuschauer. Es wird untersucht, was die Serie so erfolgreich macht, wie die ZuschauerInnen an sie gebunden werden und welche zentralen Themen behandelt werden. Zudem wird analysiert, welche Frauen- und Familienbilder transportiert werden und inwiefern sie Handlungsmuster für die ZuschauerInnen abbilden. Die Zugänge sind stadtsoziologisch, geschlechtertheoretisch, mediensoziologisch und sozialpsychologisch orientiert und beziehen sich auf Fernseherlebnisse, die geteilt, aber individuell interpretiert werden. Die Beiträge thematisieren unter anderem Freizeitinteressen, Medienaneignung, Geschlechterkonstruktionen und den Umgang mit Freiheit in der Serie, sowie Gemeinschaftsleben und Nostalgie in Stars Hollow.