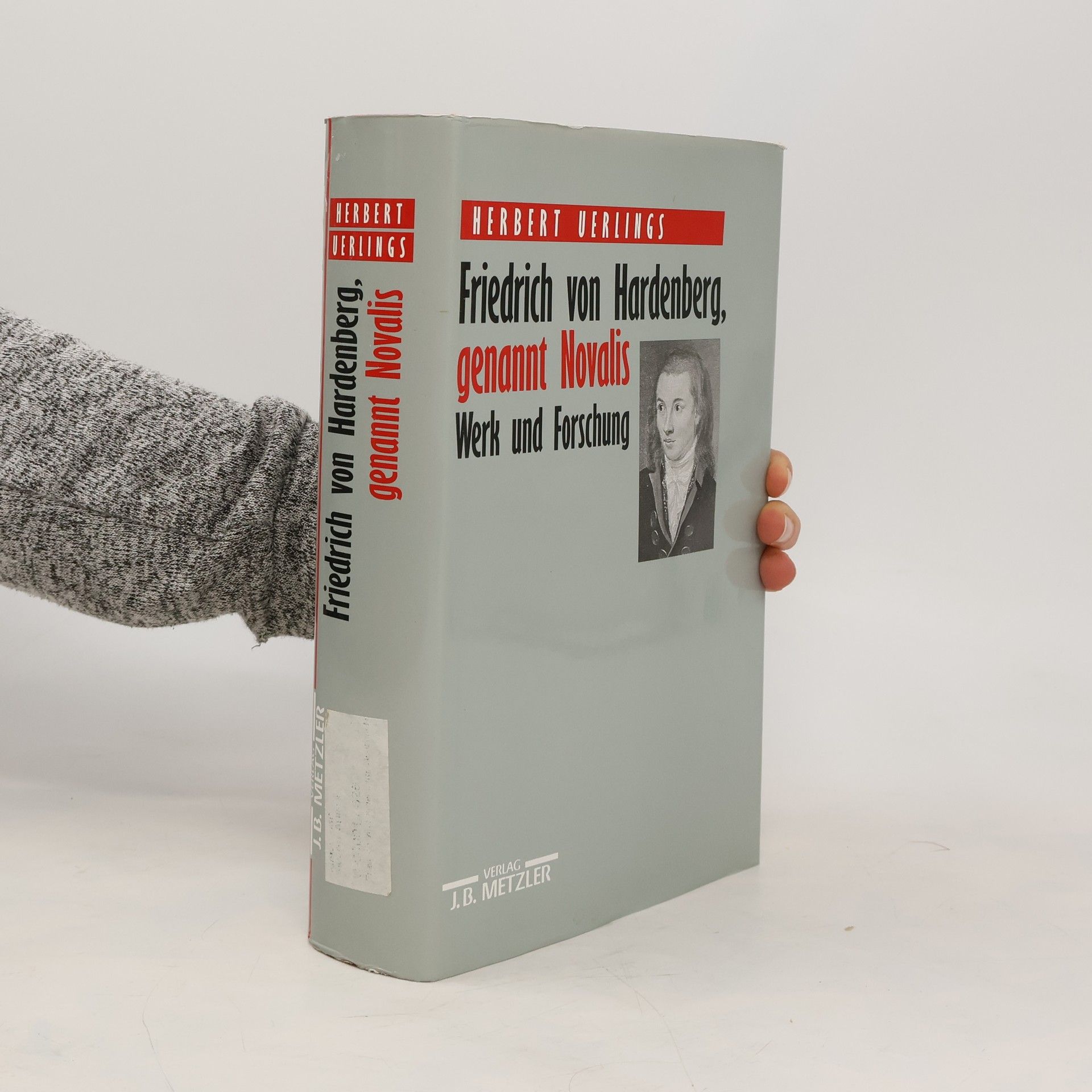Theorie der Romantik
- 435pages
- 16 heures de lecture
Die Epoche der Romantik gilt in der deutschen Literaturgeschichte als besonders theorielastig. Dabei waren die Theorien der Romantiker immer auch solche über die Romantik selbst, romantisches Denken verfolgte bewußt neben der bekannten Zielrichtung der Universalität auch stets das der Selbstreflexivität. Die Auswahl des Bandes orientiert sich an den von den Romantikern gesetzten Schwerpunkten: es geht um Fragen der Poesie und Poetik, der literarischen Kritik, der Philosophie im weiteren Sinne und der Religion, der bildenden Kunst, Musik und schließlich der Geschichte, Politik und Naturwissenschaft. Reclams Bände zu den Theorien literarischer Epochen bieten zunächst eine profunde Einleitung zur Epoche selbst. Es folgen, nach Themen geordnet, Texte zeitgenössischer Akteure oder unmittelbar nachfolgender Generationen, die eine umfassende Reflexion der sich herausbildenden Epoche bieten. Lieferbar sind Bände zu Klassik, Romantik, Realismus, Naturalismus und Expressionismus.