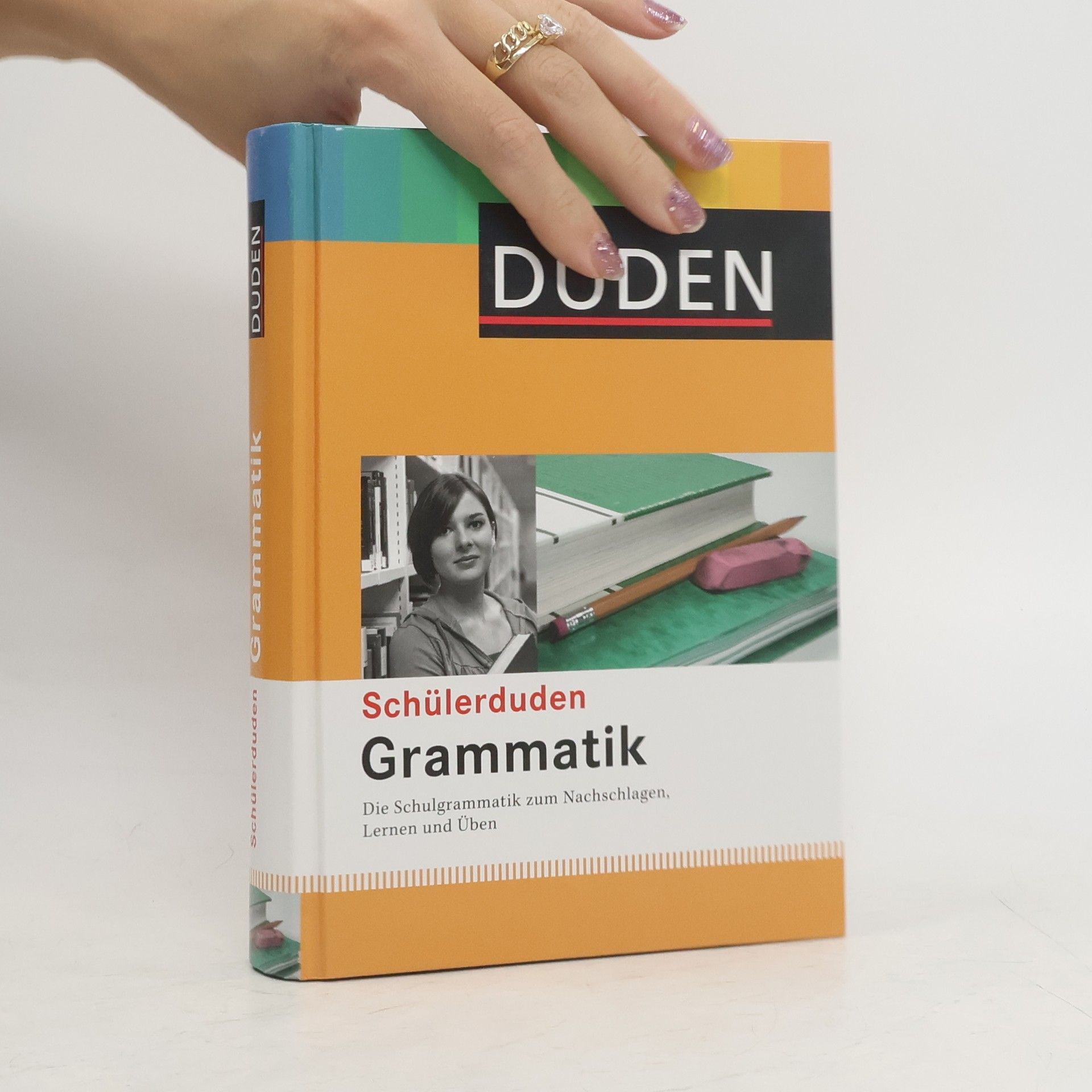Diese Grammatik stellt die Grundstrukturen der deutschen Sprache verständlich und schülergerecht dar und erleichtert mit zahlreichen Übersichten und Tabellen das Lernen. Inhaltlich wird der Bogen gespannt von den kleinsten Bausteinen der Sprache - den Lauten und Buchstaben - über die Wort- und Formenlehre bis hin zum Satzbau. Das Kapitel "Sprechen und Schreiben" führt über die eigentliche Grammatik hinaus und erläutert Sprache in ihrer Funktion als gesprochenes und geschriebenes Verständigungsmittel.
Roman Looser Livres