Mutter mit 40, geht das denn? Ja, denn äspäteä Mütter haben häufiger als befürchtet unkomplizierte Schwangerschaften und gehen das Kinderkriegen meist entspannter an. Die Autoren, beide erfahrene Frauenärzte und selbst äspäte Elternä, haben beobachtet, wie gut sogenannte Risikoschwangerschaften tatsächlich verlaufen und wollen äreifen Elternä Mut machen. Mit vielen Interviews und Erfahrungsberichten.
Christine Biermann Livres

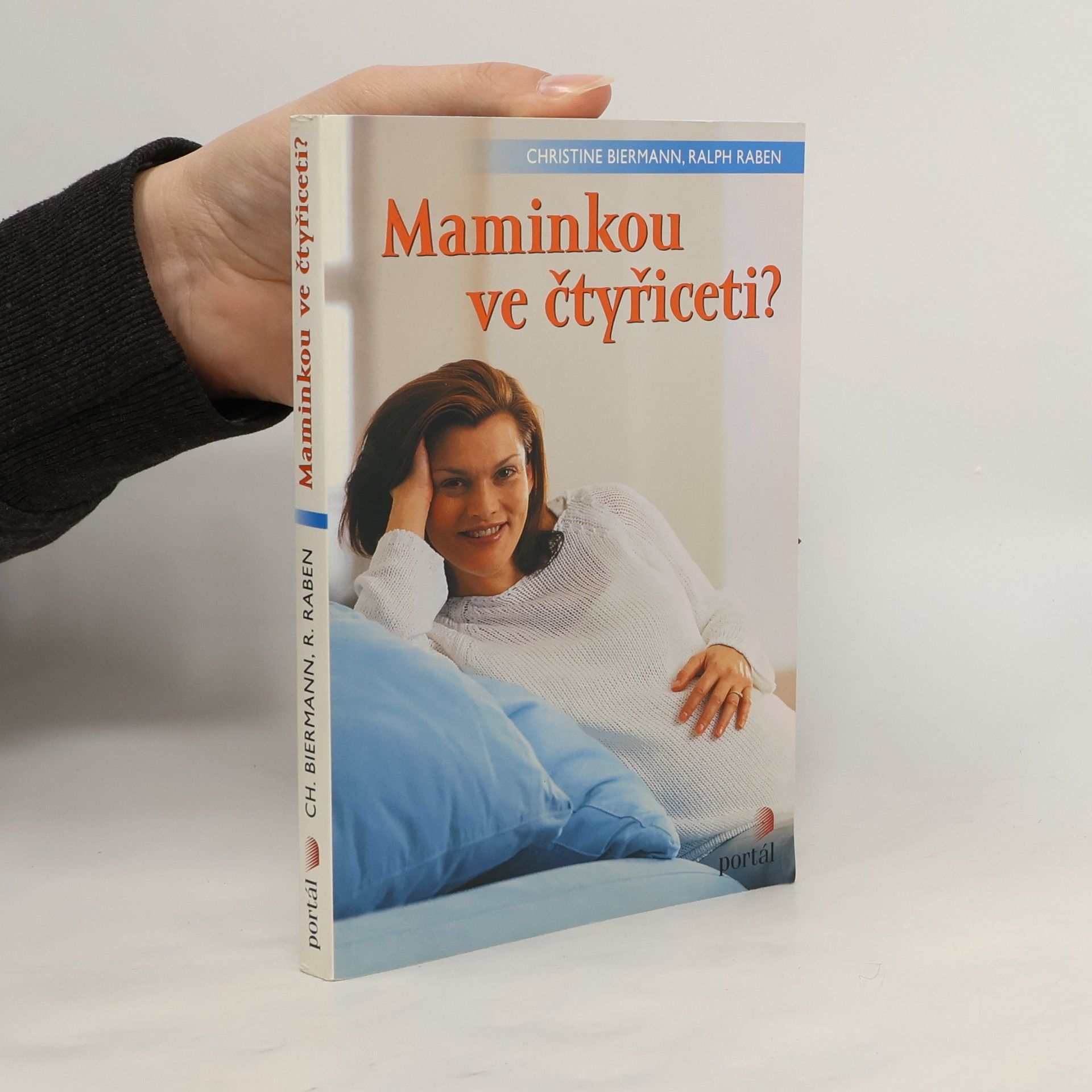
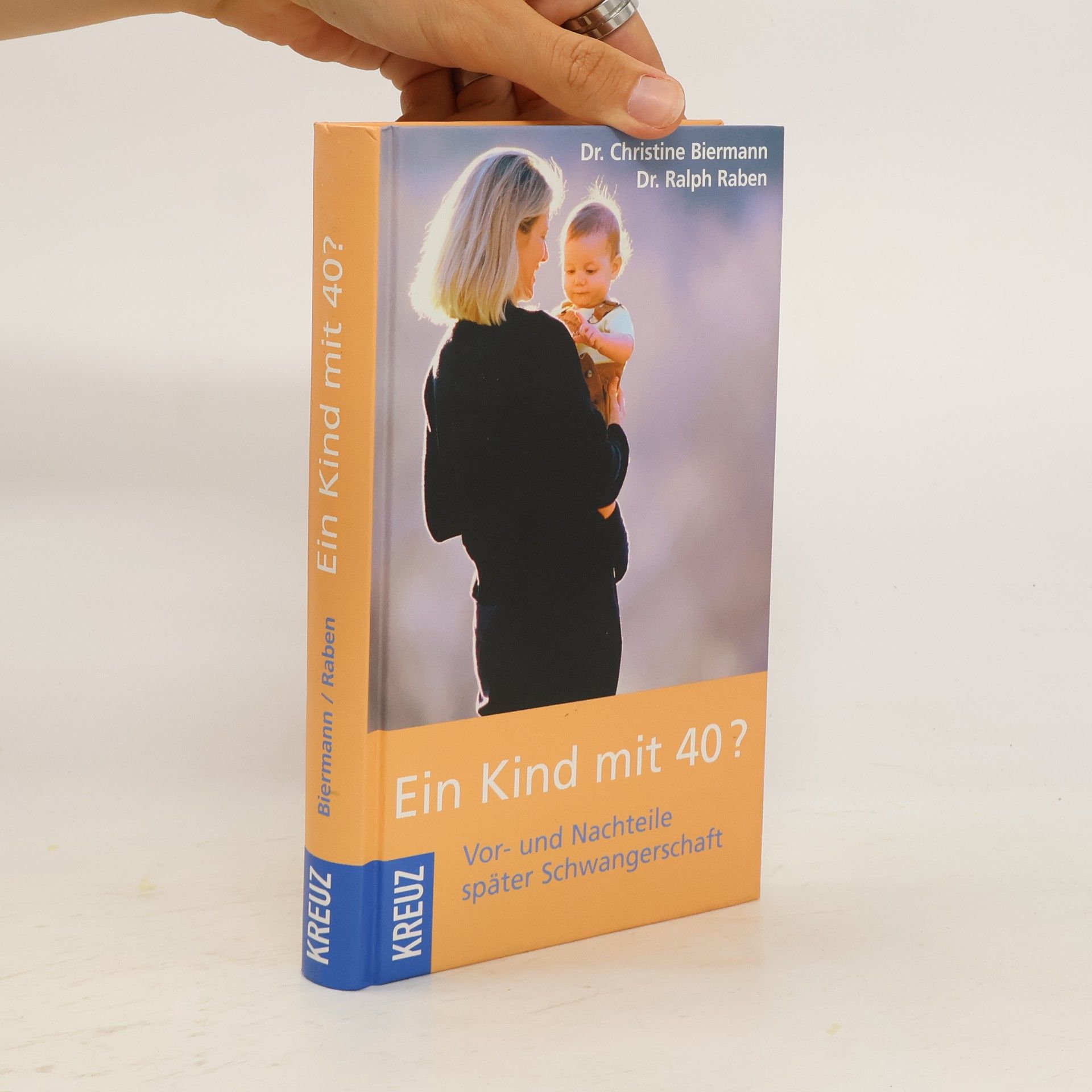
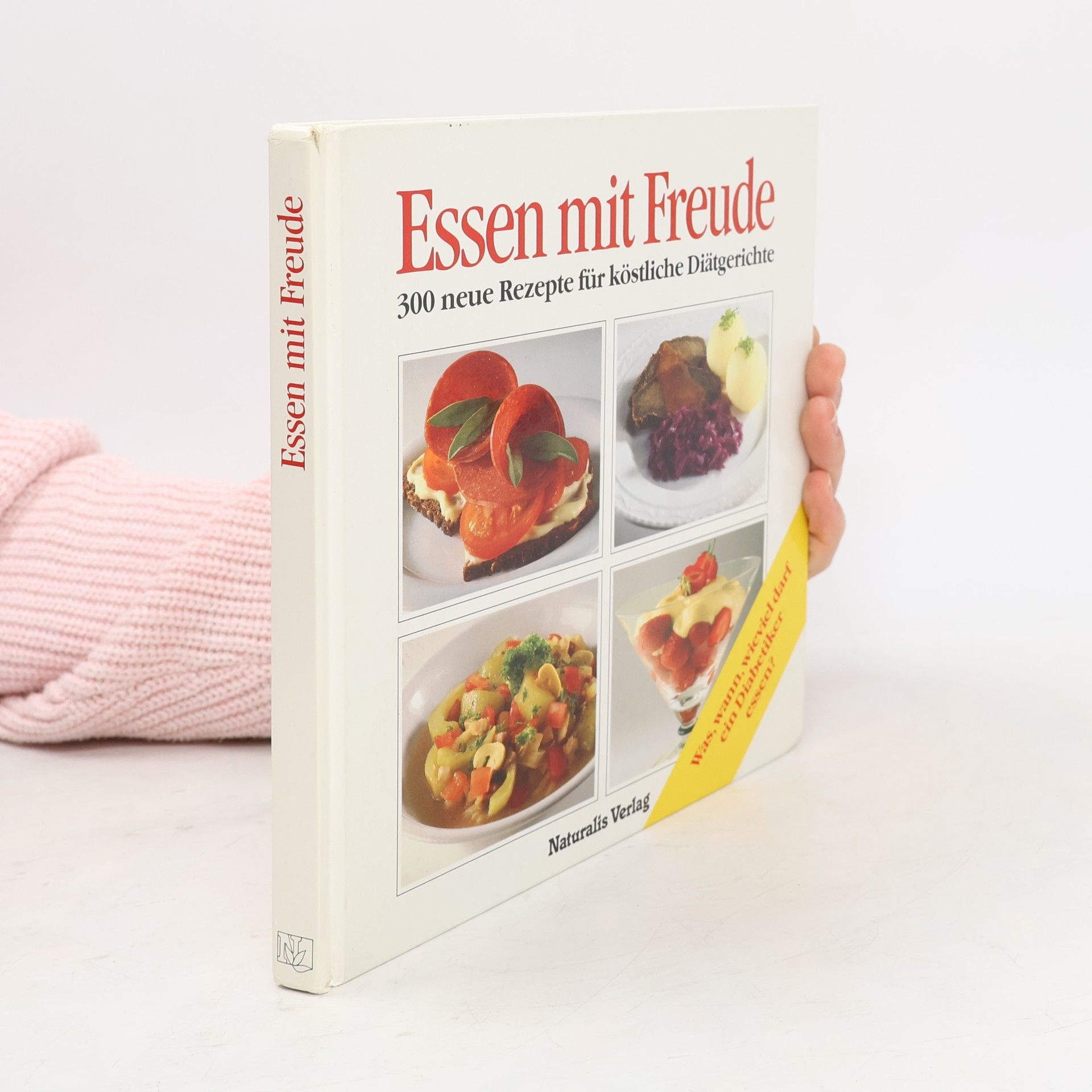

Immer mehr Frauen entscheiden sich im Alter von knapp 40 Jahren oder darüber für ein Kind. Diese 'späten Mütter' haben häufiger als erwartet unkomplizierte Schwangerschaften, natürliche Geburten, gesunde Kinder und bieten den Kindern in den meisten Fällen ein emotional und sozial gesichertes Zuhause. Bei ihrer täglichen Arbeit als Frauenärzte haben die Autoren staunend beobachtet, wie gut die so genannten Risikoschwangerschaften und -geburten tatsächlich verlaufen. So will das Buch 'reifen' Müttern Mut machen. Es enthält viele Interviews und Erfahrungsberichte sowie zahlreiche Details zu Chancen und Risiken der späten Schwangerschaft.
Maminkou ve čtyřiceti?
- 178pages
- 7 heures de lecture
Kniha zvažuje z lékařského hlediska důvody, výhody a rizika pozdního těhotenství a mateřství.
Schüler - 97: Stars - Idole - Vorbilder
- 128pages
- 5 heures de lecture