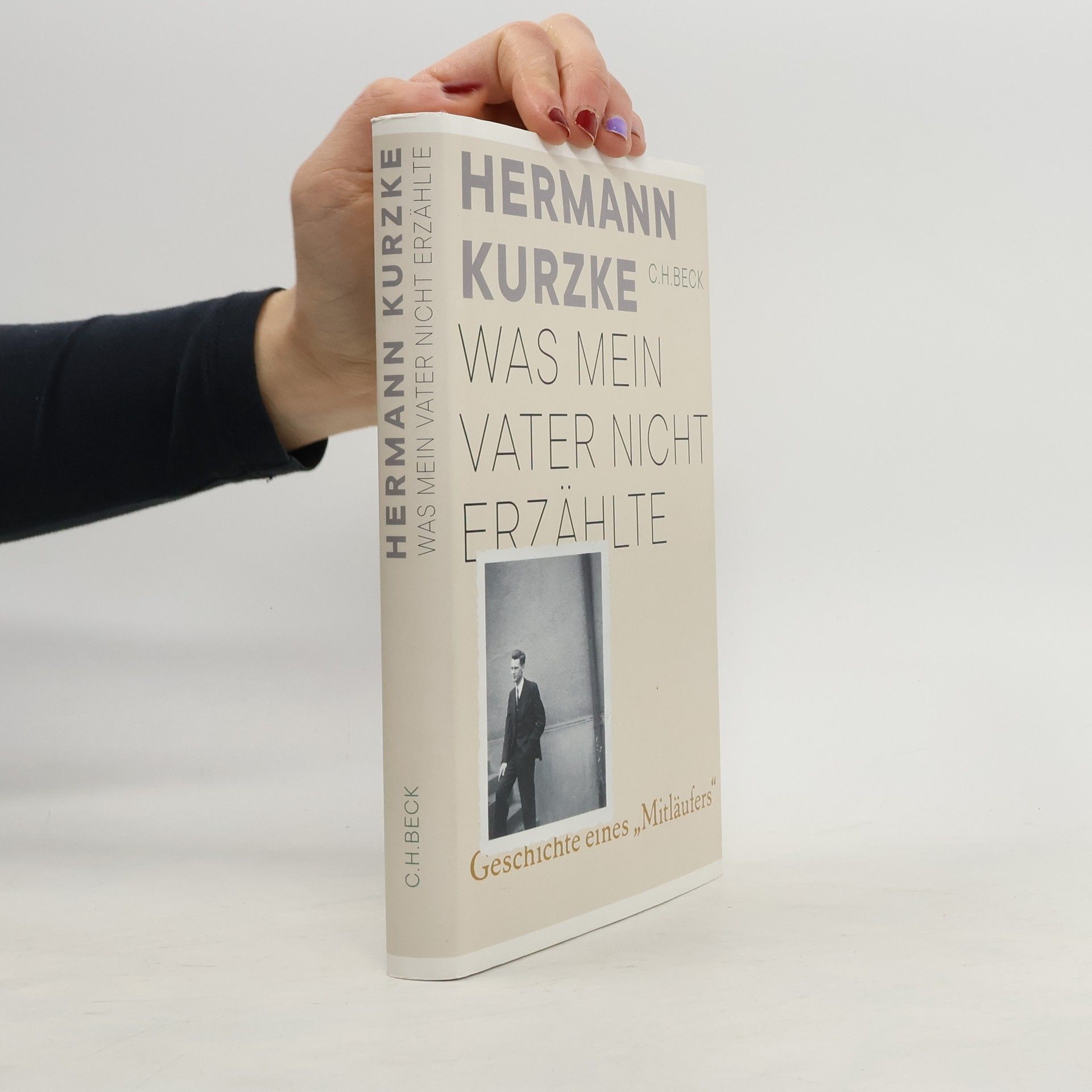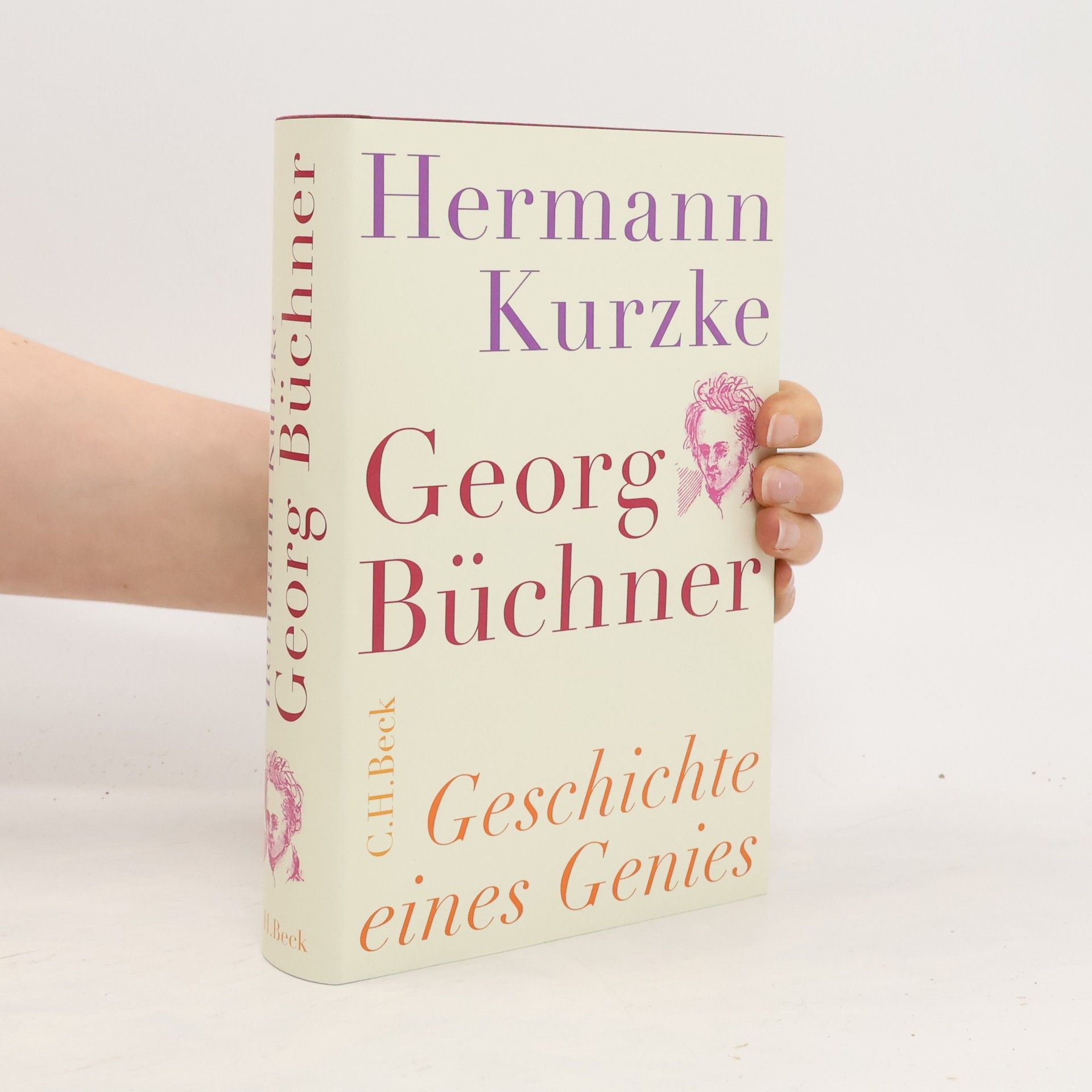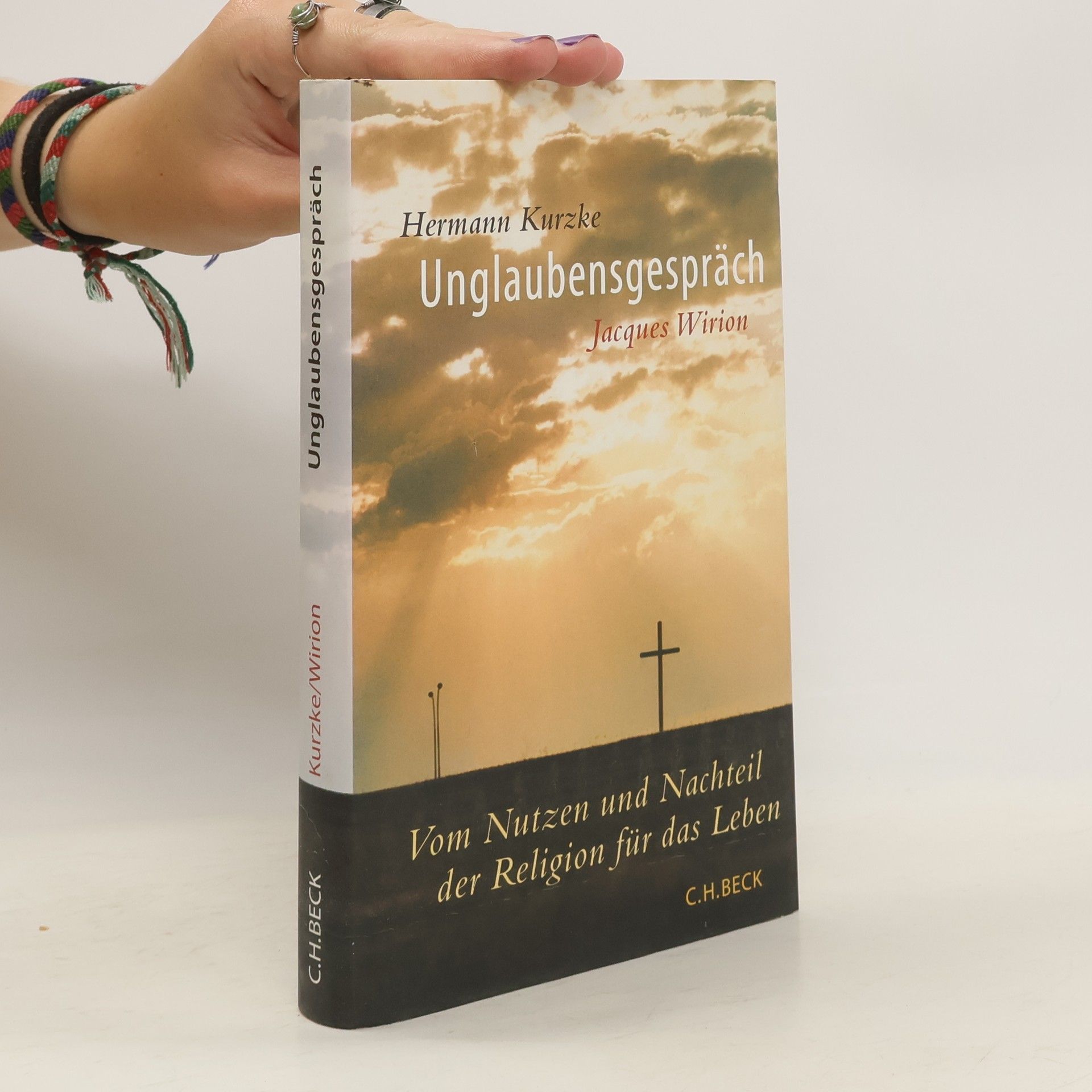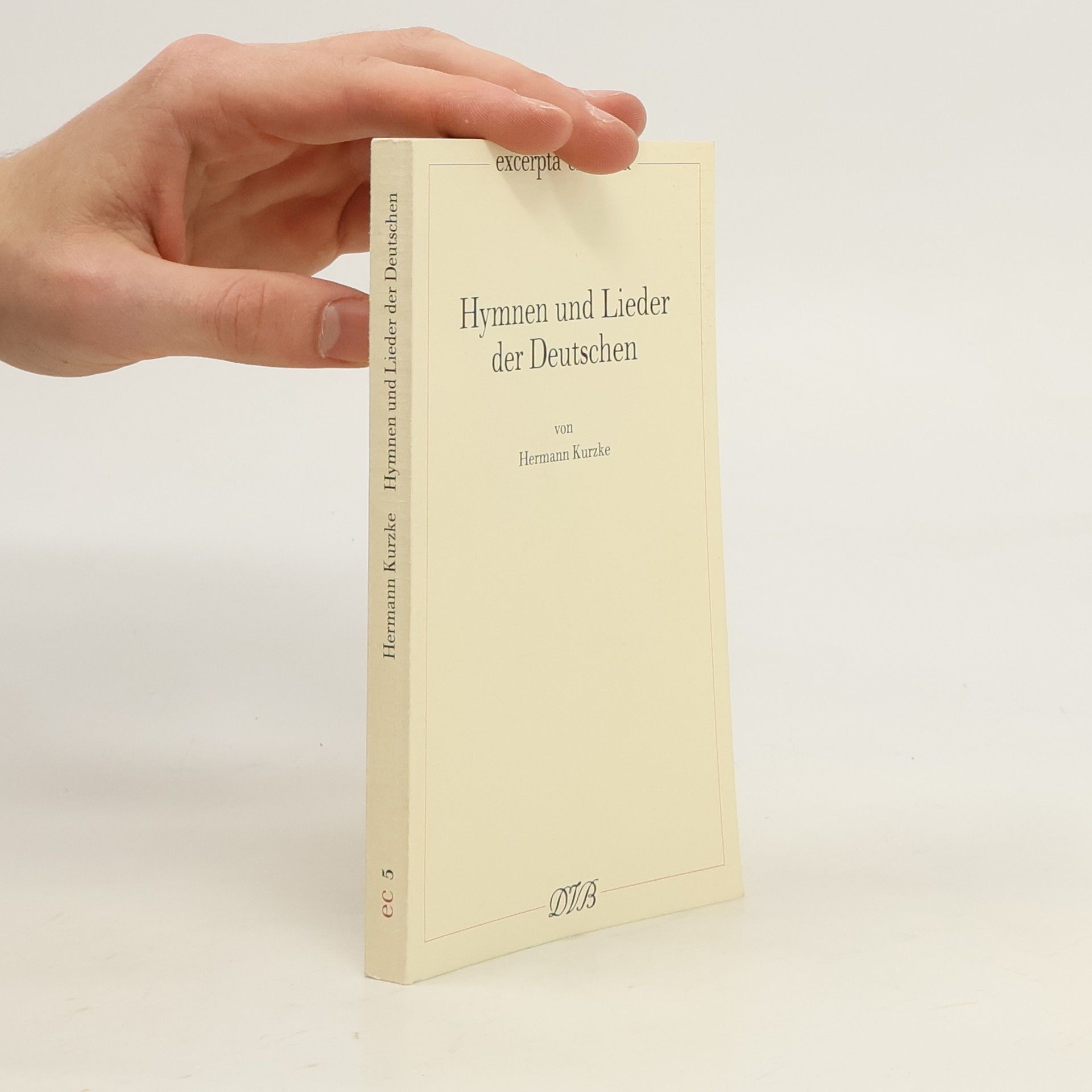Die kürzeste Geschichte der deutschen Literatur und andere Essays
- 255pages
- 9 heures de lecture
Kurzkes Kanon Hermann Kurzke ist nicht nur ein Spezialist für Thomas Mann, Kirchenlieder und Kulturchristentum, sondern ein Essayist von Graden. Aus dem Plan zu einer großen Literaturgeschichte entstand vorerst eine kleine, persönliche: Kurzkes Kanon> betitelt, und schließlich, noch weiter verdichtet, Die kürzeste Geschichte der deutschen Literatur. Sie ist die Bildungsgeschichte ihres Autors, aber zugleich wie beiläufig ein Ausschnitt der Bildungsgeschichte der deutschen Nation. Der Bogen reicht von Goethe, Novalis und Büchner über Bertolt Brecht und Thomas Mann, Ernst Jünger und Reinhold Schneider bis zu Günter Grass und Martin Walser. Der Ton dieser Prosa ist pointiert, exakt und zugleich emotional. Kurzkes Essays, Porträts und Betrachtungen öffnen einen neuen Zugang zur deutschen Literatur.