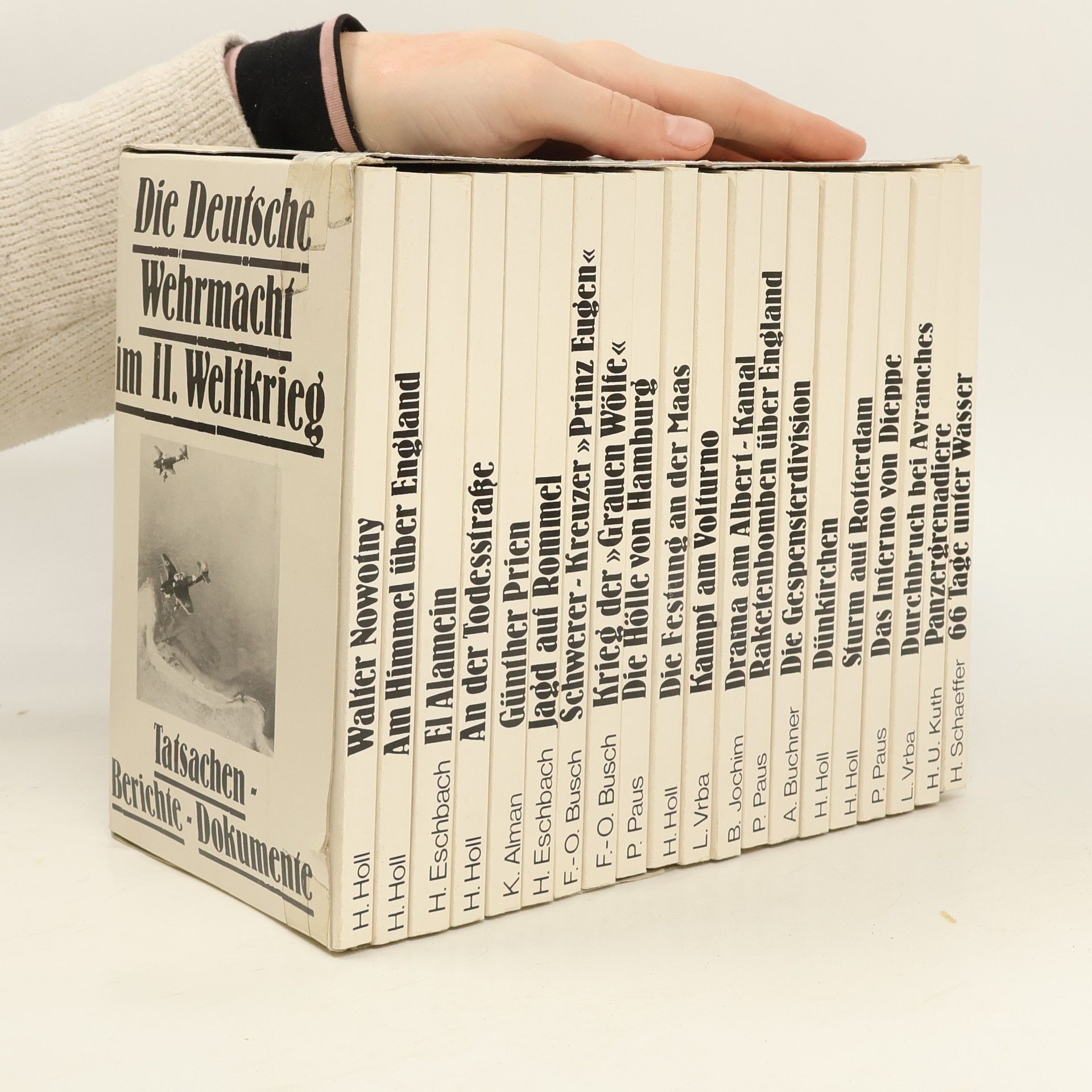Pharmacology and the Skin - 3: Pharmacology of Retinoids in the Skin
- 282pages
- 10 heures de lecture
292 pp., Hardcover, ex library, else text clean and binding tight. *Buyer is responsible for any additional duties, taxes, or fees required by recipient's country* - If you are reading this, this item is actually (physically) in our stock and ready for shipment once ordered. We are not bookjackers.