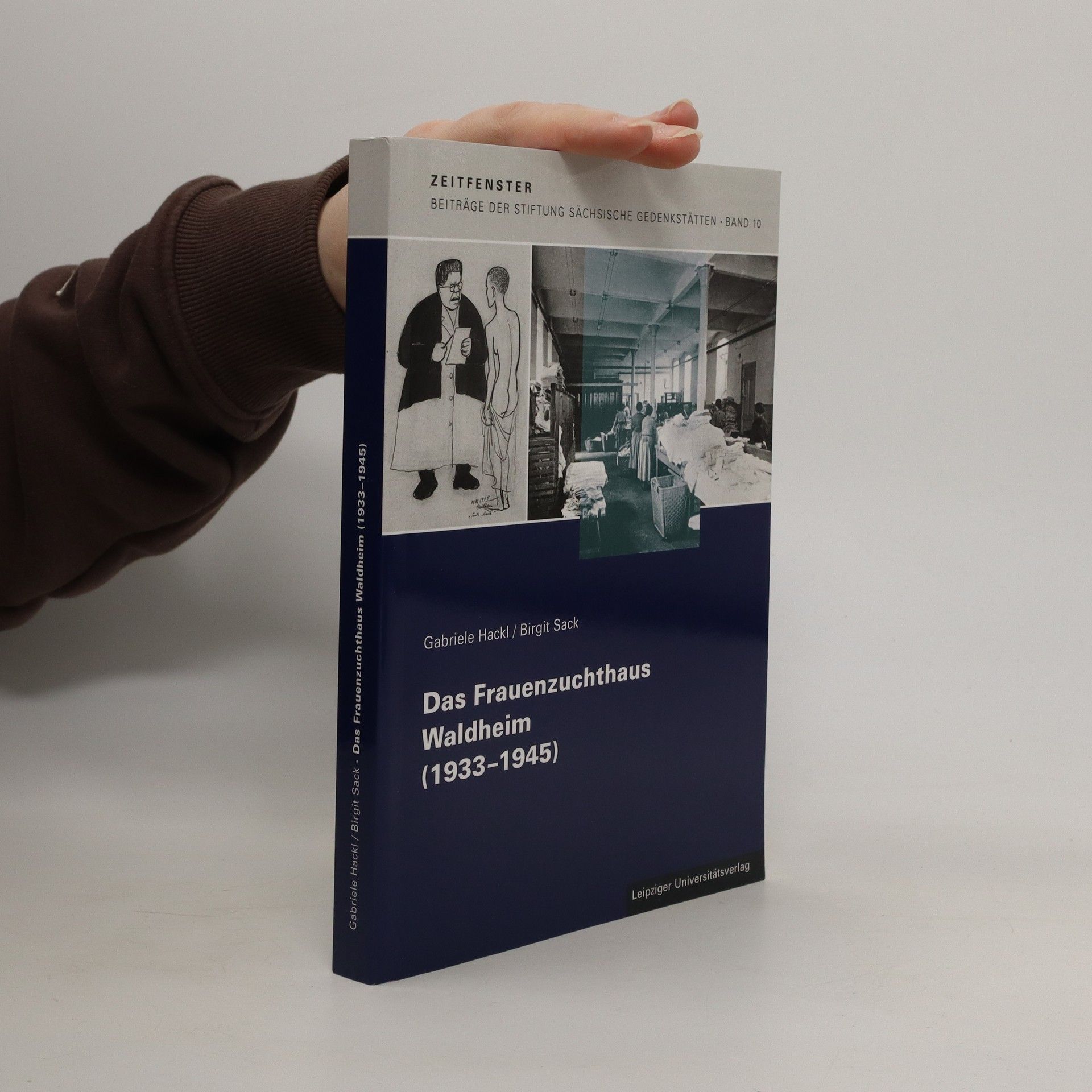Tento dopis si nechte na památku na mě. Behaltet diesen Brief als Andenken an mich.
- 496pages
- 18 heures de lecture
V nacistickém Německu bylo v Drážďanech mezi lety 1934-1945 popraveno 892 Čechoslováků, většina z nich se postavila proti německé okupaci. Dvojjazyčná česko-německá kritická edice obsahuje životopisy odsouzených a přibližně sto posledních dopisů, které mohli napsat příbuzným. Historikům Pavle Plaché a Birgit Sack se v rámci projektu Ústavu pro studium totalitních režimů ČR a Památníku Münchner Platz podařilo tyto dopisy dohledat a analyzovat. V úvodu zkoumají dopisy jako specifické historické prameny, přičemž se zaměřují na okolnosti jejich vzniku a obsahový rozbor. Odsouzení mohli napsat poslední dopis po zamítnutí žádosti o milost a byli informováni o čase popravy, což činí tyto dokumenty jedinečnými. Dopisy byly psány v rodném jazyce, což bylo privilegium, a podléhaly cenzuře, což vedlo k autocenzuře pisatelů. Většina autorů dopisů byla odsouzena kvůli účasti v protinacistickém odboji, ale někteří byli potrestáni za kriminální činy. Mnozí z odsouzených se necítili být vázáni přísnými hospodářskými nařízeními, a proto se v dopisech označovali jako nevinní. Německé justiční orgány často interpretovaly jejich delikty jako akt odporu proti okupaci.