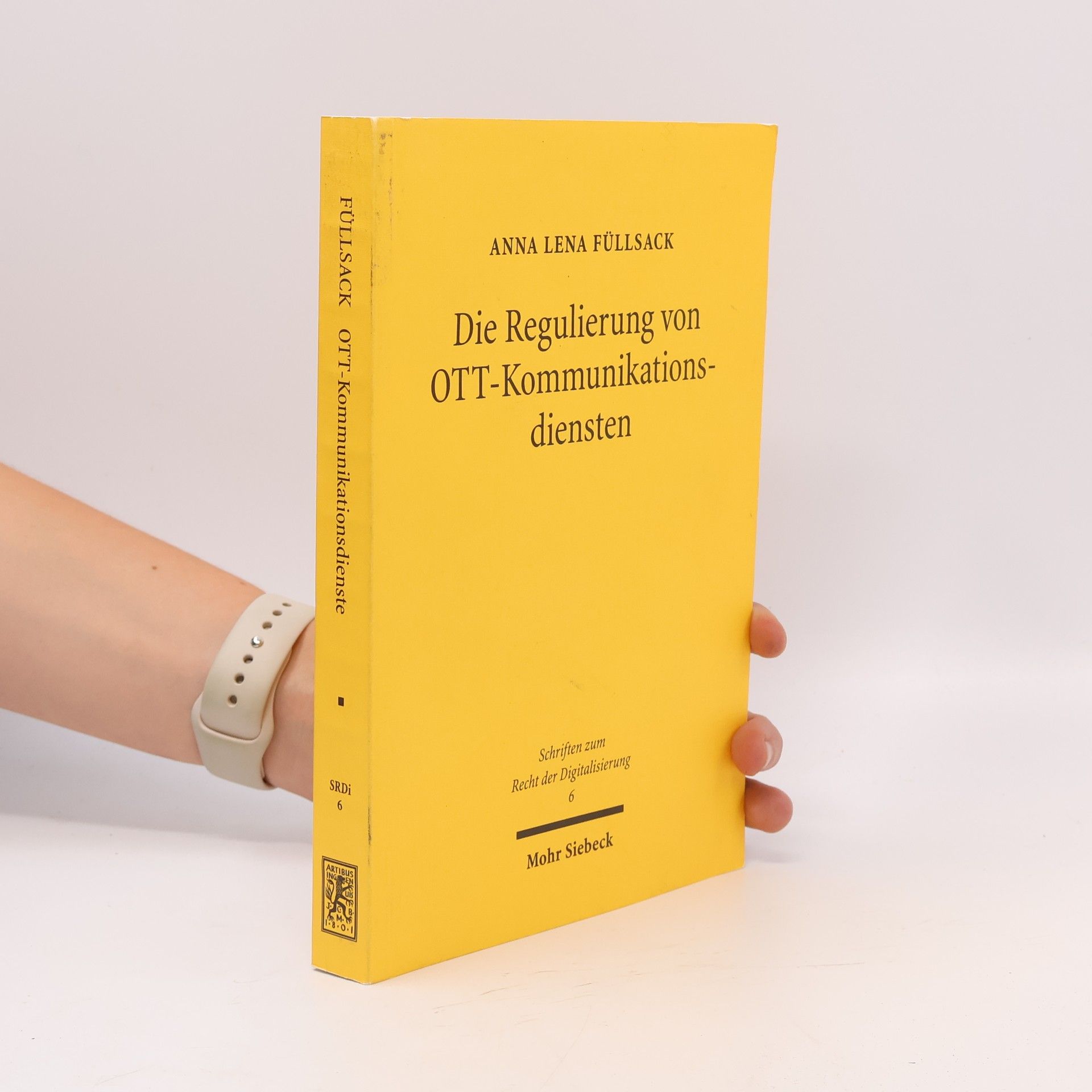Die Regulierung von OTT-Kommunikationsdiensten
Eine rechtliche Analyse von Over-the-Top-Kommunikationsdiensten unter besonderer Berücksichtigung des sich wandelnden Telekommunikationsrechtsrahmens
Die digitale Disruption ist eine der prägenden Entwicklungen des 21. Jahrhunderts. Immer neue, sich stetig wandelnde Geschäftsmodelle müssen in den regulatorischen Rahmen der analogen Welt eingefügt werden. Besonderes Augenmerk gebührt dabei der Telekommunikationsbranche, wo digitale Innovationen in den vergangenen Jahren das globale Kommunikationsverhalten umbruchartig verändert haben. Exemplarisch für diese Entwicklungen untersucht Anna Lena Füllsack die Regulierung der derzeit wohl bedeutendsten Erscheinungsform elektronischer Kommunikation: sog. Over-the-Top-Kommunikationsdienste. Auf der Grundlage einer Analyse der geltenden lex lata sowie des europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation und des Entwurfs der geplanten ePrivacy-Verordnung beleuchtet sie die derzeit bestehende regulatorische Ungleichbehandlung. Anschließend untersucht sie, inwiefern die Regelungen des TKG geändert und angepasst werden müssen, um künftig sowohl den unionsrechtlichen Vorgaben als auch dem technologischen Fortschritt gerecht zu werden.