Dieser Band widmet sich dem weiten Feld des Selbstverteidigungstrainings. Nahezu alle Kampfkünste / Kampfsportarten weisen diesbezüglich ihre besondere Kompetenz aus. Doch nicht jeder möchte durch jahrelanges intensives Training Experte eines Kampfsystems werden. Vielmehr besteht häufig der Wunsch durch einfache und dennoch wirkungsvolle Maßnahmen Handlungskompetenzen zu erwerben. Diesem Bedürfnis nachzukommen, gestaltet sich für viele Trainer, Kursleiter aber auch Sportlehrer äußert schwierig, da methodische Konzepte für ein solches Anliegen rar sind. Häufig fehlen auch Ideen und Anregungen, wie in oft inhomogenen Übungsgruppen befriedigende Fortschritte erzielt werden können. Im Wissen um diese Problematik wurde aus einer langjährigen Tätigkeit auf diesem Gebiet heraus ein Unterrichtskonzept entworfen und erprobt. Entstanden ist ein Leitfaden und Ideenlieferant für Ausbilder wie Auszubildende. In praxisnaher Form wird ein Modell für das Selbstverteidigungstraining vorgestellt.
Ingo Friedrich Livres
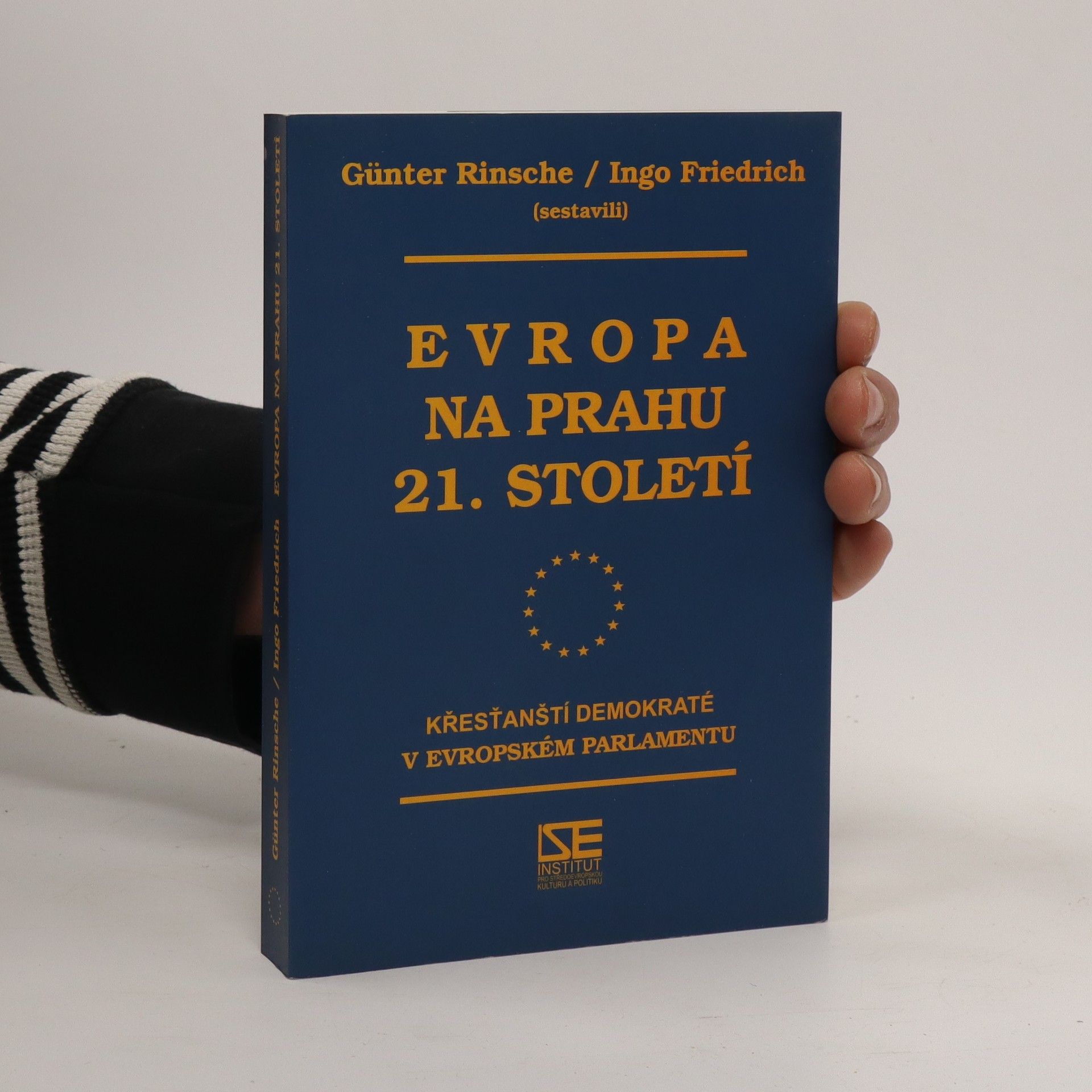

Evropa na prahu 21. století. Křesťanští demokraté v evropském parlamentu
- 376pages
- 14 heures de lecture
Kniha se zaměřuje na přínos křesťanských demokratů (především německých) v Evropském parlamentu v evropském integračním procesu.