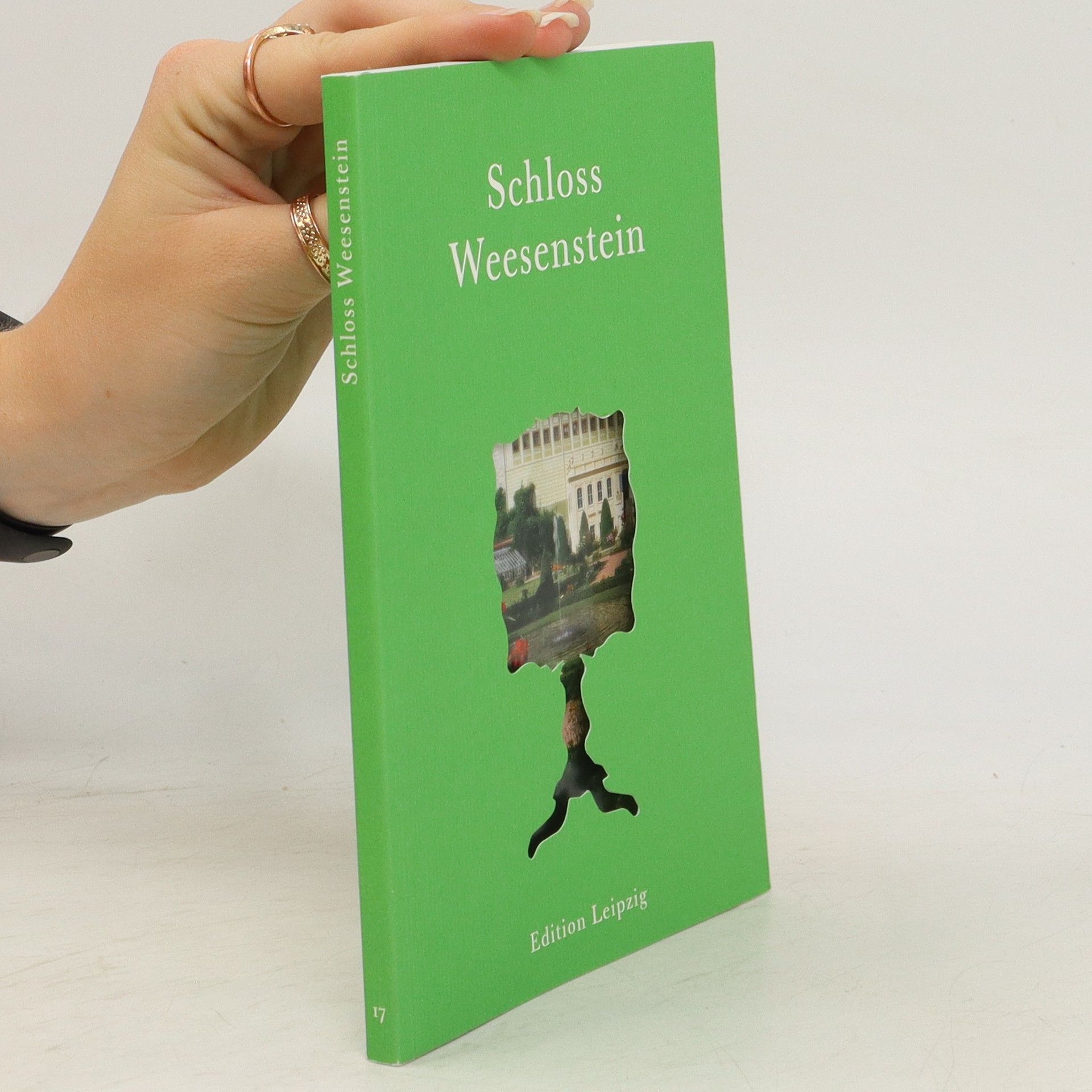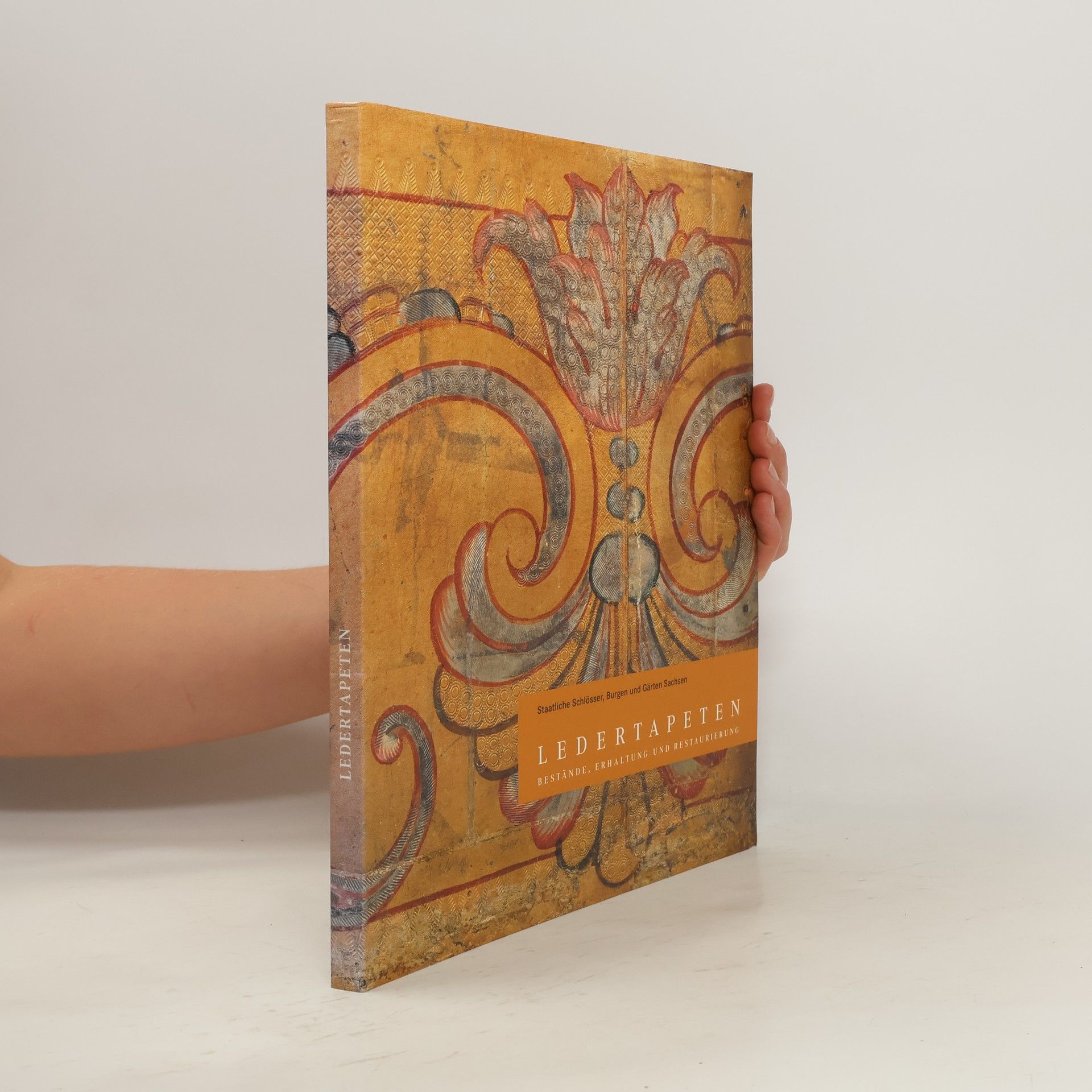Johann Friedrich Böhler
Ein Künstler des 18. Jahrhunderts in Thüringen
Der Bildschnitzer und Bildhauer Johann Friedrich Böhler (1713?1784) war eine der merkwürdigsten und interessantesten Künstlerpersönlichkeiten des 18. Jahrhunderts in Thüringen. Er wirkte vor allem in seiner Heimat ? dem Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen ?, aber auch im Herzogtum Sachsen-Gotha. Seine kleinplastischen Werke, die bei Adel wie Bürgertum gleichermaßen geschätzt wurden, fanden weit über Thüringen hinaus Verbreitung. Böhlers Repertoire reichte von allegorischen Figuren, Kunstkammerstücken, Chinoiserien und Burlesken bis hin zu Tierdarstellungen und Jagdmotiven. Besondere Anerkennung erlangte er durch die Naturtreue seiner Jagdstücke. Trotz seiner Nähe zu Fürstenhöfen war Böhler kein typischer Hofkünstler, sondern wahrte konsequent seine Unabhängigkeit. Als Autodidakt, der alles sich selbst verdankte, empfand er einen unbändigen Stolz auf seine Naturbegabung, der hartnäckig zu folgen er den Mut gehabt hatte. ? Nachdem Böhler lange Zeit nur Spezialisten bekannt war, wird er hier anhand seiner im Schlossmuseum Arnstadt und im Schlossmuseum Sondershausen überlieferten Werke nun einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt