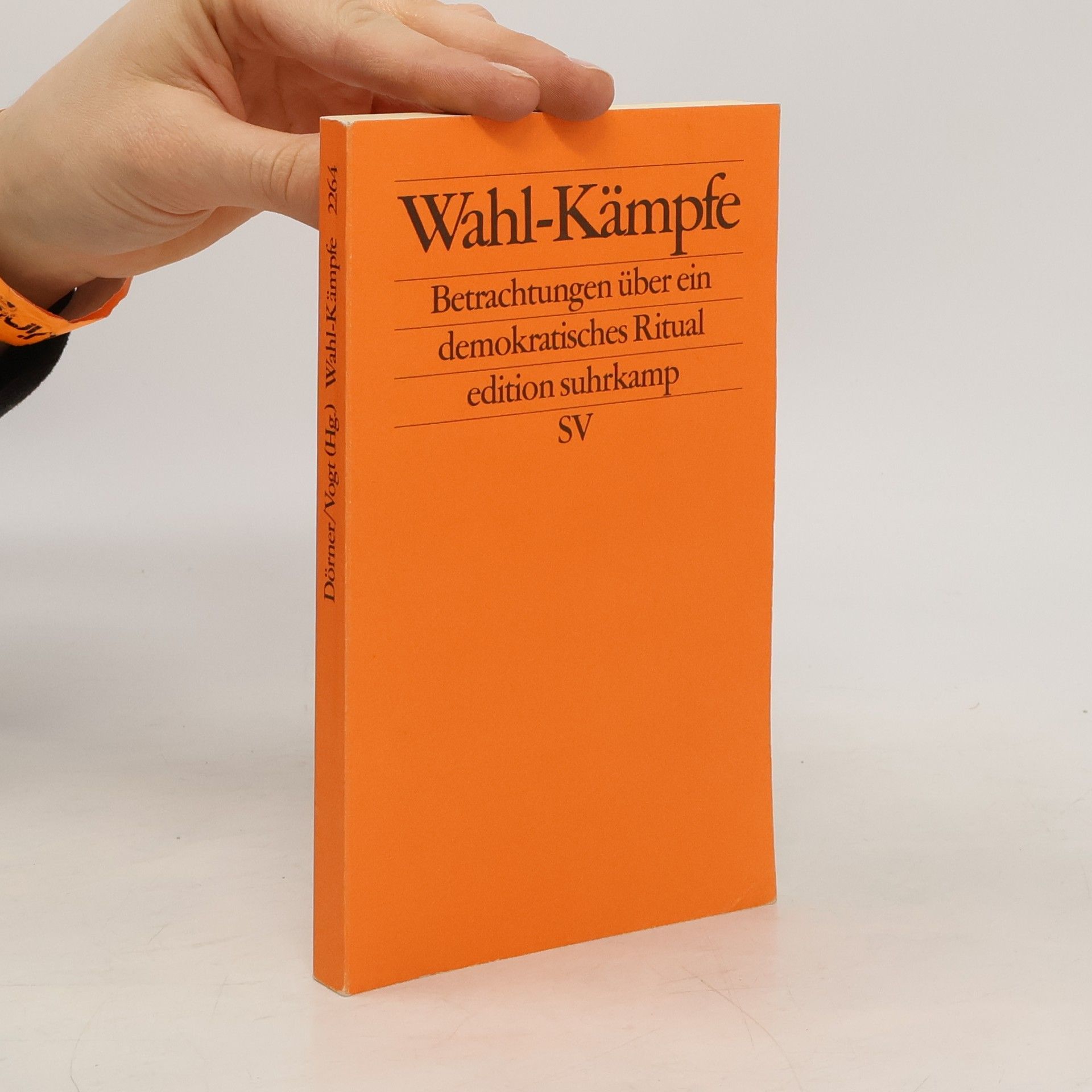Politainment
Politik in der medialen Erlebnisgesellschaft
Das Buch entwickelt zunächst einige theoretische Perspektiven, um dann konkret Formen und Funktionen des Politainment zu untersuchen: vom inszenierten Wahlkampfauftritt bis zur Vorabendserie, von der Talk-Show bis zum Polit-Krimi. Zugleich werden in anschaulicher Weise Modelle des Bürgersinns, der Gemeinschaft und des politischen Engagements vorgeführt.