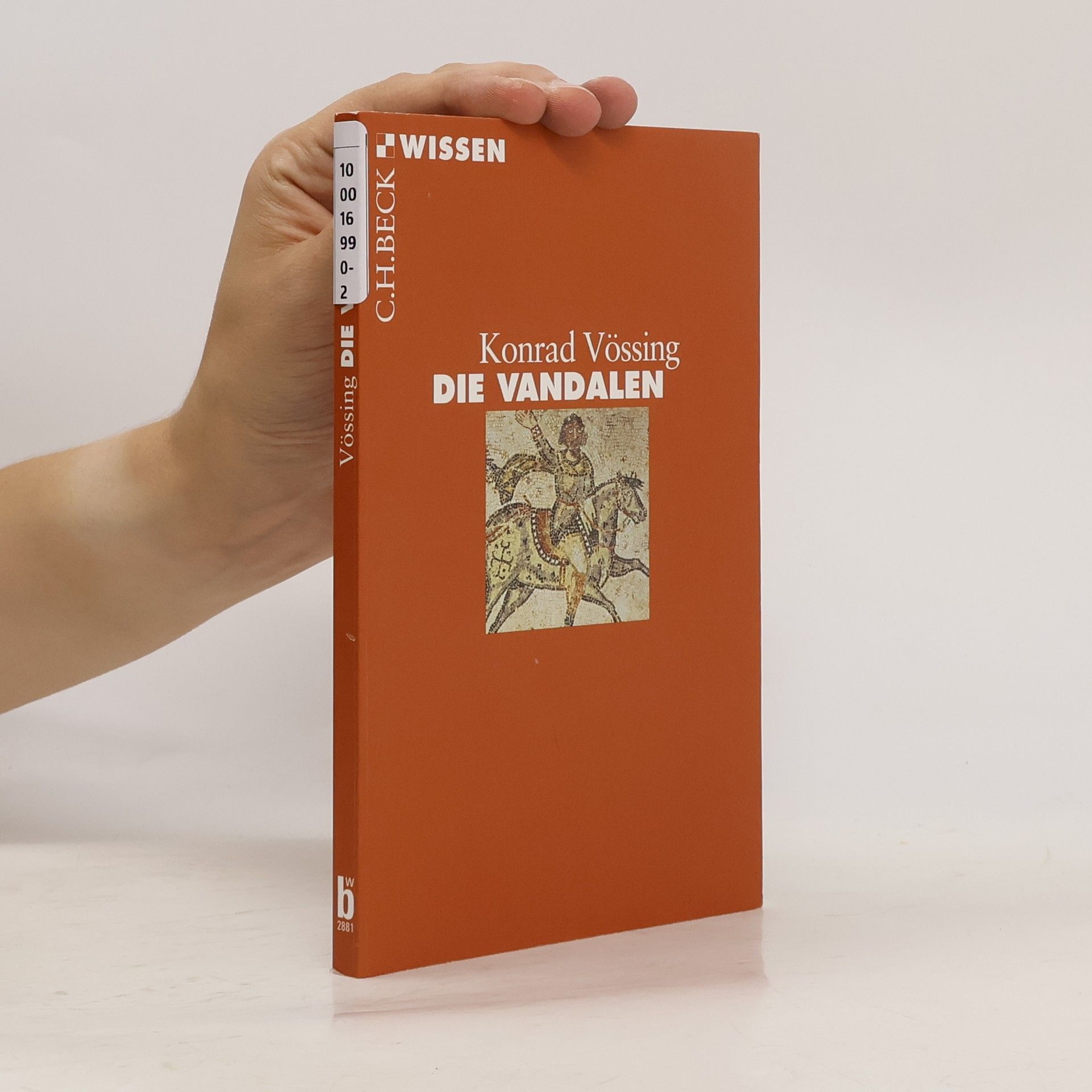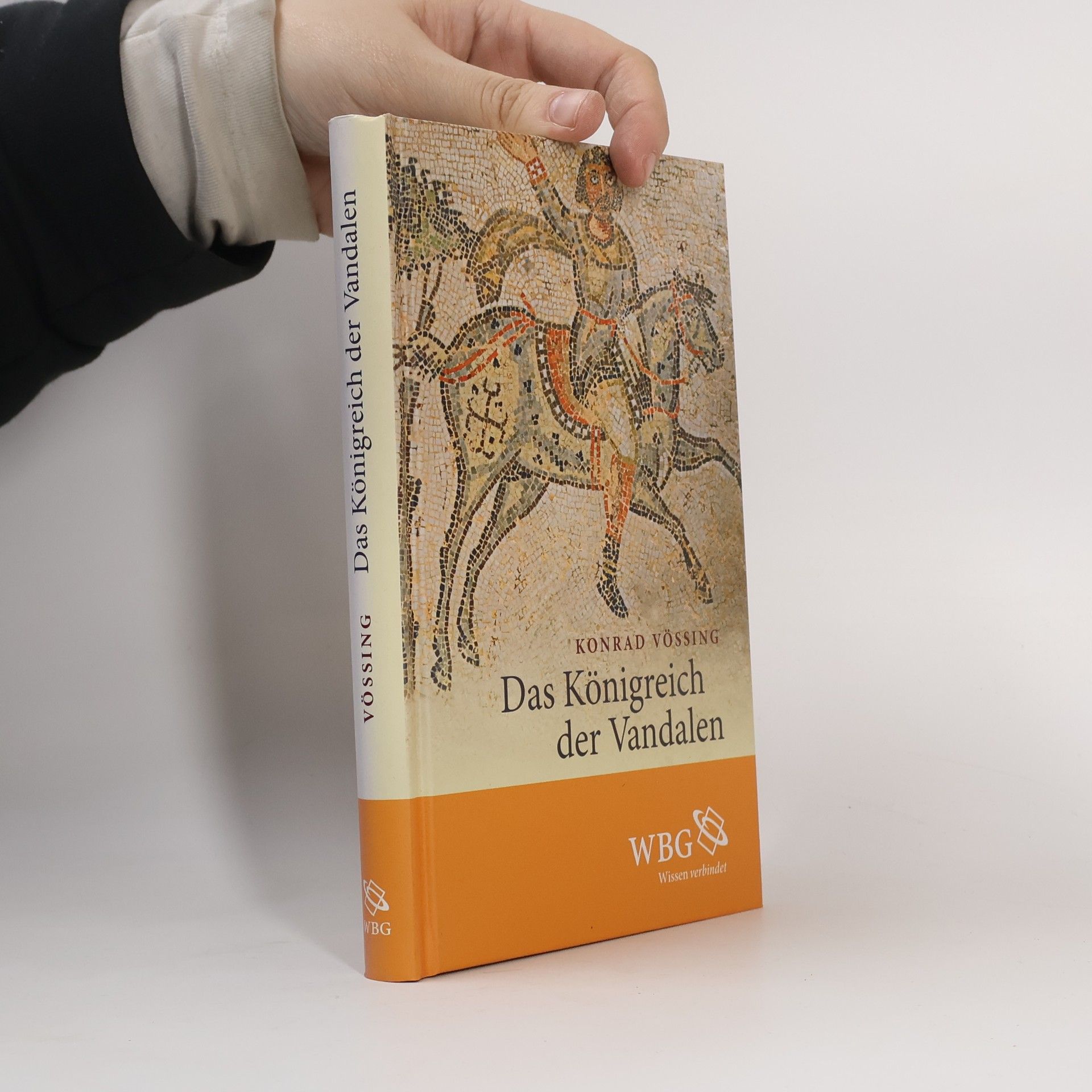Bildatlas zur spätantiken Kleidung
- 224pages
- 8 heures de lecture
Der Bildatlas zur spätantiken Kleidung bietet ein umfassendes Lexikon, das sowohl Fachleuten als auch Interessierten zugänglich ist. Er enthält zahlreiche Fotos, Zeichnungen und Zitate aus der spätantiken Literatur, die grundlegende Informationen über etwa 65 Gewänder vermitteln. Durch die anschaulichen Darstellungen wird ein lebendiges Bild der Kontexte geschaffen, in denen diese Kleidungsstücke getragen wurden, und ermöglicht so einen tiefen Einblick in die Mode und Kultur der Spätantike.