In this excerpt, the author addresses criticism from Georg Hirth, who feels aggrieved that his critique was not published. The author dismisses the notion that Hirth's critique was "crushing," asserting that he is not intimidated by Hirth's youth. The focus remains on the topic of female weakness rather than male perspectives. The author suggests that Hirth has misunderstood the argument, indicating that clarifying the issue would require extensive explanation, possibly an entire book. Instead, the author invites Hirth to seek clarification of the essay. The tone remains firm yet somewhat dismissive, as the author expresses no further desire to engage beyond this point. The publisher, Forgotten Books, emphasizes its commitment to preserving historical works through advanced technology, ensuring that original formats are maintained while addressing imperfections. They acknowledge that some flaws may still be present in their editions, but these are left intentionally to honor the historical integrity of the texts.
Paul J. Möbius Livres

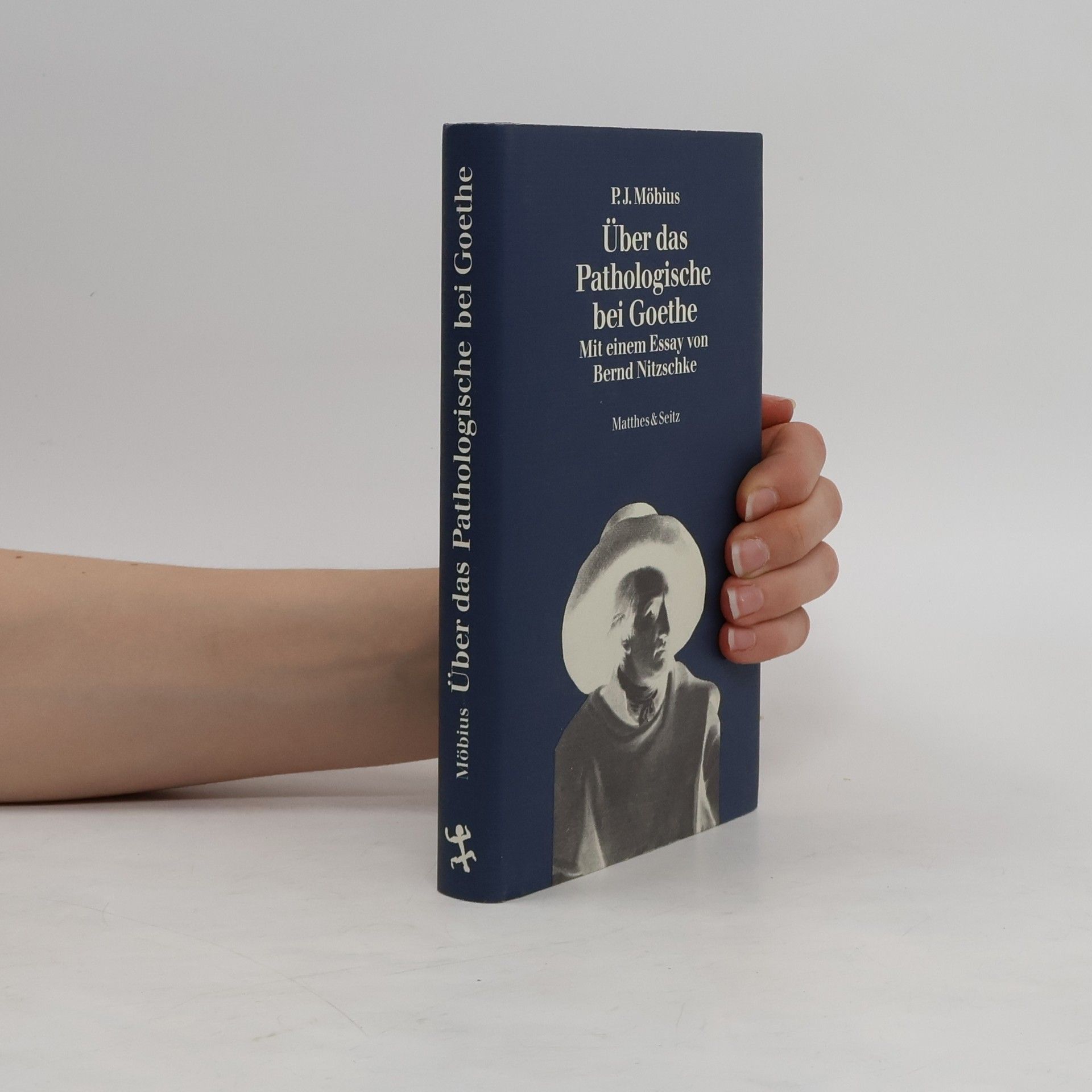
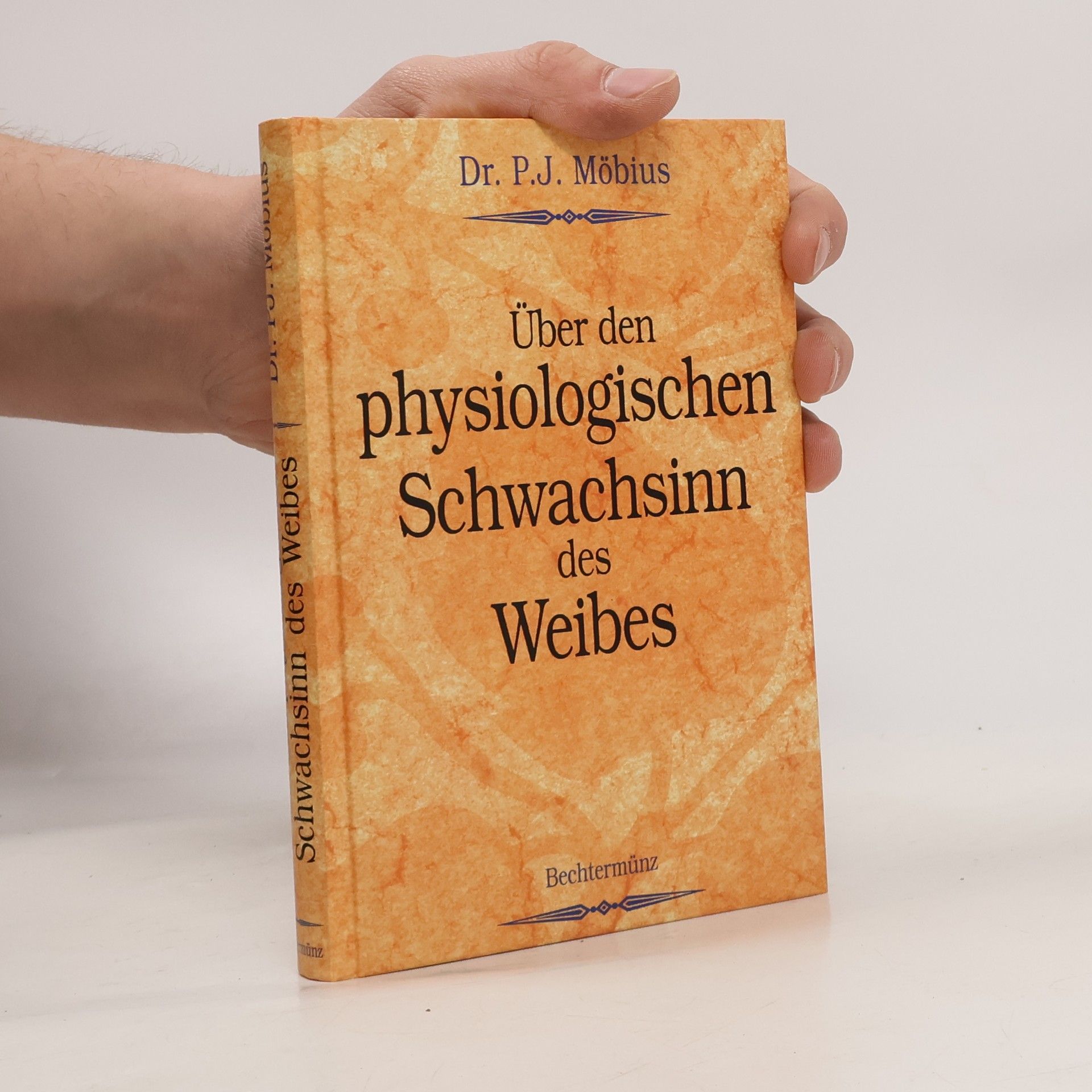
Excerpt from Ueber das Pathologische bei GoetheDorwurfe machen follie, Daà er noch nicht ausgewachfen ift. 2lls man endlich an Stelle Der alten Collhäufer Kranl'enhäufer für 3rre unter är3tlicher älufficht errichtete wurde Die 2ibfonderung Der 3rrenär3te wieder ein hinderc nià . Sie hauften in ihren flofterc'ihnlichen 2lnfialten, wurden oft weltfremd und es bildete fich vielfach Die meinung, als gäbe es nur in Den 3rrenanftalten geiftige Störungen, während Doch nur Die am Schlimmften &ro franften und Die Störeaten aus Der ®efellfchaft aus gefchieden und in Das 3rrenhau5 gebracht werden. 2lnderbrfeits blieb bis in Die neuefte  seit Die groà e 5ahl Der 21er3te von allen pfychiatrifchen Kenntniffen verfchont. Nicht nur fehlte es auf Den liniverfitöten meift an (à es legenheit 3um linterrichte über geiftige Störungen, fondern Der gan3e ®eift Der medicinifchen &r5irhung hinderte Die Schuler, Das Seelifche verftehen 3u lernen, ein plumper materialismus behandelte alles ®eiftige als quantité négligeable. Heuerdings hat man gwar faft überall pfh chiatrifche Klinifen eingerichtet, aber noch fehlt Die Höthb gung Der studenten, Diefe Klinilen fo, wie es nothwendig ware, 3u befuchen noch fehlt vielfach Die &inficht, Daà Der 2ir3t überall, nicht nur in Der pfvchiatrifchen Klinif Das ®eiftige ins 2luge faffen muà , Daà ein pfychiatrifcher Sinn in jeder Klinif von Köthen ift.