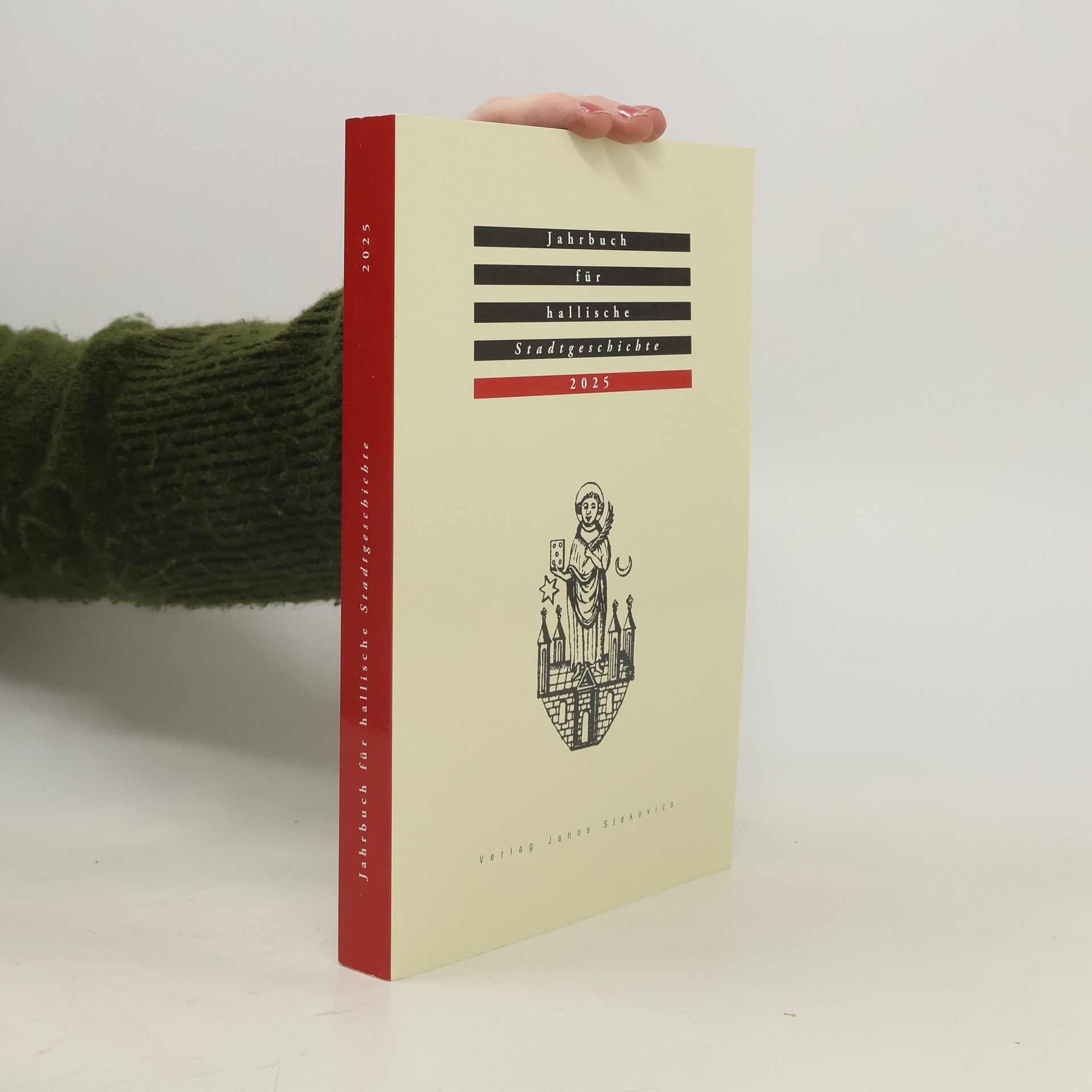Heilen an Leib und Seele
Medizin und Hygiene im 18. Jahrhundert
Der Katalog dokumentiert die erste große Ausstellung zur Medizin im (Halleschen) Pietismus und ordnet diese durch zahlreiche Forschungsbeiträge umfassend ein. Die Einheit von Körper und Seele sowie eine christliche Lebensführung (und damit das Gemüt) waren die zentralen Koordinaten in der Medizin der Pietisten des 18. Jahrhunderts. Der Körper galt als Werkzeug Gottes in der Welt. Deshalb war es eine fundamentale Pflicht, sich gesund zu halten. Wurde ein Mensch krank, war dies zuallererst als göttlicher Fingerzeig zu verstehen. Die Pietisten entwickelten eine Medizinlehre, die zunächst auf Prävention (Diätetik) und im Krankheitsfall sowohl auf körperliche als auch seelische Therapien setzte. Im traditionellen Medizinverständnis war ein gesunder Körper das Ergebnis eines Gleichgewichts der vier Säfte (Humorallehre), welches wiederum durch ein maßvolles Leben erreicht werden konnte. Dieses Konzept erweiterten die pietistischen Ärzte um den zentralen Aspekt der Frömmigkeit: Ein maßvolles Leben bestand nun nicht allein in der Vermeidung von körperlichen, affektiven und emotionalen Extremen, sondern vor allem in einer christlichen Lebensführung. Zu diesem Zweck wurde in den Franckeschen Stiftungen in Halle eine medizinische Gesamttopografie etabliert mit einem der frühesten Krankenhausbauten für Kinder und Jugendliche überhaupt.